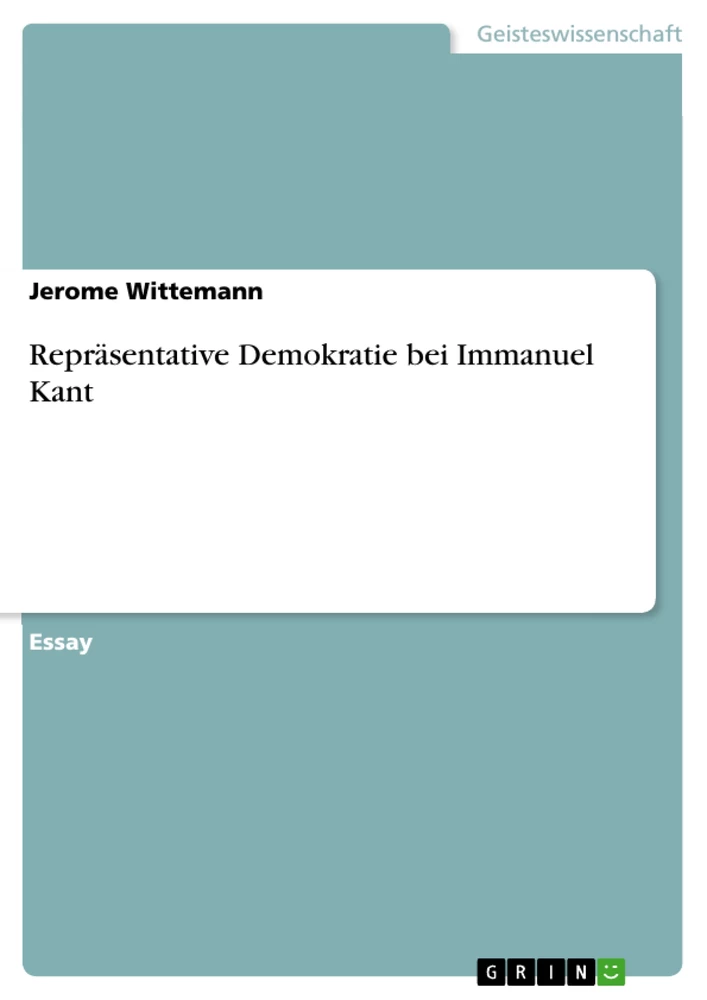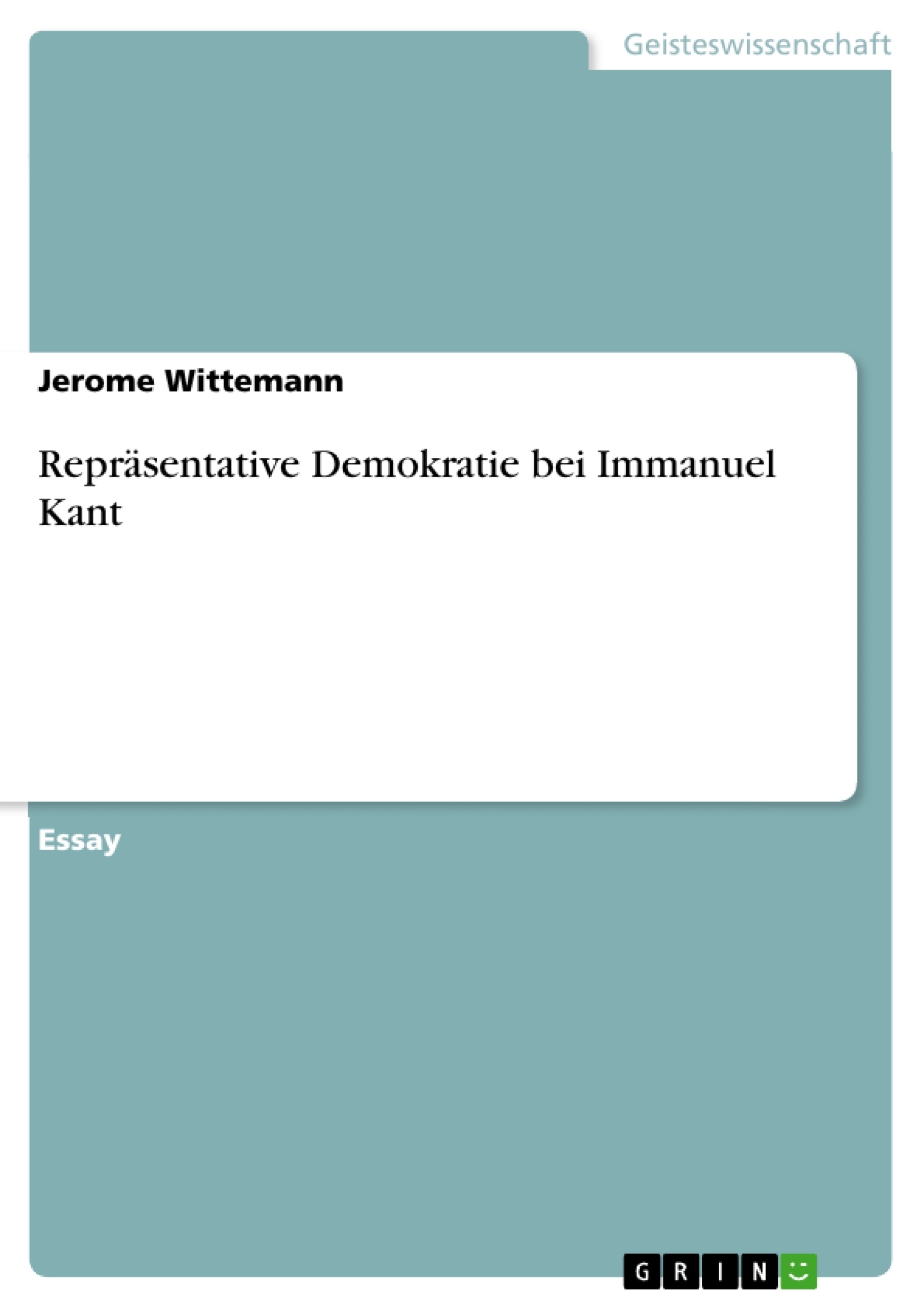Repräsentative Demokratie bei Immanuel Kant
1. Rückblick Rousseau
Rousseau definiert sein Ziel in seinem Werk „Zum Gesellschaftsvertrag“ deutlich:
„Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen Kraft die Person und das Vermögen eines
jeden einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt,
nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor" (Rousseau, 1776/1977: S.17 ).
Rousseau möchte die Freiheit jedes einzelnen Menschen auch im Staat möglich machen. Freiheit
meint hierbei nicht die willkürliche Freiheit tun und lassen zu können was man möchte, sondern das
Befolgen von selbst gegebenen Gesetzen. In Hobbes Konzeption des Gesellschaftsvertrages kann es
keine Freiheit geben, da sich jeder Einzelne dem willkürlichen Willen des Souveräns bedingungslos
unterwirft. Auch John Locke erkannte dies und machte das Volk zum Souverän und damit
Gesetzgeber. Damit war jedoch nur die Freiheit der Mehrheit gesichert, und nicht jedes Einzelnen.
Rousseau macht deshalb „das Volk unter der Bedingung der Herrschaft des allgemeinen Willens“
(Grünewald, 2001: S.13) zum Souverän. Da der allgemeine Wille den eigenen Willen in jedem
Gesetzgebungsakt notwendig enthält, ist somit jedes Gesetz an das sich der Einzelne im Staat hält
dem eigenen Willen entsprungen. Der Gemeinwille ist also nicht nur etwas, dass wir „im
Nachdenken über die Berechtigung von wechselseitigen Forderungen entdecken“ sondern von
vornherein eine „souveränitätskonstitutive Bedingung“ (Ebd.). Rousseau fordert, dass zumindest die
Letztentscheidung über ein jedes Gesetz plebiszitär zu erfolgen hat.
Kant versucht zwischen diesem Ideal, dass sich in seiner„reinen Republik“ niederschlägt und den
empirischen Gegebenheiten, die seiner Meinung nach Repräsentation notwendig machen, zu
vermitteln.
2. Der Gemeinwille bei Kant
Für Kant ist Rousseaus Gemeinwille nicht nur ein staatsrechtliches Gebot, sondern das höchste
Moralprinzip. Er präzisiert den Gedanken des Gemeinwillens im kategorischen Imperativ wie folgt:
"Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Gesetzgebung gelten könne." (Kant, 1838: S. 64).
Inhaltsverzeichnis
- Rückblick Rousseau
- Der Gemeinwille bei Kant
- Kants Staatstheorie
- Repräsentation bei Kant
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Staatstheorie Immanuel Kants und untersucht, wie er die Idee der repräsentativen Demokratie mit seinem Ideal der reinen Republik, die auf dem Gemeinwillen basiert, in Einklang bringt.
- Der Gemeinwille als höchstes Moralprinzip und seine Verbindung zum kategorischen Imperativ
- Kants Staatstheorie und die drei Verfassungsprinzipien: Freiheit, Gleichheit und Autonomie
- Die Notwendigkeit der Repräsentation in der wahren Republik aufgrund empirischer Einschränkungen
- Die Legitimation der Repräsentation durch kognitive, volitive und prozedurale Bedingungen
- Die Bedeutung des Gemeinwillens als Regulative Leitidee für die Gesetzgebung und die Organisation des Staatswesens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Rousseaus Konzept des Gesellschaftsvertrages und die Bedeutung des Gemeinwillens für die Freiheit des Einzelnen. Es wird gezeigt, wie Rousseau die Freiheit im Staat durch die Befolgung von selbst gegebenen Gesetzen definiert und wie er die Letztentscheidung über Gesetze dem Volk überträgt.
Das zweite Kapitel untersucht Kants Interpretation des Gemeinwillens im Kontext des kategorischen Imperativs. Es wird erläutert, wie der kategorische Imperativ als Probierstein für die Rechtmäßigkeit von Gesetzen dient und wie er die Übereinstimmung von Einzelwillen mit dem Gemeinwillen überprüft.
Das dritte Kapitel widmet sich Kants Staatstheorie und den drei Verfassungsprinzipien: Freiheit, Gleichheit und Autonomie. Es wird dargestellt, wie Kant den Gesellschaftsvertrag als unbedingte Pflicht betrachtet und wie er die drei Prinzipien als Bedingung der Möglichkeit einer Staatsgründung definiert.
Das vierte Kapitel analysiert Kants Konzept der Repräsentation in der wahren Republik. Es wird gezeigt, wie Kant die Repräsentation als notwendiges Mittel aufgrund empirischer Einschränkungen betrachtet und wie er die Legitimation der Repräsentation durch kognitive, volitive und prozedurale Bedingungen begründet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die repräsentative Demokratie, den Gemeinwillen, den kategorischen Imperativ, Kants Staatstheorie, die drei Verfassungsprinzipien (Freiheit, Gleichheit, Autonomie), die wahre Republik, die reine Republik, die Repräsentation, die Legitimation der Repräsentation, kognitive, volitive und prozedurale Bedingungen, der Gesellschaftsvertrag, die Gesetzgebung und die Organisation des Staatswesens.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Kant den Gemeinwillen?
Für Kant ist der Gemeinwille das höchste Moralprinzip, das im kategorischen Imperativ zum Ausdruck kommt: Handle nach Maximen, die als allgemeine Gesetze gelten könnten.
Was sind Kants drei Verfassungsprinzipien?
Kants Staatstheorie basiert auf den drei Prinzipien Freiheit jedes Gliedes der Gesellschaft, Gleichheit aller und Autonomie (Selbständigkeit) jedes Bürgers.
Warum hält Kant Repräsentation für notwendig?
Aufgrund empirischer Gegebenheiten und Einschränkungen sieht Kant in der Repräsentation ein notwendiges Mittel, um das Ideal der „reinen Republik“ in der Praxis umzusetzen.
Welchen Unterschied gibt es zwischen Hobbes und Rousseau/Kant?
Bei Hobbes unterwirft man sich dem willkürlichen Willen des Souveräns, während bei Rousseau und Kant Freiheit bedeutet, nur den Gesetzen zu gehorchen, die man sich selbst (über den Gemeinwillen) gegeben hat.
Was ist die „wahre Republik“ bei Kant?
Die wahre Republik ist ein Staatswesen, in dem das Volk durch Repräsentanten handelt, wobei der Gemeinwille als regulative Leitidee für die Gesetzgebung dient.
- Quote paper
- Jerome Wittemann (Author), 2011, Repräsentative Demokratie bei Immanuel Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183961