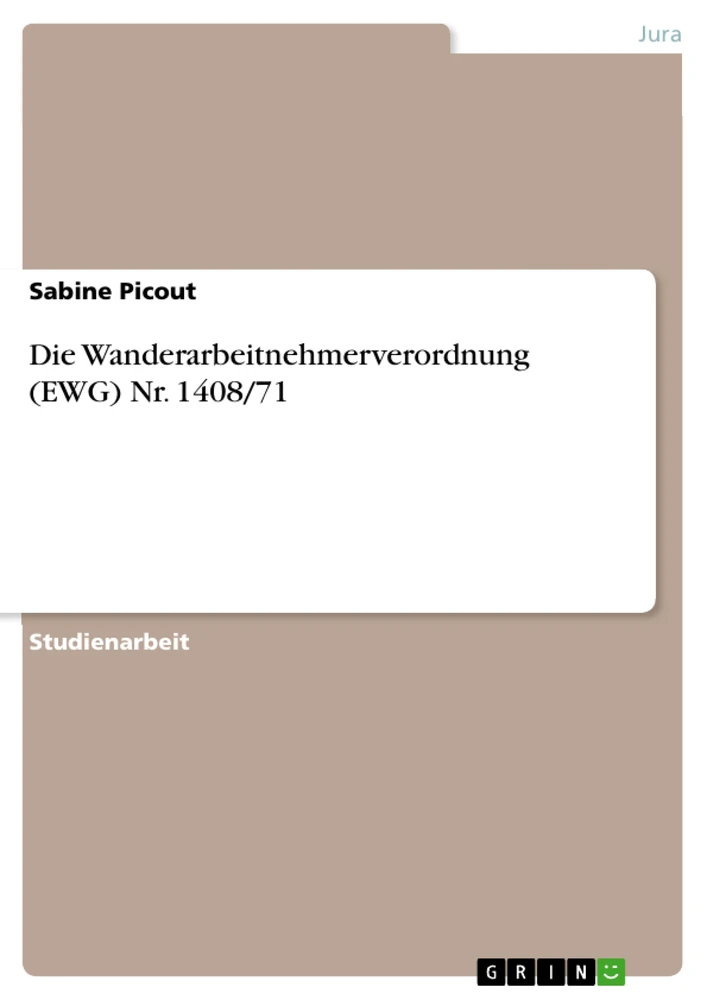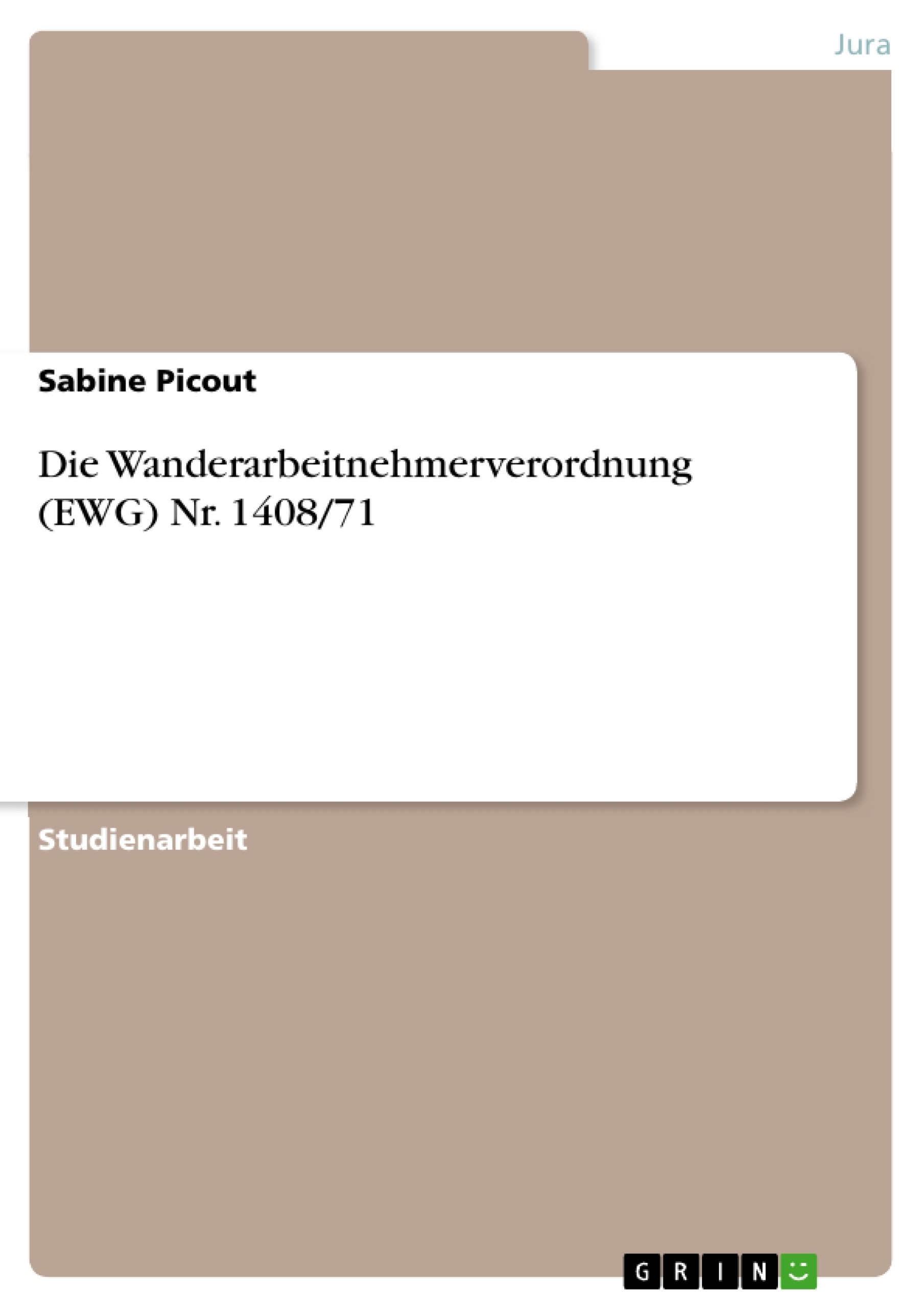Ein wichtiges Ziel der Römischen Verträge ist es, die Hindernisse für die Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu beseitigen.
Um jedoch eine grenzüberschreitende Mobilität zu gewährleisten, müssen Maßnahmen der sozialen Sicherheit erlassen werden, welche ermöglichen, dass die EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Heimatland arbeiten und wohnen, ihre sozialen Rechte nicht teilweise oder vollständig einbüßen.
Auf Grundlage des Artikels 42 EGV wurden im Bereich der Sozialpolitik Koordinierungsregeln erlassen, damit die Arbeitnehmerfreizügigkeit nun hindernislos verwirklicht werden konnte.
Ein Beispiel hiefür ist die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern ("Wanderarbeitnehmerverordnung“).
Diese Verordnung soll den Personen in der Gemeinschaft umfassende Freizügigkeit gewährleistet, indem sie sozialrechtliche Nachteile beseitigt, die aufgrund der Mobilität innerhalb Europas hervorgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Wanderarbeitnehmerverordnung
- III. Räumlicher Geltungsbereich
- IV. Personeller Geltungsbereich
- V. Sachlicher Geltungsbereich
- VI. Das Spannungsverhältnis zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht
- (1) Verletzung der passiven Dienstleistungsfreiheit durch Sozialversicherungszwang
- (2) Die Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen durch Sozialversicherte im Ausland
- (3) Aktive Dienstleistungsfreiheit von Leistungserbringern
- VII. Die Hauptgrundsätze der Verordnung 1408/71
- (1) Grundsatz der Koordination der nationalen Sozialversicherungssysteme
- (2) Gleichbehandlungsgrundsatz
- (3) Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten
- (4) Verbot der Doppelleistungen bzw. Kumulierungsverbot
- (5) Einheitsprinzip und Territorialitätsprinzip
- (6) Grundsatz der Exportierbarkeit von Leistungen
- VIII. Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Wanderarbeitnehmerverordnung (EWG) Nr. 1408/71, die die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme in der Europäischen Union regelt. Ziel ist es, die Funktionsweise und die wichtigsten Elemente der Verordnung zu beleuchten, die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht zu erörtern und die Bedeutung der Verordnung für die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU aufzuzeigen.
- Anwendung und Koordination der Sozialversicherungssysteme innerhalb der EU
- Räumlicher, personeller und sachlicher Geltungsbereich der Verordnung
- Spannungsverhältnis zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht
- Die Hauptgrundsätze der Verordnung 1408/71
- Bedeutung der Verordnung für die Arbeitnehmerfreizügigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I. Einleitung: Die Einleitung legt die Bedeutung der Verordnung 1408/71 für die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU dar. Sie verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht und erläutert die Gründe für die Koordinierung anstatt einer Harmonisierung der nationalen Sozialversicherungssysteme.
Kapitel II. Die Wanderarbeitnehmerverordnung: Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise und den Zweck der Wanderarbeitnehmerverordnung, insbesondere die Koordinierung der nationalen Regelungen und die Vereinfachung des Wechsels von einem Sozialversicherungssystem in ein anderes.
Kapitel III. Räumlicher Geltungsbereich: Hier wird der räumliche Geltungsbereich der Verordnung erläutert, der das gesamte Gemeinschaftsgebiet sowie die zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten umfasst.
Kapitel IV. Personeller Geltungsbereich: Der personelle Geltungsbereich der Verordnung wird dargelegt. Er umfasst ursprünglich Arbeitnehmer und wurde später auf Selbstständige und Familienangehörige ausgedehnt.
Kapitel V. Sachlicher Geltungsbereich: Der sachliche Geltungsbereich der Verordnung wird behandelt, der sich auf alle Zweige der sozialen Sicherheit bezieht.
Kapitel VI. Das Spannungsverhältnis zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die aus dem Spannungsfeld zwischen Grundfreiheiten und Sozialrecht entstehen, beispielsweise durch die Verletzung der passiven Dienstleistungsfreiheit durch Sozialversicherungszwang.
Kapitel VII. Die Hauptgrundsätze der Verordnung 1408/71: Die wichtigsten Grundsätze der Verordnung werden erläutert, wie die Koordination der nationalen Sozialversicherungssysteme, der Gleichbehandlungsgrundsatz und der Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten.
Kapitel VIII. Schlussfolgerungen und Ausblick: Dieses Kapitel wird in der Vorschau nicht berücksichtigt, da es potentiell Spoiler für die Hauptthemen und Argumente des Textes enthalten könnte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Seminararbeit sind: Wanderarbeitnehmerverordnung (EWG) Nr. 1408/71, Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Grundfreiheiten, Sozialrecht, Gleichbehandlung, Zusammenrechnung von Zeiten, Spannungsverhältnis, Exportierbarkeit von Leistungen, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71?
Das Ziel ist die Koordinierung der nationalen Sozialversicherungssysteme, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der EU zu gewährleisten, ohne dass diese ihre sozialen Rechte verlieren.
Wer fällt unter den personellen Geltungsbereich dieser Verordnung?
Ursprünglich galt sie für Arbeitnehmer, wurde aber später auf Selbstständige sowie deren Familienangehörige ausgeweitet.
Was bedeutet der „Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten“?
Er stellt sicher, dass Versicherungszeiten, die in verschiedenen Mitgliedstaaten zurückgelegt wurden, bei der Berechnung von Leistungen (z. B. Rente) addiert werden.
Was versteht man unter der „Exportierbarkeit von Leistungen“?
Dies bedeutet, dass Ansprüche auf Sozialleistungen (wie Renten) auch dann bestehen bleiben und ausgezahlt werden, wenn der Berechtigte in einen anderen EU-Mitgliedstaat zieht.
Gibt es ein Verbot von Doppelleistungen?
Ja, das Kumulierungsverbot verhindert, dass eine Person für denselben Zeitraum und dasselbe Risiko gleichzeitig Leistungen aus mehreren nationalen Systemen bezieht.
Was ist der Unterschied zwischen Koordinierung und Harmonisierung?
Bei der Koordinierung bleiben die nationalen Systeme eigenständig und werden nur abgestimmt, während eine Harmonisierung die Schaffung eines einheitlichen europäischen Sozialrechts bedeuten würde.
- Quote paper
- MMag. Dr. Sabine Picout (Author), 2007, Die Wanderarbeitnehmerverordnung (EWG) Nr. 1408/71, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185017