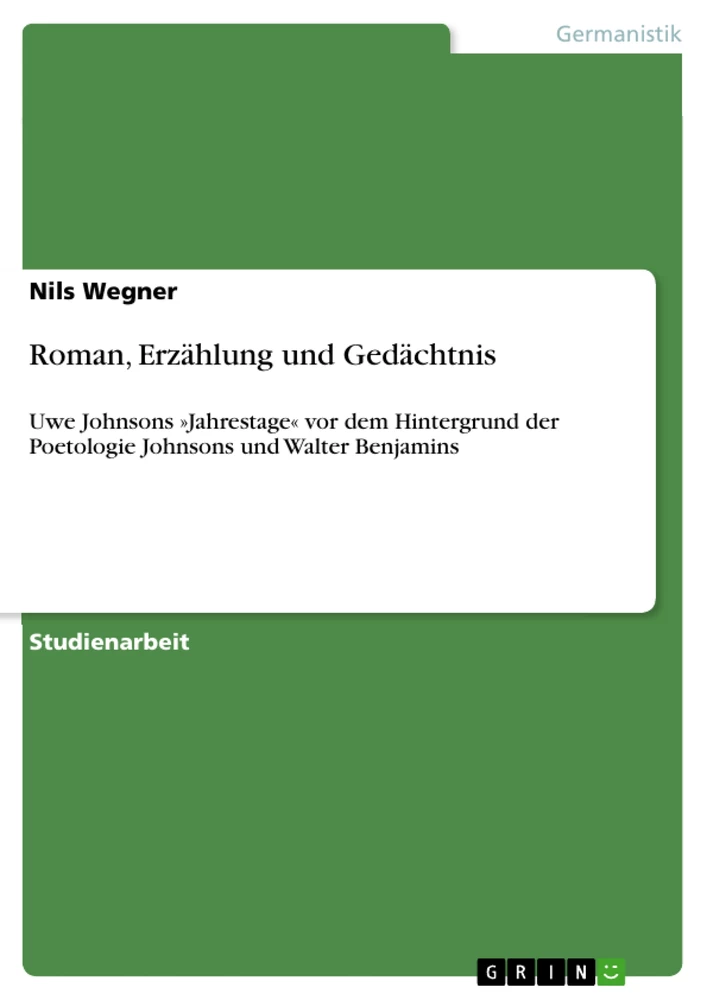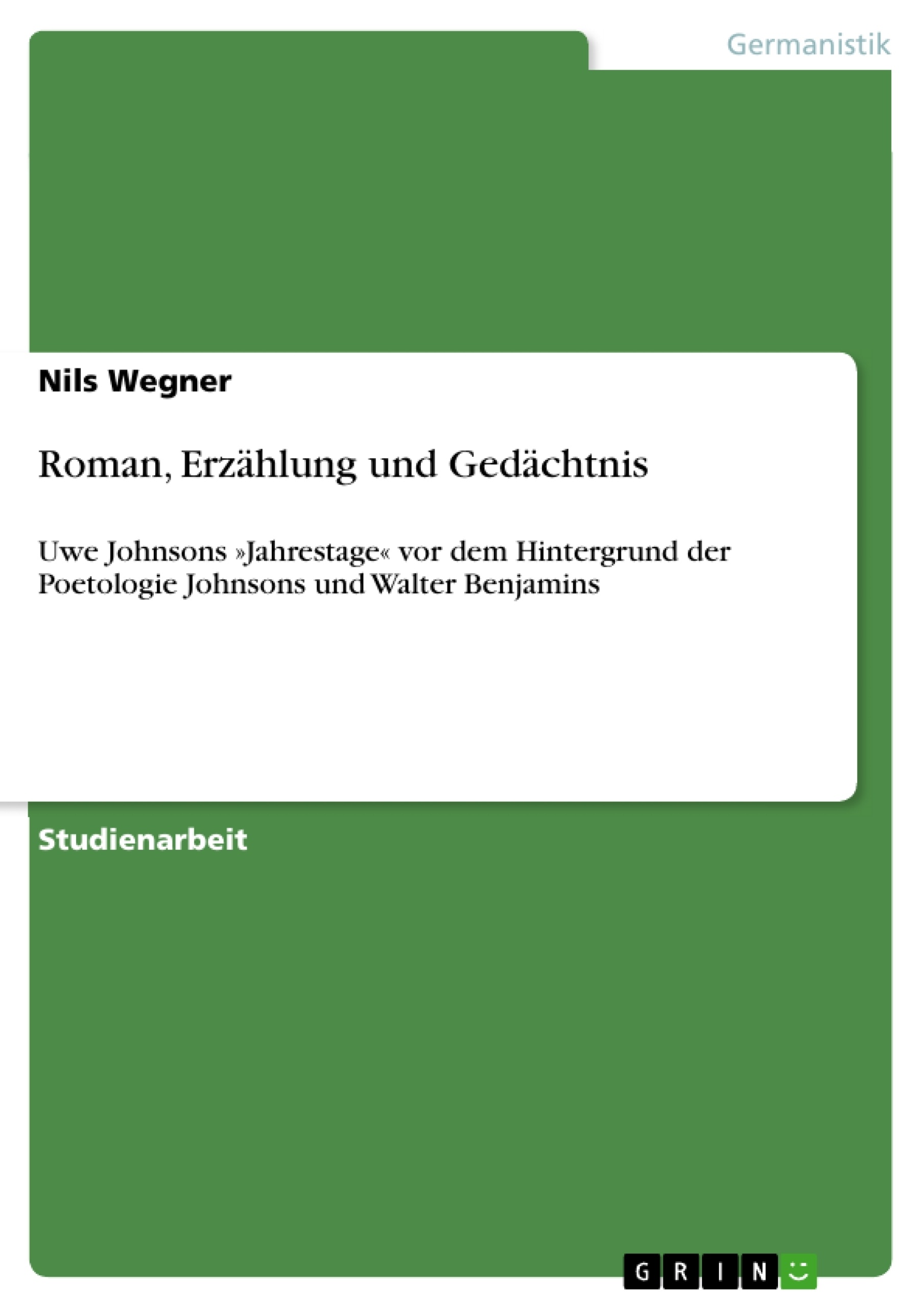Uwe Johnsons voluminösem Roman »Jahrestage« steht die Bezeichnung als »Roman der Moderne« angesichts seiner zeitlichen Rückgebundenheit an – nicht ausschließlich, aber zuvorderst – die Sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts sowie seiner vielschichtigen und auf diversen Ebenen gleichzeitig funktionierenden Erzählweise zweifellos gut zu Gesicht.
In dieser »modernen« Herangehensweise an die kulturelle Leistung des »Erzählens«, die so alt sein dürfte wie die Menschheit selbst, sowie in seinen eigenen Überlegungen zum Wesen der romanhaften Literatur an sich (wie in seinem Aufsatz »Vorschläge zur Prüfung eines Romans« niedergelegt) berührte Johnson jedoch gleichsam auch ein Gebiet der – wenn man sie so nennen möchte – »Erzählkritik«.
Die Grundlagen zu dieser Erzählkritik im Angesicht moderner Literatur legte seinerseits Walter Benjamin mit seinem eher philosophisch gehaltenen Essay »Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows« von 1936, in dem dieser den Unterschied zwischen Erzähler und Romancier anhand Lesskows beispielhaft herauszustellen und weiterhin allgemeinkulturell gültig auszuformulieren versucht. Letztliches Ziel von Benjamins Einlassung scheint dabei eine neu formulierte »Theorie des Romans« zu sein – im Hinblick auf Johnsons Werk ist diese Romantheorie besonders interessant, da Benjamin dem modernen Roman die Fähigkeit, in »klassischer« Form zu erzählen, faktisch abspricht. Diesen Kompetenzverlust leitet er aus mehreren kulturellen Paradigmenwechseln her, die jedoch allesamt mit der Moderne einhergegangen seien.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll vorwiegend sein, die Erzählungs- und Romanvorstellungen Johnsons und Benjamins miteinander abzugleichen und mögliche Schnittmengen festzustellen. Abschließend wird der Versuch unternommen, die »Jahrestage« bzw. ihren ersten Band auf Anhaltspunkte hinsichtlich der Romantheorie beider Autoren zu untersuchen. Die Ergebnisse sollten einen Rückschluß auf die Bedeutung des »Erzählers« nach Benjaminscher Diktion für die (post)moderne Literatur im allgemeinen und darin den Roman im besonderen erlauben. Johnsons »Jahrestage«, mehrbändig erschienen ab 1970, sollen hierbei exemplarisch für zeitgenössische Werke großer deutscher Nachkriegsromanciers stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Walter Benjamin - »Der Erzähler«
- Uwe Johnson - »Vorschläge zur Prüfung eines Romans«
- Die »Jahrestage« als moderner Roman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erzähl- und Romanvorstellungen von Uwe Johnson und Walter Benjamin und sucht nach Schnittmengen. Der Fokus liegt auf der Analyse des ersten Bandes von Johnsons „Jahrestagen“ im Licht der Romantheorien beider Autoren. Die Ergebnisse sollen Rückschlüsse auf die Bedeutung des „Erzählers“ (nach Benjamin) für die (post)moderne Literatur ermöglichen.
- Vergleich der Erzählkonzepte von Johnson und Benjamin
- Analyse der „Jahrestage“ im Kontext der Benjaminschen Romantheorie
- Die Rolle des Erzählers in der modernen Literatur
- Die „Jahrestage“ als Beispiel für den modernen Roman
- Zeitliche und erzählerische Besonderheiten des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: den Vergleich der Erzählkonzepte von Uwe Johnson und Walter Benjamin und deren Anwendung auf Johnsons „Jahrestage“. Es wird die Relevanz von Benjamins Romantheorie für das Verständnis des modernen Romans, insbesondere der „Jahrestage“, hervorgehoben. Die Arbeit soll die Bedeutung des Erzählers in der postmodernen Literatur beleuchten, wobei Johnsons mehrbändiges Werk als exemplarisch für zeitgenössische deutsche Nachkriegsliteratur betrachtet wird.
Walter Benjamin - »Der Erzähler«: In diesem Kapitel wird Benjamins Essay „Der Erzähler“ analysiert. Benjamin verwendet Lesskows Werk als Ausgangspunkt, um den Unterschied zwischen Erzähler und Romancier zu erörtern und eine Romantheorie zu entwickeln. Benjamin verfolgt die genealogische Entwicklung der Erzählung vom Mythos zum Märchen und grenzt die klassische Erzählung vom modernen Roman ab. Der moderne Roman wird als ein Produkt des Individuums in seiner Einsamkeit charakterisiert, das im Gegensatz zur kollektiven Erfahrung der Erzählung auf Allgemeinplätze setzt und ein geschlossenes, konsumierbares Werk darstellt.
Schlüsselwörter
Uwe Johnson, Jahrestage, Walter Benjamin, Erzähler, Romantheorie, Moderne, Postmoderne, Erzählkritik, Mündliche Tradition, Kollektiverfahrung, Individuum, Roman, Erzählung, Märchen, Mythos.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Erzählkonzepte von Uwe Johnson und Walter Benjamin in den „Jahrestagen“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Erzähl- und Romanvorstellungen von Uwe Johnson und Walter Benjamin und sucht nach Schnittmengen. Der Fokus liegt auf der Analyse des ersten Bandes von Johnsons „Jahrestagen“ im Licht der Romantheorien beider Autoren. Ziel ist es, Rückschlüsse auf die Bedeutung des „Erzählers“ (nach Benjamin) für die (post)moderne Literatur zu ziehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Erzählkonzepte von Johnson und Benjamin, die Analyse der „Jahrestage“ im Kontext der Benjaminschen Romantheorie, die Rolle des Erzählers in der modernen Literatur, die „Jahrestage“ als Beispiel für den modernen Roman und die zeitlichen und erzählerischen Besonderheiten des Romans.
Welche Autoren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Im Mittelpunkt stehen die Werke und Theorien von Uwe Johnson (insbesondere sein Roman „Jahrestage“) und Walter Benjamin (insbesondere sein Essay „Der Erzähler“).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Walter Benjamins „Der Erzähler“, ein Kapitel zu Uwe Johnsons „Vorschläge zur Prüfung eines Romans“, ein Kapitel zur Analyse der „Jahrestage“ als moderner Roman und ein Kapitel mit Schlussfolgerungen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor. Die Kapitel analysieren die relevanten Texte und Theorien der Autoren.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung ist der Vergleich der Erzählkonzepte von Uwe Johnson und Walter Benjamin und deren Anwendung auf Johnsons „Jahrestage“. Wie lässt sich Benjamins Romantheorie auf den modernen Roman, insbesondere die „Jahrestage“, anwenden?
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Uwe Johnson, Jahrestage, Walter Benjamin, Erzähler, Romantheorie, Moderne, Postmoderne, Erzählkritik, Mündliche Tradition, Kollektiverfahrung, Individuum, Roman, Erzählung, Märchen, Mythos.
Was wird in Benjamins Essay „Der Erzähler“ analysiert?
In diesem Kapitel wird Benjamins Essay „Der Erzähler“ analysiert, in dem er den Unterschied zwischen Erzähler und Romancier erörtert und eine Romantheorie entwickelt. Er verfolgt die genealogische Entwicklung der Erzählung vom Mythos zum Märchen und grenzt die klassische Erzählung vom modernen Roman ab. Der moderne Roman wird als ein Produkt des Individuums in seiner Einsamkeit charakterisiert.
Wie wird der Roman „Jahrestage“ in der Arbeit betrachtet?
Die „Jahrestage“ werden als exemplarisch für zeitgenössische deutsche Nachkriegsliteratur und als Beispiel für den modernen Roman betrachtet. Die Arbeit analysiert den Roman im Kontext der Romantheorien von Benjamin.
Welche Schlussfolgerungen werden angestrebt?
Die Arbeit strebt danach, die Bedeutung des Erzählers in der postmodernen Literatur zu beleuchten und Rückschlüsse auf die Bedeutung von Benjamins Romantheorie für das Verständnis des modernen Romans zu ziehen.
- Quote paper
- Nils Wegner (Author), 2011, Roman, Erzählung und Gedächtnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185090