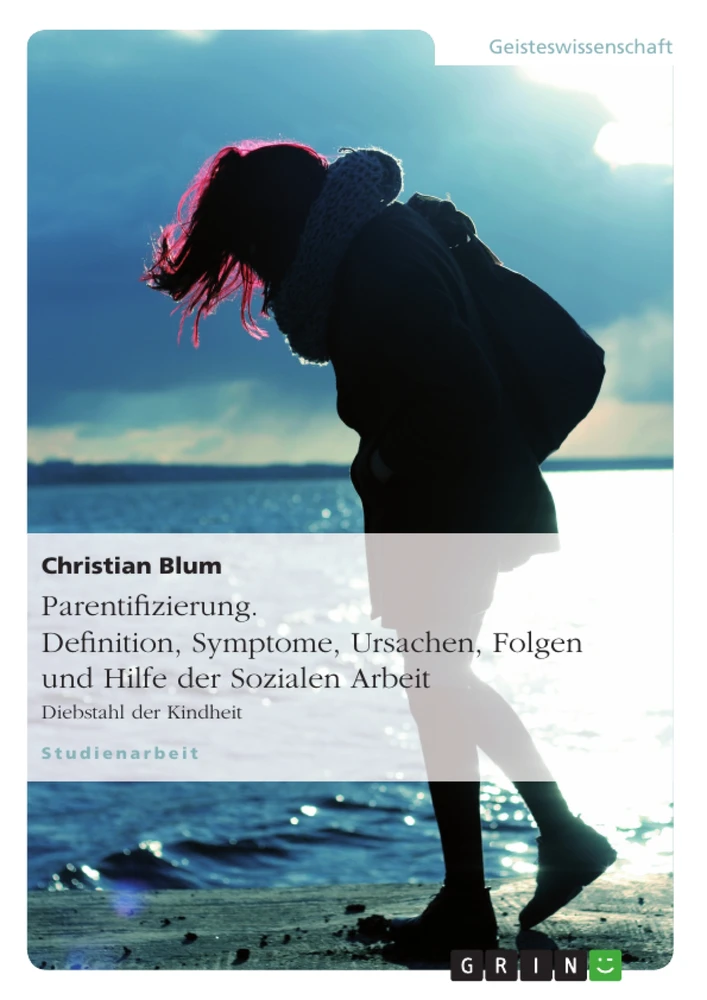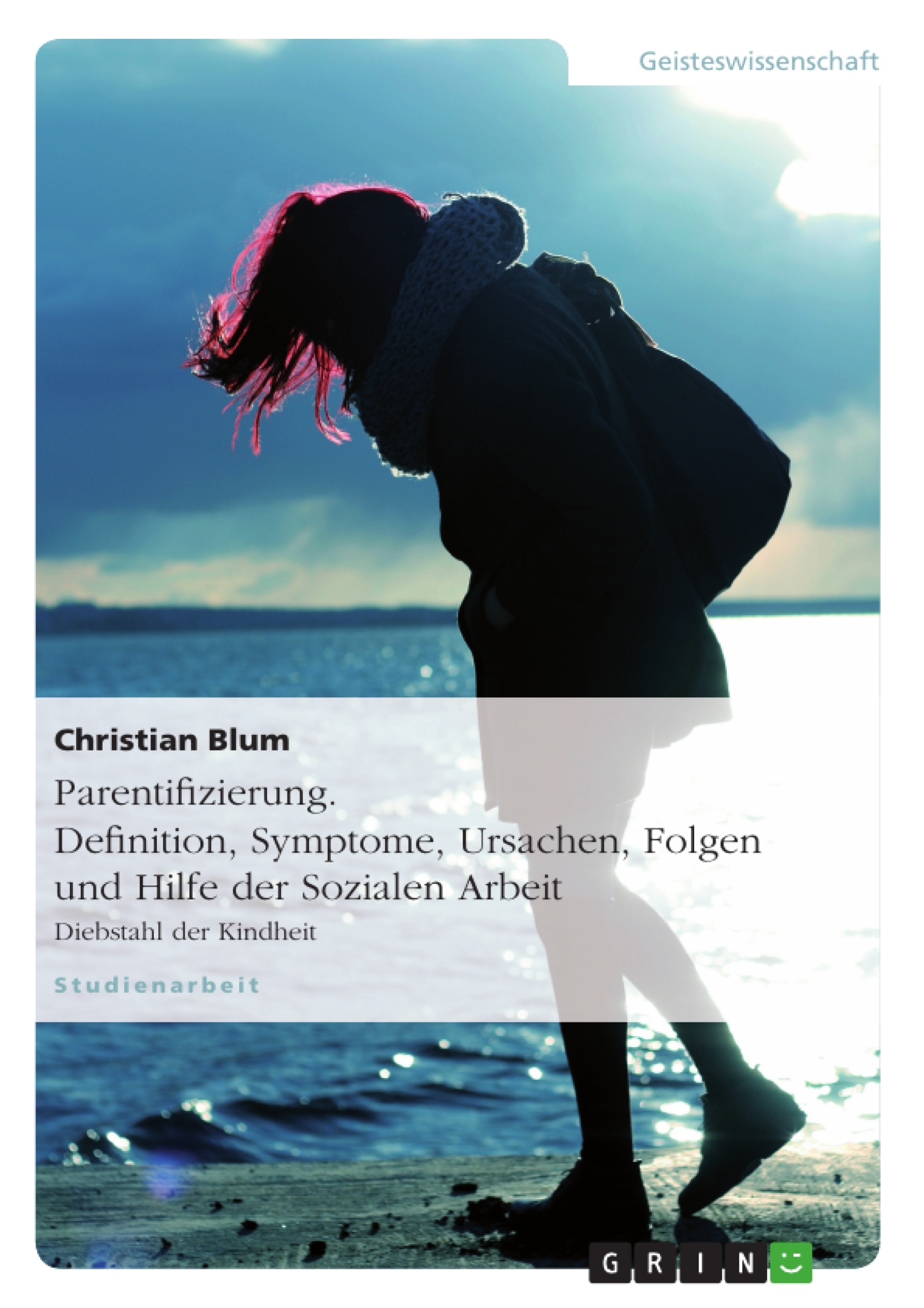Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen werden in Ihrer Arbeit in der Familien-, Kinder-und Jugendhilfe immer wieder mit verschiedensten familiären Situationen, Konstellationen und deren Auswirkungen auf die einzelnen Familienmitglieder und dem Familienumfeld konfrontiert. In den seltensten Fällen sind die sozialen Schieflagen den Klienten und Klientinnen bekannt. Der Bedarf an professioneller Hilfe ist den Betroffenen und deren Umfeld selten bewusst.
Während meiner Arbeit im Kinderheim sind mir Kinder in Erscheinung getreten, die zum Einen immer ruhig waren und kaum auffielen und zum Anderen welche durch aggressives und bestimmendes Verhalten hervorstachen. In Gesprächen mit anwesenden Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen viel mir besonders auf, dass bei fast allen Kindern familiäre Missstände herrschen. Dabei wurde mein Interesse geweckt und ich stieß auf ein hervorstechendes Phänomen, bei dem Ursachen und Folgen einen eher widersprüchlichen Charakter haben, die Parentifizierung.
Während meiner Recherchen in Büchern, Artikel und Internetseiten fand wenig Material speziell für Parentifizierung. Daher widmet sich diese Hausarbeit den Fragen: Was ist Parentifizierung? Was können Ursachen und Folgen sein? Und wie kann Betroffenen und Ihren Familien geholfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition/Symptome
- 2.1 Definition nach ICD-10-GM Version 2011
- 2.2 Parentifizierung - Begriffsentwicklung und Formen
- 2.3 Rollen parentifizierter Kinder
- 2.4 Komorbidität
- 3 Ursachen für Parentifizierung
- 3.1 Suchtmittelmissbrauch der Eltern
- 3.2 Psychische Störung und Erkrankung der Eltern
- 3.3 Generationsübergreifende Familiendynamik
- 4 Folgen für Betroffene
- 4.1 In der Kindheit
- 4.2 Langzeitfolgen
- 5 Hilfen der Sozialen Arbeit
- 5.1 Ambulante Behandlung
- 5.2 Kinder- und Jugendhilfe
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der Parentifizierung. Die Zielsetzung ist es, Parentifizierung zu definieren, häufige Ursachen und langfristige Folgen für betroffene Kinder zu beleuchten und mögliche Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.
- Definition und Formen der Parentifizierung
- Ursachen von Parentifizierung im familiären Kontext
- Auswirkungen von Parentifizierung auf die Entwicklung des Kindes
- Langzeitfolgen für betroffene Personen
- Interventionen und Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: Die Begegnung des Autors mit Kindern in einem Kinderheim, die durch familiäre Missstände geprägt waren. Das Interesse an Parentifizierung wird geweckt, da Ursachen und Folgen dieses Phänomens widersprüchlich erscheinen. Die Arbeit soll die Fragen nach Definition, Ursachen, Folgen und Hilfsmöglichkeiten beantworten.
2 Definition/Symptome: Dieses Kapitel definiert Parentifizierung als Rollenumkehr, bei der Kinder altersunangemessene Rollen übernehmen. Die Definition nach ICD-10 wird vorgestellt, die Parentifizierung als reaktive Bindungsstörung beschreibt, die durch Vernachlässigung oder Misshandlung entsteht. Verschiedene Formen und die historische Entwicklung des Begriffs werden diskutiert, inklusive des Konzepts der adaptiven versus destruktiven Parentifizierung. Die verschiedenen Rollen, die parentifizierte Kinder einnehmen (z.B. die sorgende oder die opfernde Rolle), werden ebenfalls erläutert.
3 Ursachen für Parentifizierung: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Parentifizierung. Es werden drei Hauptfaktoren beleuchtet: Suchtmittelmissbrauch der Eltern, psychische Erkrankungen der Eltern und generationsübergreifende Familiendynamiken. Jeder Faktor wird detailliert beschrieben und seine Rolle bei der Entstehung von Parentifizierung erläutert. Es wird der Zusammenhang zwischen elterlichen Problemen und der Übertragung von Verantwortung auf das Kind dargestellt.
4 Folgen für Betroffene: Hier werden die Folgen von Parentifizierung für die betroffenen Kinder aufgezeigt, sowohl in der Kindheit als auch langfristig. Die Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung, das Selbstwertgefühl und die Beziehungen zu Gleichaltrigen werden diskutiert. Die Kapitel beschreibt die potenziell schweren Folgen für das spätere Leben.
5 Hilfen der Sozialen Arbeit: Das Kapitel beschreibt mögliche Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit für betroffene Kinder und Familien. Es werden ambulante Behandlungsansätze und die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe hervorgehoben. Die Bedeutung professioneller Unterstützung und Interventionen wird betont.
Schlüsselwörter
Parentifizierung, Rollenumkehr, Kinderschutz, Familientherapie, ICD-10, Sucht, psychische Erkrankung, generationsübergreifende Traumatisierung, soziale Arbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Langzeitfolgen, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Parentifizierung - Rollenumkehr in Familien
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Parentifizierung, bei der Kinder altersunangemessene Rollen und Verantwortung in der Familie übernehmen. Sie beleuchtet Definition, Ursachen, Folgen und mögliche Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit.
Wie wird Parentifizierung definiert?
Parentifizierung wird als Rollenumkehr definiert, bei der Kinder Aufgaben und Verantwortung übernehmen, die eigentlich den Eltern zukommen. Die Arbeit bezieht sich auf die Definition nach ICD-10, die Parentifizierung als reaktive Bindungsstörung im Zusammenhang mit Vernachlässigung oder Misshandlung beschreibt. Verschiedene Formen und die historische Entwicklung des Begriffs werden diskutiert, inklusive der Unterscheidung zwischen adaptiver und destruktiver Parentifizierung.
Welche Ursachen werden für Parentifizierung genannt?
Die Arbeit identifiziert drei Hauptursachen: Suchtmittelmissbrauch der Eltern, psychische Erkrankungen der Eltern und generationsübergreifende Familiendynamiken. Jeder Faktor wird detailliert beschrieben, und der Zusammenhang zwischen elterlichen Problemen und der Übertragung von Verantwortung auf das Kind wird dargestellt.
Welche Folgen hat Parentifizierung für betroffene Kinder?
Die Arbeit beschreibt die Folgen von Parentifizierung sowohl in der Kindheit als auch langfristig. Es werden Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung, das Selbstwertgefühl und die Beziehungen zu Gleichaltrigen diskutiert. Die potenziell schweren Folgen für das spätere Leben werden hervorgehoben.
Welche Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt ambulante Behandlungsansätze und die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe. Die Bedeutung professioneller Unterstützung und Interventionen wird betont.
Welche Rollen nehmen parentifizierte Kinder ein?
Parentifizierte Kinder übernehmen verschiedene Rollen, beispielsweise die sorgende Rolle (für jüngere Geschwister oder die Eltern) oder die opfernde Rolle (indem sie eigene Bedürfnisse vernachlässigen).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition/Symptome, Ursachen für Parentifizierung, Folgen für Betroffene, Hilfen der Sozialen Arbeit und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird im Text detailliert zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parentifizierung, Rollenumkehr, Kinderschutz, Familientherapie, ICD-10, Sucht, psychische Erkrankung, generationsübergreifende Traumatisierung, soziale Arbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Langzeitfolgen, Entwicklungspsychologie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Parentifizierung zu definieren, häufige Ursachen und langfristige Folgen für betroffene Kinder zu beleuchten und mögliche Hilfsmassnahmen der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.
Wo finde ich weitere Informationen zu Parentifizierung?
Weitere Informationen finden Sie durch die Suche nach den oben genannten Schlüsselwörtern in wissenschaftlichen Datenbanken, Fachliteratur und auf Webseiten von Organisationen, die sich mit Kinderschutz und Familienhilfe beschäftigen.
- Quote paper
- Christian Blum (Author), 2011, Parentifizierung. Definition, Symptome, Ursachen, Folgen und Hilfe der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187061