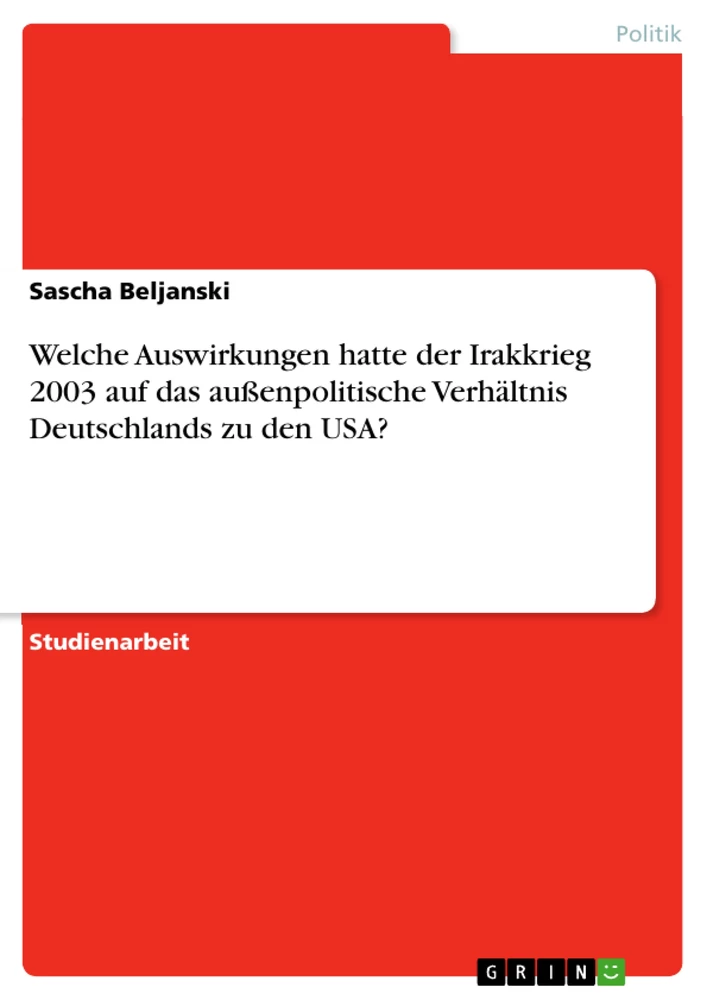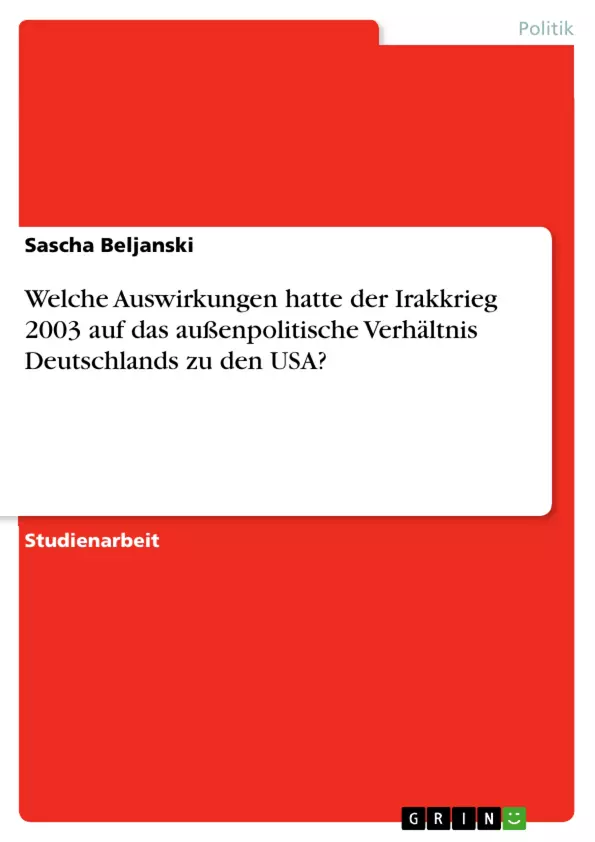Der durch die USA und die sogenannte „Koalition der Willigen“ 2003 geführte Angriffskrieg gegen den Irak bedeutete eine tiefe Zäsur in den transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Der US-amerikanische Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld, prägte in diesem Zusammenhang den Begriff vom „alten Europa“ und bezog sich dabei besonders auf die kriegsunwilligen Staaten Frankreich und Deutschland. Die loyalen Staaten, die sogenannte Koalition der Willigen, bezeichnete er als das vorbildliche „neue Europa“; welches treu zu Amerika und seinen Werten steht. Dazu zählte er u. a. die Staaten Mittel- und Osteuropas, Großbritannien, Spanien und Italien. Seit den Angriffen auf Washington und New York im September 2001 schuf die Bush-Administration eine u. a. präemptiv und unilateral ausgerichtete Militärstrategie, die zum Ziel hatte, die Ausbreitung des weltweiten Terrors, sowie Proliferation von Nuklearwaffen durch sogenannte Schurkenstaaten (Iran, Irak, Nordkorea) einzudämmen oder gänzlich zu verhindern. Dabei sollten die aus US-amerikanischer Sicht ungeliebten Vereinten Nationen außen vor bleiben. Die Vereinigten Staaten bestimmten von nun an – noch stärker als in der Vergangenheit - wer und was eine Gefahr für ihre Sicherheit darstellt.
Vor diesem Hintergrund ist das Verhältnis Deutschlands zu den USA zu bewerten. Bis zum Irakfeldzug war Deutschland bei Unstimmigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den europäischen Hauptstädten und Washington ein allseits respektierter Vermittler und Partner. Nach dem kategorischen „Nein“ von Bundeskanzler Schröder und seinem „deutschem Weg“ in der Frage eines militärischen Eingreifens im Irak, haben sich die bilateralen Beziehungen der transatlantischen Partner merklich abgekühlt. Vorab soll ein kurzer Abriß des Irakkonflikts, sowie die Rolle der Vereinten Nationen und die Resolutionen des Sicherheitsrats die neue nationale Sicherheitsstrategie (NSS) der Bush-Administration besser einordnen helfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die USA und der Krieg gegen Terror
- Die außenpolitische Situation der Bush-Administration
- Die sicherheitspolitische Ausgangslage vor dem Irakfeldzug
- Der Nahe Osten und die Erdölversorgung der USA
- USA und das „Alte Europa“
- Deutschland nach dem 11. September 2001
- Kanzler Schröder und seine Leitlinien zur Außenpolitik
- Die Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz
- Deutschlands Interessen im Nahen und Mittleren Osten
- Auswirkungen auf die außenpolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA
- Internationale militärische Zusammenarbeit
- Verhältnis auf diplomatischer Ebene und in den Vereinten Nationen
- Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Irakkriegs 2003 auf das außenpolitische Verhältnis Deutschlands zu den USA. Es wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen Positionen Deutschlands und der USA zum Krieg auf die transatlantische Zusammenarbeit auswirkten.
- Die außenpolitischen Strategien der Bush-Administration nach dem 11. September 2001
- Die deutsche Außenpolitik unter Kanzler Schröder und der "deutsche Weg"
- Die Auswirkungen des Irakkriegs auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA
- Der Einfluss des Konflikts auf die diplomatischen Beziehungen und die Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen
- Die Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Hintergrund des Irakkrieges und die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet die außenpolitische Situation der USA nach dem 11. September 2001, die Sicherheitsstrategie der Bush-Administration und die Rolle des Iraks in dieser Strategie. Kapitel 2 fokussiert auf die deutsche Außenpolitik nach den Anschlägen, die Position der Bundesregierung zum Irakkrieg und den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Kapitel 3 analysiert die konkreten Auswirkungen des Irakkrieges auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen in den Bereichen militärische Zusammenarbeit, Diplomatie und Wirtschaft.
Schlüsselwörter
Irakkrieg 2003, Deutsch-Amerikanische Beziehungen, Transatlantische Beziehungen, Außenpolitik, Bush-Administration, Kanzler Schröder, Militärische Zusammenarbeit, Diplomatie, Wirtschaft, "Altes Europa", "Krieg gegen den Terror", Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste der Irakkrieg 2003 die deutsch-amerikanischen Beziehungen?
Der Krieg führte zu einer tiefen Zäsur und einer merklichen Abkühlung der bilateralen Verhältnisse, da Deutschland unter Kanzler Schröder eine militärische Beteiligung ablehnte.
Was meinte Donald Rumsfeld mit dem Begriff „Altes Europa“?
Rumsfeld bezeichnete damit Staaten wie Frankreich und Deutschland, die den Irakkrieg ablehnten, im Gegensatz zum „neuen Europa“ (z. B. Osteuropa), das die USA unterstützte.
Warum lehnte die Bundesregierung den Irakkrieg ab?
Kanzler Schröder betonte einen „deutschen Weg“ und kritisierte das unilaterale Vorgehen der USA ohne eindeutiges UN-Mandat.
Welche Rolle spielten die Vereinten Nationen (UN) in diesem Konflikt?
Der Konflikt stellte die Autorität des UN-Sicherheitsrats infrage, da die „Koalition der Willigen“ ohne explizite Autorisierung durch eine neue Resolution angriff.
Hatte der Konflikt Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die diplomatischen Spannungen auch die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA belasteten.
- Quote paper
- Sascha Beljanski (Author), 2005, Welche Auswirkungen hatte der Irakkrieg 2003 auf das außenpolitische Verhältnis Deutschlands zu den USA?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187096