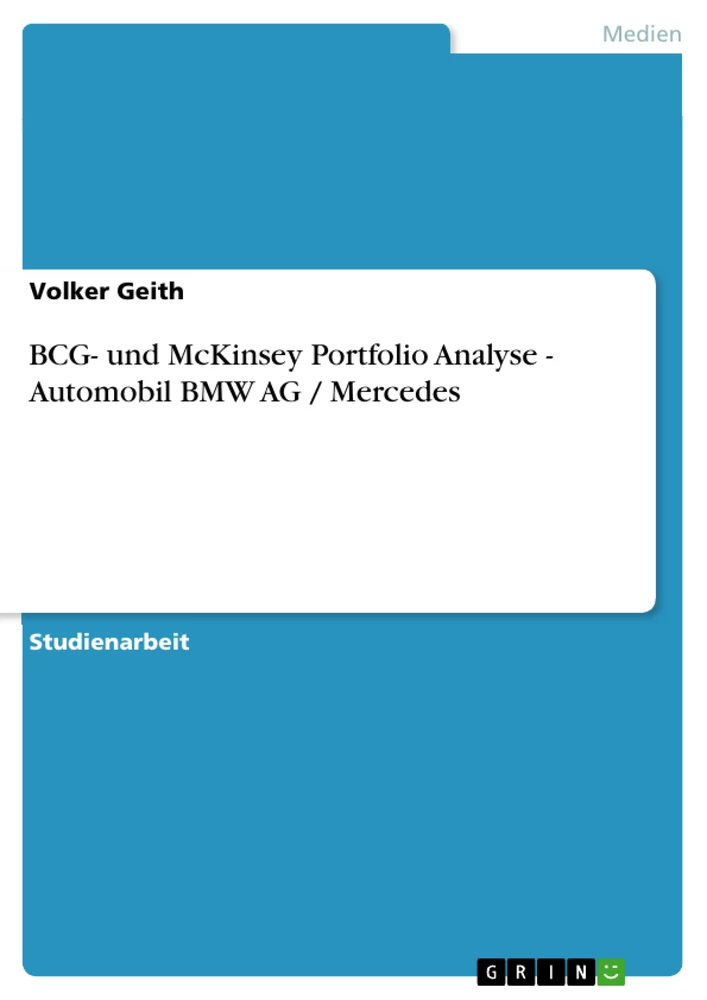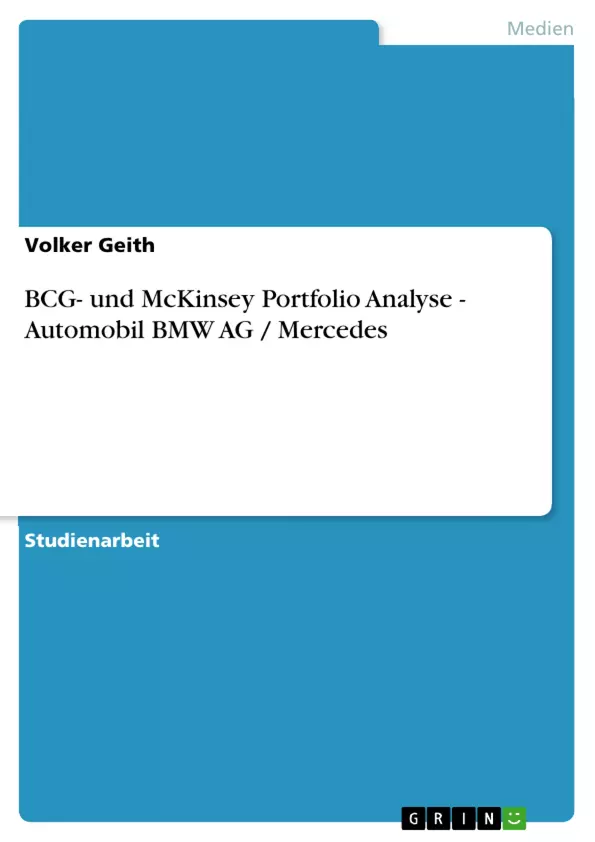Nachdem die theoretischen Grundlagen im ersten Teil behandelt wurden soll das
erlernte Wissen am Beispiel der BMW AG angewandt werden: Zuerst anhand des
BCG- Portfolios und anschließend anhand des McKinsey- Portfolios. Die Herausforderung
besteht darin, strategische Geschäftsfelder bzw. Geschäftseinheiten abzugrenzen,
passende Mitbewerber zu finden und fundierte Daten zu sammeln. Mit
Hilfe dieser Informationen wird eine Matrix erstellt, um Geschäftsfelder bzw. Geschäftseinheiten
einzuordnen, die daraufhin bewertet werden. Mit passenden, von
Normstrategien abgeleiteten Handlungsempfehlungen werden schließlich strategische
Entscheidungen für den nachhaltigen Erfolg der Unternehmung getroffen. Im
Beispiel der BMW AG wurde als strategisches Geschäftsfeld die PKW- Sparte
auf dem weltweiten Markt ausgewählt. Als Unterteilung in strategische Geschäftseinheiten
die einzelnen Marken: BMW, Rolls- Royce und Mini. Als
Hauptkonkurrent von BMW wird Mercedes- Benz, für Rolls-Royce Bentley und
für Mini der Smart betrachtet. Informationen zu Absatzmengen, Umsätze etc.
stammen aus den Geschäftsberichten 2010 der Konzerne. Daten über die Branchenentwicklung
wurden vom Verband der Automobilindustrie (VDA) herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung zur Portfolio – Analyse
- 1.1 Grundidee und Herkunft
- 1.2 Prämissen und Aufbau von Portfolio- Matrizen
- 2 Zwei Portfolio- Ansätze im Vergleich
- 2.1 BCG-Portfolio als Vorreiter
- 2.1.1 Aufbau und Vorrausetzungen
- 2.1.2 Darstellung des BCG- Portfolio
- 2.1.3 Normstrategien als Handlungsempfehlung
- 2.2 McKinsey Portfolio
- 2.2.1 Entstehung
- 2.2.2 Aufbau und Grundlagen
- 2.2.3 Normstrategien als Handlungsempfehlungen
- 2.3 Probleme der Portfolio- Analyse
- 2.3.1 Allgemeine Probleme
- 2.3.2 Spezielle Probleme des BCG- Portfolios
- 2.3.3 Spezielle Probleme des McKinsey Portfolios
- 2.3.4 Conclusio
- 3 McKinsey und BCG-Portfolio am Beispiel der BMW AG
- 3.1 Vorwort
- 3.2 BCG-Portfolio am Beispiel der BMW AG
- 3.2.1 Datenerhebung und Darstellung
- 3.2.2 Auswertung
- 3.3 McKinsey-Portfolio am Beispiel der BMW AG
- 3.3.1 Datenerhebung und Darstellung
- 3.3.2 Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit vergleicht die Portfolio-Ansätze der Boston Consulting Group (BCG) und McKinsey und wendet sie auf die BMW AG an. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Methoden aufzuzeigen und ihre Anwendbarkeit in der Praxis zu evaluieren.
- Vergleich der BCG- und McKinsey-Portfolio-Methoden
- Analyse der Vor- und Nachteile beider Ansätze
- Anwendung der Methoden auf die BMW AG
- Bewertung der Ergebnisse im Kontext der strategischen Unternehmensführung
- Identifizierung von Herausforderungen bei der Portfolio-Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Grundidee und den Ursprung der Portfolio-Analyse ein, erläutert die Prämissen und den Aufbau von Portfolio-Matrizen. Kapitel 2 vergleicht die BCG- und McKinsey-Methoden detailliert, inklusive ihrer jeweiligen Normstrategien und identifizierter Probleme. Kapitel 3 wendet beide Methoden auf die BMW AG an, dokumentiert die Datenerhebung und präsentiert eine Auswertung der Ergebnisse für beide Portfolio-Ansätze.
Schlüsselwörter
BCG-Portfolio, McKinsey-Portfolio, Portfolio-Analyse, strategische Unternehmensführung, BMW AG, Marktwachstum, relativer Marktanteil, Wettbewerbsstärke, Marktattraktivität, Normstrategien.
- Arbeit zitieren
- Volker Geith (Autor:in), 2011, BCG- und McKinsey Portfolio Analyse - Automobil BMW AG / Mercedes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187108