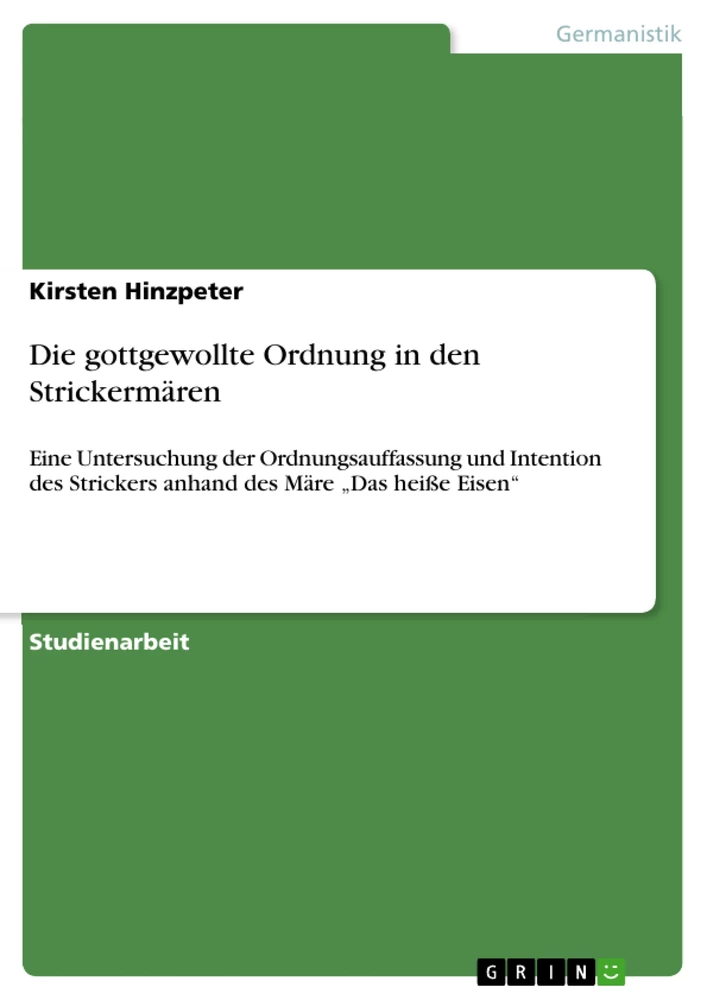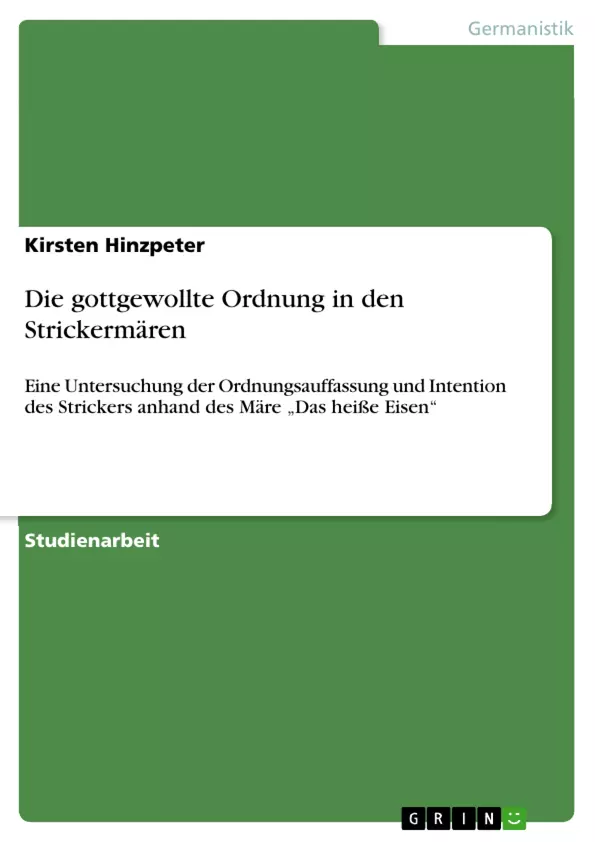In der folgenden Arbeit soll die gottgewollte Ordnung in den Stricker-Mären betrachtet werden. In einem Großteil der Forschungsliteratur wird die Propagierung einer gottgewollten Ordnung durch den Stricker diskutiert. Dieses geschieht durchaus auch kontrovers. Im ersten Teil der Arbeit soll also diese Diskussion in der Forschung zusammenfassend dargestellt werden. Hierbei wird zunächst untersucht werden, ob und wie sich die gottgewollte Ordnung gemäß der Forschung in den Stricker-Mären darstellt. An-schließend soll betrachtet werden, ob die Funktion der Stricker-Mären mit der Propagierung dieser Ordnung übereinstimmt und ob die Epimythia diese Funktion aufnehmen und unterstützen.
Im zweiten Teil wird die konkrete Literaturanalyse unter der Berücksichtigung der Zusammenfassung der Forschungsliteratur Gegenstand sein. Hierbei soll anhand der Struktur des ersten Teils überprüft werden, inwiefern sich die Ergebnisse der Forschung in dem Märe „Das heiße Eisen“ wiederfinden. Die abschließende Diskussion soll die Ergebnisse der Untersuchung in Bezug zur Literatur zusammenfassend darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Stricker-Mären in der Forschungsliteratur
- 2.1 Die Ordnungsdiskussion
- 2.2 Die Funktion der Stricker-Mären
- 2.3 Die Epimythia
- 3. Eine Untersuchung anhand des Märe „Das heiße Eisen“
- 3.1 Die gottgewollte Ordnung und der Ordnungsverstoß
- 3.1.1 Die Typisierung
- 3.1.2 Der Ordnungsverstoß
- 3.1.3 Die Restitution der Ordnung
- 3.2 Die Intention
- 3.3 Das Epimythion
- 4. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der gottgewollten Ordnung in den Mären des Strickers. Sie analysiert die Forschungsliteratur zu diesem Thema, um die verschiedenen Interpretationen und Kontroversen zu beleuchten. Im Mittelpunkt steht eine detaillierte Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“, um die Forschungsergebnisse zu überprüfen und die Intention des Autors zu ergründen.
- Die verschiedenen Interpretationen der gottgewollten Ordnung in den Stricker-Mären in der Forschungsliteratur.
- Die Funktion der Stricker-Mären und ihre Beziehung zur Propagierung einer göttlichen Ordnung.
- Die Rolle der Epimythia in der Vermittlung der Ordnungsidee.
- Die Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“ im Hinblick auf Ordnungsverstoß und -restitution.
- Die Intention des Autors und die Frage nach der tatsächlichen Bedeutung der Ordnungsidee.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand, die gottgewollte Ordnung in den Mären des Strickers, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die Forschungsfragen und kündigt den methodischen Ansatz an, welcher die Auseinandersetzung mit der bestehenden Forschung und die Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“ umfasst.
2. Die Stricker-Mären in der Forschungsliteratur: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Forschungsbeiträge zur Charakterisierung der Stricker-Mären zusammen. Es beleuchtet die Debatte um die Definition des Typus, die Kategorisierung der Mären und deren Funktion. Dabei werden unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Darstellung und Bedeutung der gottgewollten Ordnung in den Mären diskutiert. Die Kapitel unterteilen sich in die Diskussion um die Ordnung, die Funktion der Mären und die Epimythia. Die unterschiedlichen Interpretationen und Kontroversen der verschiedenen Autoren werden dargestellt und analysiert.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der gottgewollten Ordnung in den Mären des Strickers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der gottgewollten Ordnung in den Mären des Strickers. Sie analysiert die Forschungsliteratur zu diesem Thema und untersucht detailliert das Märchen „Das heiße Eisen“, um die Intention des Autors zu ergründen und verschiedene Interpretationen zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Interpretationen der gottgewollten Ordnung in der Forschungsliteratur, die Funktion der Stricker-Mären und ihre Beziehung zur Propagierung einer göttlichen Ordnung, die Rolle der Epimythia, die Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“ im Hinblick auf Ordnungsverstoß und -restitution sowie die Intention des Autors und die Bedeutung der Ordnungsidee.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Forschungsliteratur zu den Stricker-Mären (inkl. Unterkapiteln zur Ordnungsdiskussion, der Funktion der Mären und den Epimythia), einer detaillierten Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“ (inkl. Unterkapiteln zu gottgewollter Ordnung, Ordnungsverstoß, Restitution der Ordnung, Intention und Epimythion) und abschließenden Schlussbemerkungen.
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2 fasst die wichtigsten Forschungsbeiträge zu den Stricker-Mären zusammen. Es beleuchtet die Debatte um die Definition des Typus, die Kategorisierung der Mären und deren Funktion. Es werden unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Darstellung und Bedeutung der gottgewollten Ordnung diskutiert und die Interpretationen und Kontroversen verschiedener Autoren analysiert.
Was ist der Fokus der Analyse von „Das heiße Eisen“ (Kapitel 3)?
Die Analyse von „Das heiße Eisen“ konzentriert sich auf die Darstellung der gottgewollten Ordnung, den dargestellten Ordnungsverstoß, die Restitution der Ordnung und die Intention des Autors. Das Epimythion wird ebenfalls untersucht.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Auseinandersetzung mit der bestehenden Forschung und eine detaillierte Analyse des Märchens „Das heiße Eisen“.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht die verschiedenen Interpretationen der gottgewollten Ordnung, die Funktion der Mären in Bezug auf diese Ordnung, die Rolle der Epimythia und die Intention des Autors in Bezug auf die Bedeutung der Ordnungsidee im Märchen „Das heiße Eisen“.
- Quote paper
- Kirsten Hinzpeter (Author), 2010, Die gottgewollte Ordnung in den Strickermären, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187478