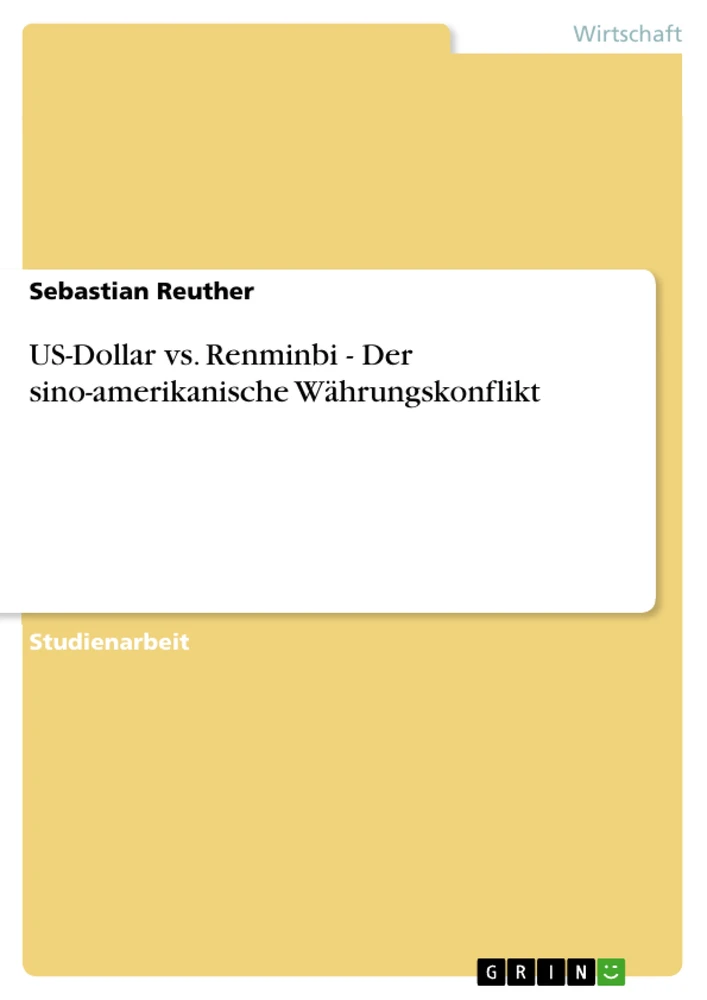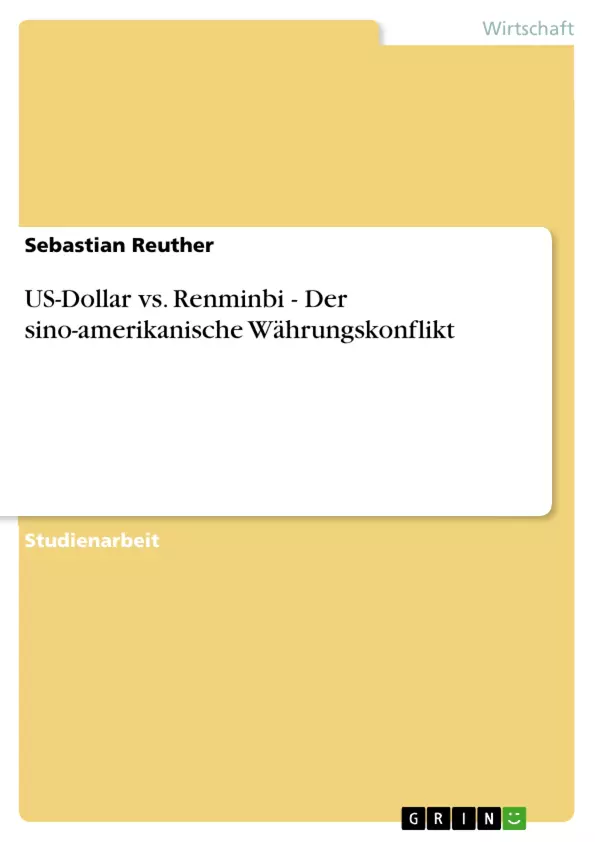Eine Sonderrolle aufgrund ihrer Bedeutung für den gesamten Welthandel durch ihr Handelsvolumen haben dabei die Außenwirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China. Die USA, als größte Volkswirtschaft der Welt, sind hierbei gegenüber China seit deren Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) 2001 ins Hintertreffen geraten. Kontinuierlich hohe Außenhandelsüberschüsse ermöglichen dabei Chinas Aufstieg. Im Jahr 2009 wurde die Bundesrepublik Deutschland von China als Exportweltmeister abgelöst. Und auch Japan, als bis dahin größter Kapitalexporteur, wurde von China auf den zweiten Platz verwiesen (vgl. Belke 2010: 2). China wäre es theoretisch möglich, die 15 größten Unternehmen des Nasdaq-Index zu kaufen (vgl. Handelsblatt-Online, 2011). Zwischen 1978 und 2003 wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner im Durchschnitt um 8,1 Prozent pro Jahr. 1978 stellte für China den Beginn eines umfassenden wirtschaftlichen Reformprozesses dar. Unter dem Motto Mao Zedongs - „Egal ob weiße oder schwarze Katze, Hauptsache sie fängt Mäuse.“ - öffnete sich China nach und nach dem Welthandel, mit überwältigenden Auswirkungen für die Bevölkerung (vgl. Schneider, 2007: 1). Während Anfang der 80er Jahre noch ungefähr 500 Millionen Chinesen in absoluter Armut lebten – definiert als verfügbares Einkommen von weniger als 1 US-Dollar pro Tag – waren es im Jahr 2000 nur noch rund 90 Millionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Wirtschaftstheoretische Ansätze
- Theorie der komparativen Kostenvorteile
- Währungssystem und Wechselkurs
- Zwischenfazit
- USA und China
- Chinesische Währungspolitik
- Bilaterales Dilemma
- Fazit und Ausblick
- Literatur- und Quellennachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem sino-amerikanischen Währungskonflikt und analysiert dessen Ursachen und Auswirkungen. Dabei stehen die globalen Ungleichgewichte im internationalen Außenhandel und die Rolle des US-Dollars und des Renminbi im Vordergrund. Die Arbeit analysiert die wirtschaftstheoretischen Grundlagen des Konflikts und beleuchtet die politische Situation in den USA und China.
- Globalisierung und Handelsungleichgewichte
- Der US-Dollar als Weltreservewährung
- Chinas Währungspolitik und der Aufstieg des Renminbi
- Bilaterale Spannungen und der befürchtete Handelskrieg
- Mögliche Folgen für die Weltwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik des sino-amerikanischen Währungskonflikts und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise heraus. Das erste Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Währungskonflikts im Kontext der internationalen Handelsordnung. Hierzu werden die Theorie der komparativen Kostenvorteile und die Rolle von Währungssystemen und Wechselkursen diskutiert. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die USA und China, wobei die chinesische Währungspolitik und das bilaterale Dilemma im Zentrum der Betrachtung stehen.
Schlüsselwörter
Sino-amerikanischer Währungskonflikt, US-Dollar, Renminbi, Weltreservewährung, Handelsungleichgewichte, globale Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, Theorie der komparativen Kostenvorteile, Währungssystem, Wechselkurs, chinesische Währungspolitik, bilaterales Dilemma, Handelskrieg, protektionistische Maßnahmen, Weltwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der sino-amerikanische Währungskonflikt?
Es ist der Streit zwischen den USA und China über Wechselkurse, Handelsungleichgewichte und die Rolle des US-Dollars gegenüber dem Renminbi.
Warum wird China als „Exportweltmeister“ bezeichnet?
Im Jahr 2009 löste China Deutschland als größten Exporteur der Welt ab, was zu massiven Handelsüberschüssen gegenüber den USA führte.
Was ist die Theorie der komparativen Kostenvorteile?
Ein wirtschaftstheoretischer Ansatz, der erklärt, warum internationaler Handel für alle Beteiligten vorteilhaft ist, wenn sie sich auf ihre effizientesten Produkte spezialisieren.
Welche Kritik üben die USA an Chinas Währungspolitik?
Die USA werfen China vor, den Renminbi künstlich unterbewertet zu halten, um chinesische Exporte billiger zu machen und US-Produkte zu benachteiligen.
Wie hat sich die Armut in China durch die Öffnung verändert?
Durch den Reformprozess sank die Zahl der Menschen in absoluter Armut von rund 500 Millionen Anfang der 80er Jahre auf etwa 90 Millionen im Jahr 2000.
- Quote paper
- Sebastian Reuther (Author), 2010, US-Dollar vs. Renminbi - Der sino-amerikanische Währungskonflikt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187817