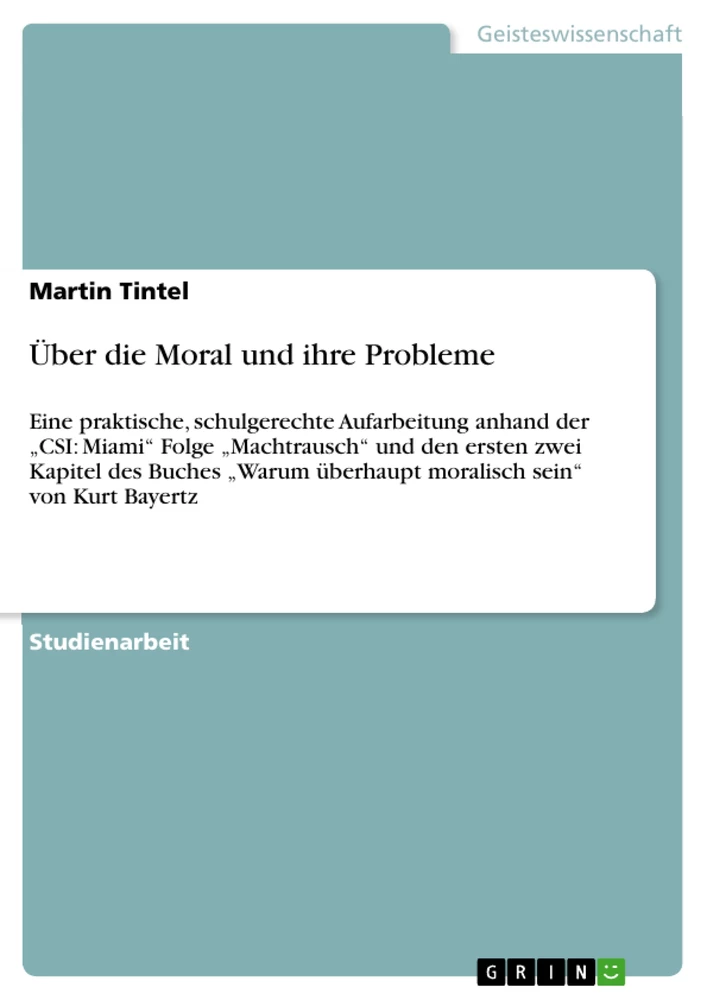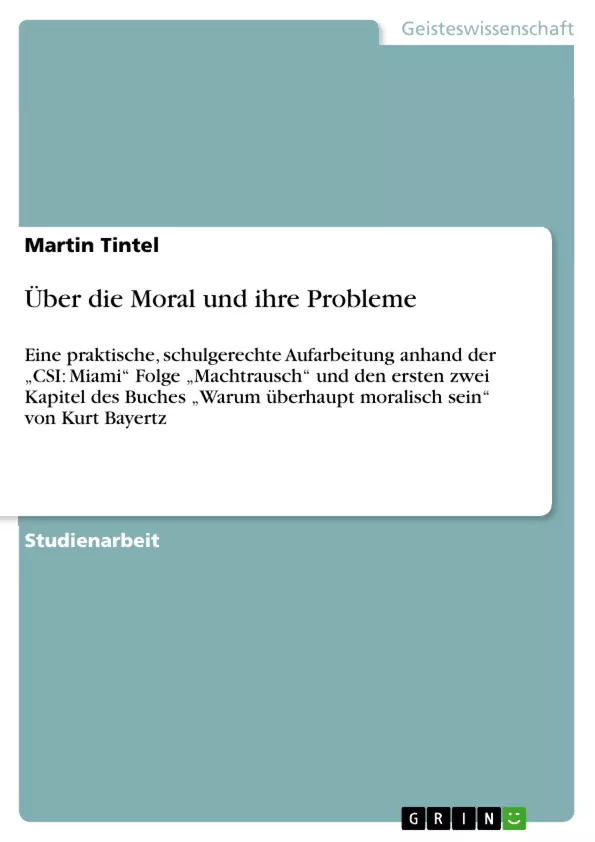Damals wie heute ist das Thema „Moral“ ein wichtiges und aktuelles. Kaum eine Fernsehserie spricht das Thema nicht direkt, oder zumindest indirekt an und zeigt deren Probleme auf. Deshalb werde ich in dieser Seminararbeit eine aktuelle TV Serien heranziehen und anhand dieser das erste Kapitel des Buches „Warum überhaupt moralisch sein“ von Kurt Bayertz erklären.
Die Idee dieser Seminararbeit ist es, einen schul- und schülergerechten, einfachen sowie praktischen Einstieg in die Thematik „Moral“ zu geben. Der Inhalt dieser Seminararbeit könnte verwendet wer-den, um den SchülerInnen einen Denkanstoß bezüglich Moral und moralischem Handeln zu geben und anschließend das Thema Moral im Unterricht durchzunehmen.
Ich wählte bewusst die Fernsehserie „CSI: Miami“ aus, da sie eine sehr neue Serie ist, sich stark an Jugendliche richtet, von vielen SchülerInnen angeschaut wird, ihnen daher bekannt ist und in deren Lebenswelt liegt. Ein Nebeneffekt soll sein, dass der eigene TV Konsum besser reflektiert und aktiver gestaltet wird. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass es innerhalb einer TV- Serie zu großen Verschiebungen und Veränderungen kommen kann, auch punkto Moral! Am Anfang der Serie „CSI: Miami“ wurde oft eine „schwarz weiß Moral“ mit erhobenen Zeigefinger präsentiert, bei der klar war, was moralisch korrekt ist und was nicht. In nachfolgenden Staffeln änderte sich dies deutlich und es häuften sich jene „Fälle“, bei denen Menschen rechtlich bedenkenlos handelten oder ihnen strafrechtlich nichts passierte, ihre Handlungen aber unmoralisch waren. Ebenso wurden vermehrt Folgen produziert, bei denen schwer zu sagen ist, wie moralisch richtiges Handeln aussieht. In den neueren Staffeln der Serie werden auch oft und dabei deutlich die anderen Probleme und Fragen, die die Moral mit sich bringt, aufgezeigt und in die Geschichte eingebaut behandelt.
Die Folge 9 der Staffel 7 (7.09) mit dem Titel „Machtrausch“ ist meiner Meinung nach besonders inte-ressant und gut für die Seminararbeit geeignet, da in dieser „CSI: Miami“ Folge das moralisch richtige Agieren im Vordergrund steht, verschiedene Wertesysteme aufeinanderprallen und somit das Buch von Kurt Bayertz und sein Inhalt gut zu veranschaulichbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moral
- Die Aufarbeitung für den Unterricht
- Aufbau der Seminararbeit
- Was heißt hier eigentlich „Moral“?
- Vorwort
- Moral im weiteren Sinne
- Moral im engeren Sinne
- Die Moral der Antike und im Vergleich zum Christentum
- Die Moral der Moderne
- Metaphysische und religiöse Entwurzelung
- Das motivationale Defizit
- Der Fall Gauguin
- Die „CSI: Miami“ Folge „Machtrausch“
- Die wichtigsten Charaktere der Folge
- Eine kurze Zusammenfassung
- Die „CSI: Miami“ Folge „Machtrausch“ im Detail
- Zwei Schwierigkeiten mit der Moral
- Vorwort
- Müllers Problem
- Meiers Problem
- Vergleich Müller und Meier
- Willensschwäche und Fanatismus
- Schlusswort
- Moral als Orientierungssystem
- Die Unterscheidung zwischen Moral im weiteren und engeren Sinne
- Die Herausforderungen der modernen Moral
- Die Problematik von moralischen Dilemmata
- Der Einfluss von Fanatismus auf moralisches Handeln
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den Kontext der Seminararbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas „Moral“ im heutigen Alltag. Es wird die Bedeutung des Themas für die Arbeit mit SchülerInnen im Unterricht hervorgehoben. Außerdem wird der Bezug zur Fernsehserie „CSI: Miami“ und der gewählten Folge „Machtrausch“ hergestellt.
- Was heißt hier eigentlich „Moral“?: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Begriffs „Moral“ und differenziert zwischen „Moral im weiteren Sinne“ und „Moral im engeren Sinne“. Es werden historische Aspekte der Moralentwicklung, insbesondere die griechische und die christliche Ethik, betrachtet.
- Die „CSI: Miami“ Folge „Machtrausch“: In diesem Kapitel wird die Handlung der Folge „Machtrausch“ zusammengefasst und die wichtigsten Charaktere vorgestellt. Die Handlung wird im Detail analysiert und die jeweiligen moralischen Aspekte der Entscheidungen der Charaktere werden beleuchtet.
- Zwei Schwierigkeiten mit der Moral: Dieses Kapitel behandelt zwei zentrale Probleme der Moral, die in der „CSI: Miami“ Folge deutlich werden. Zum einen wird das Problem von moralischen Dilemmata anhand des „Müllers Problems“ erläutert. Zum anderen wird das Dilemma, das moralisch Richtige zu wissen, aber nicht zu tun, am „Meiers Problem“ verdeutlicht. Die Folge dient als Beispiel für die beiden Probleme und verdeutlicht, wie sie sich in der Praxis darstellen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Über die Moral und ihre Probleme“ analysiert das Konzept der Moral aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit zielt darauf ab, einen einfachen und praxisorientierten Einstieg in die Thematik „Moral“ zu bieten. Dabei wird die Fernsehserie „CSI: Miami“ als Beispiel herangezogen, um die Problematik der Moral und moralisches Handeln im Alltag aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Moral, Ethik, moralisches Handeln, moralisches Dilemma, Fanatismus und Hypermoral. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas „Moral“ im Kontext der modernen Gesellschaft und greift die Problematik der moralischen Dilemmata auf, die im Alltag und auch im Kontext der Fernsehserie „CSI: Miami“ auftreten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Moral ein wichtiges Thema im Schulunterricht?
Moralisches Handeln und ethische Dilemmata prägen den Alltag von Jugendlichen. Die Arbeit bietet einen praxisnahen Einstieg, um Schüler zum Nachdenken über Werte anzuregen.
Wie kann "CSI: Miami" zur Vermittlung von Moral genutzt werden?
Die Serie zeigt oft Fälle, in denen rechtlich korrektes, aber moralisch fragwürdiges Handeln aufeinandertreffen. Dies dient als anschauliches Beispiel für komplexe ethische Fragen.
Was ist der Unterschied zwischen Moral im weiteren und engeren Sinne?
Basierend auf Kurt Bayertz unterscheidet die Arbeit zwischen allgemeinen Sitten (weiterer Sinn) und strikten ethischen Verpflichtungen gegenüber anderen (engerer Sinn).
Was sind "Müllers Problem" und "Meiers Problem"?
Diese Begriffe beschreiben Schwierigkeiten der Moral: Das Wissen um das moralisch Richtige bei gleichzeitiger Unfähigkeit, danach zu handeln (Willensschwäche), oder der Konflikt zwischen verschiedenen Werten.
Wie hat sich die Darstellung von Moral in TV-Serien gewandelt?
Frühere Folgen zeigten oft eine "Schwarz-Weiß-Moral". Neuere Staffeln präsentieren komplexere Fälle, in denen es kein klares Richtig oder Falsch gibt, was die Realität der modernen Gesellschaft widerspiegelt.
- Quote paper
- Magister Bachelor Martin Tintel (Author), 2011, Über die Moral und ihre Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187928