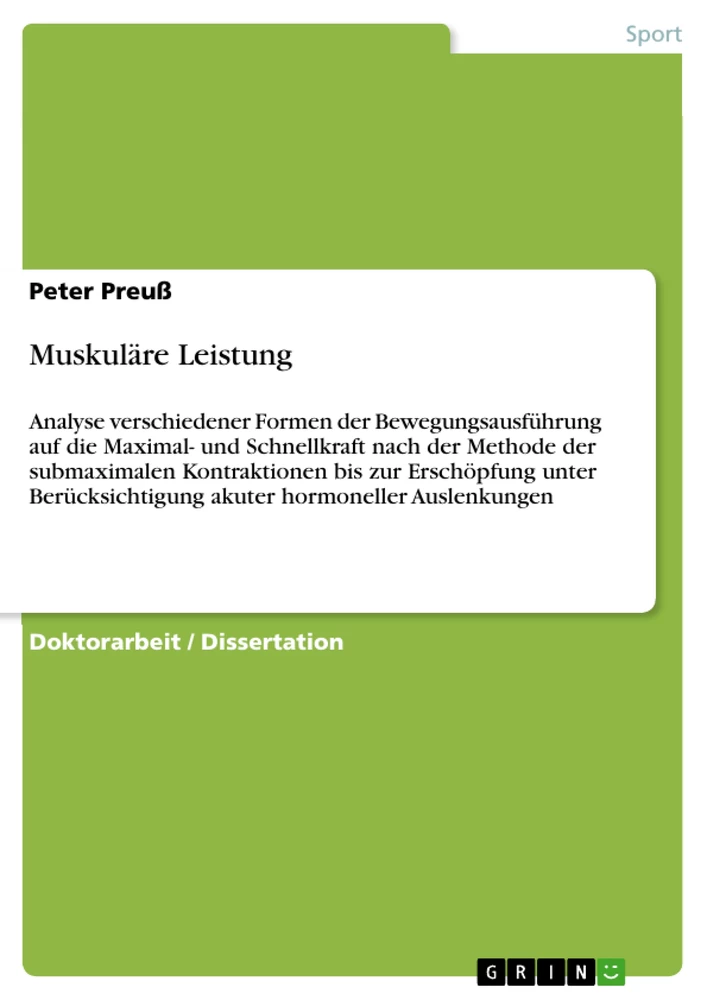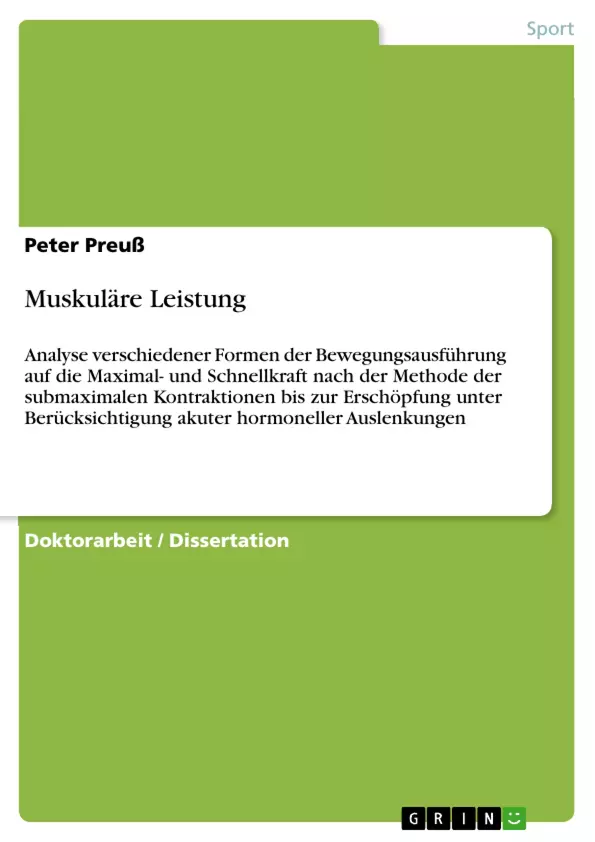Die vorliegende Arbeit betrachtet die Auswirkungen von drei unterschiedlichen Bewegungsausführungen im Hypertrophie-orientierten Krafttraining über einen Zeitraum von 6 Wochen:
1. intendiert-explosives Mehrsatz-Training (MSTex), 3 Sätze à 6-9 Wiederholungen bei 80% 1 RM bei einer fraktionellen Verteilung der Kontraktionsarten von intendiert-explosiv konzentrisch, 0 sec. isometrisch und 1 sec. exzentrisch,
2. kontrolliert-zügiges Mehrsatz-Training (MST), 3 Sätze à 6-9 Wiederholungen bei 80% 1 RM bei einer fraktionellen Verteilung der Kontraktionsarten von 1 sec. konzentrisch, 0.5 sec. isometrisch und 1 sec. exzentrisch,
3. betont langsames Einsatz-Training (EST), 1 Satz à 6-9 Wiederholungen bei 65% 1 RM bei einer fraktionellen Verteilung der Kontraktionsarten von 4 sec. konzentrisch, 0.5 sec. isometrisch und 4 sec. exzentrisch.
Ziel der Studie war es, diejenige sportartbegleitende Krafttrainingsform im Muskelaufbautraining zu identifizieren, die zu einer Erhöhung ausgewählter Variablen der muskulären Leistung (Beinpresse, Brustpresse) unter Berücksichtigung von Maximal- (Beinpresse, Brustpresse, Beinstrecken, Bizeps Curl) und Sprungkraftveränderungen (Squat Jump) sowie akuter hormoneller
Auslenkungen (human growth hormone, insulin-like growth factor 1, Testosteron, Cortisol) führt.
Betrachtet man die dargestellten Ergebnisse im Gesamtkontext, so lassen sich aus der vorliegenden Arbeit sieben Kernaussagen ableiten:
1. Die EST-, MST- und MSTex-Belastungsprotokolle führen zu gleichwertigen Verbesserungender isometrischen und dynamischen Maximalkraft.
2. Die MST-Belastungsprotokolle weisen eine höhere praktische Bedeutsamkeit zur Verbesserung der dynamischen Maximalkraft auf.
3. Die Ergebnisse der Variablen der muskulären Leistung bestätigen die Theorie der geschwindigkeitsspezifischen Anpassungen im Krafttraining.
4. Ein MSTex-Belastungsprotokoll ist geeignet, um die Kraft- und Leistungskomponente der muskulären Leistung zu entwickeln.
5. Für die Verbesserung der Zeitkomponenten ist ein MST-Belastungsprotokoll die Trainingsform der Wahl.
6. Ein EST führt zu signifikant höheren akuten hGH-Auslenkungen nach dem Training.
7. Die MST-Belastungsprotokolle erhöhen die trainingsinduzierte, muskuläre stimulierte IGF-1 Ausschüttung nach einem 6-wöchigen Training.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorbetrachtungen
- Interventionsstudien zum Untersuchungsgegenstand
- Intendiert-explosive Kontraktionen
- Unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten
- Hormonelle Reaktionen
- Fazit der Interventionsstudien
- Der Begriff der Kraft
- Schnellkraft und muskuläre Leistung
- Trainingsmethoden der Schnellkraft
- Biologische Basis für Kraft und muskuläre Leistung
- Neuronale Faktoren
- Neuronale Adaptationen
- Muskuläre Faktoren
- Muskuläre Adaptationen
- Determinanten der Skelettmuskeladaptation
- Spannungshöhe, Spannungsdauer und lokale Erschöpfung
- Übungsausführung und Bewegungsumfang
- Satz- und Wiederholungszahl, Satz- und Wiederholungspause
- Kontraktionsform
- Trainingsfrequenz, Periodisierung und Variation
- Muskuläre Leistung und ihre Operationalisierung
- Startkraft
- Exkurs muskuläre Vorspannung
- Explosivkraft
- Weitere Kennziffern der Schnellkraft
- Leistung
- Variablen der muskulären Leistung
- Explizite Fragestellung und Herleitung der Hypothesen
- Hypothesen zu Fragestellung 1
- Hypothesen zu Fragestellung 2
- Hypothesen zu Fragestellung 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Dissertation analysiert die Auswirkungen von drei unterschiedlichen Bewegungs�ausführungen im Hypertrophie-orientierten Krafttraining nach der Methode der submaximalen Kon�traktionen bis zur Erschöpfung auf ausgewählte Variablen der muskulären Leistung. Ziel der Studie ist es, diejenige sportartbegleitende Krafttrainingsform im Muskelaufbautraining zu identifizieren, die zu einer Erhöhung der muskulären Leistung führt, unter Berücksichtigung von Maximalkraft- und Sprung�kraftveränderungen sowie akuter hormoneller Auslenkungen. Die Studie basiert auf der Observa�tion von Behm und Sale (1993a), dass der schnellkraftfördernde Effekt einer Krafttrainings�form in erster Linie von der Absicht, eine schnelle Bewegung auszuführen, abhängt.
- Einfluss der Bewegungsausführung im Hypertrophie-orientierten Krafttraining auf die muskuläre Leistung
- Veränderungen der Maximalkraft und Sprungkraft im Vergleich der drei Belastungsprotokolle
- Akute hormonelle Reaktionen auf das Training unter Berücksichtigung der verschiedenen Bewegungsausführungen
- Überprüfung der Geschwindigkeitsspezifität im auxotonischen Krafttraining
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einleitung in das Thema „Muskuläre Leistung im Krafttraining“ und Darstellung der wissenschaftlichen Relevanz sowie der Forschungsfrage
- Theoretische Vorbetrachtungen: Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu den Auswirkungen intendiert-explosiver Kontraktionen, unterschiedlicher Bewegungsgeschwindigkeiten und hormoneller Reaktionen im Krafttraining sowie Darstellung der biologischen Grundlagen der Kraft und Schnellkraft.
- Methodik: Beschreibung des Studiendesigns, der Probanden, des Trainings- und Testprogramms, der Testbedingungen, der Messmethoden sowie der statistischen Verfahren.
- Darstellung und Diskussion der Ergebnisse: Analyse und Diskussion der erhobenen Daten zur Test-Retest-Reliabilität der Schnellkraftvariablen, zur Überprüfung der Trainingsvorgaben sowie zur Effektivität der drei Belastungsprotokolle im Hinblick auf die Maximalkraft, Sprungkraft und muskuläre Leistung und den Einfluss auf die akuten hormonellen Reaktionen.
Schlüsselwörter
Muskuläre Leistung, Krafttraining, Hypertrophie, intendiert-explosive Bewegungsausführung, Geschwindigkeitsspezifität, hormonelle Auslenkungen, Testosteron, Cortisol, hGH, IGF-1.
Häufig gestellte Fragen
Welche Trainingsformen wurden in der Krafttrainingsstudie untersucht?
Es wurden drei Protokolle verglichen: intendiert-explosives Mehrsatz-Training (MSTex), kontrolliert-zügiges Mehrsatz-Training (MST) und betont langsames Einsatz-Training (EST).
Welches Training ist am besten für die Maximalkraft geeignet?
Die Studie zeigt, dass alle drei Protokolle (EST, MST, MSTex) zu gleichwertigen Verbesserungen der isometrischen und dynamischen Maximalkraft führen.
Wie wirkt sich langsames Training (EST) auf die Hormone aus?
Das betont langsame Einsatz-Training (EST) führt zu signifikant höheren akuten Auslenkungen des Wachstumshormons (hGH) direkt nach dem Training.
Was bedeutet „Geschwindigkeitsspezifität“ im Krafttraining?
Die Theorie besagt, dass die Anpassungen der muskulären Leistung primär von der Bewegungsgeschwindigkeit (bzw. der Absicht, schnell zu kontrahieren) abhängen.
Welches Protokoll fördert die muskuläre Leistung am effektivsten?
Das intendiert-explosive Training (MSTex) ist besonders geeignet, um sowohl die Kraft- als auch die Leistungskomponente der muskulären Leistung zu entwickeln.
Was wurde hinsichtlich des IGF-1 Ausstoßes festgestellt?
Die Mehrsatz-Trainingsprotokolle (MST) erhöhen die trainingsinduzierte, muskulär stimulierte IGF-1 Ausschüttung nach einer 6-wöchigen Trainingsphase.
- Interventionsstudien zum Untersuchungsgegenstand
- Citation du texte
- Dipl.-Sportlehrer Peter Preuß (Auteur), 2010, Muskuläre Leistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188129