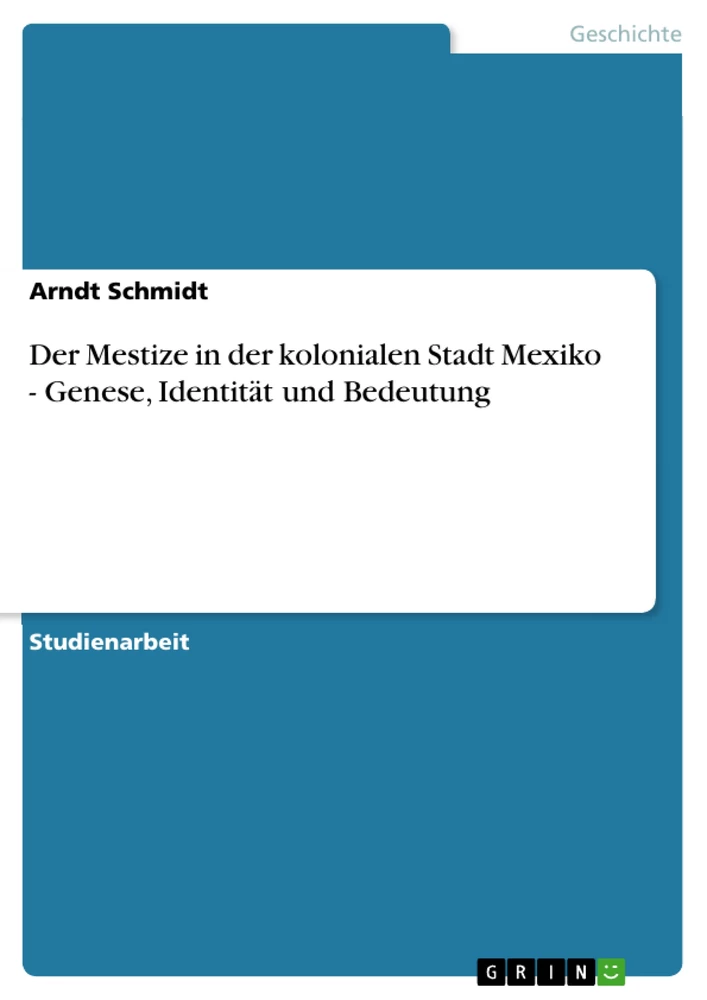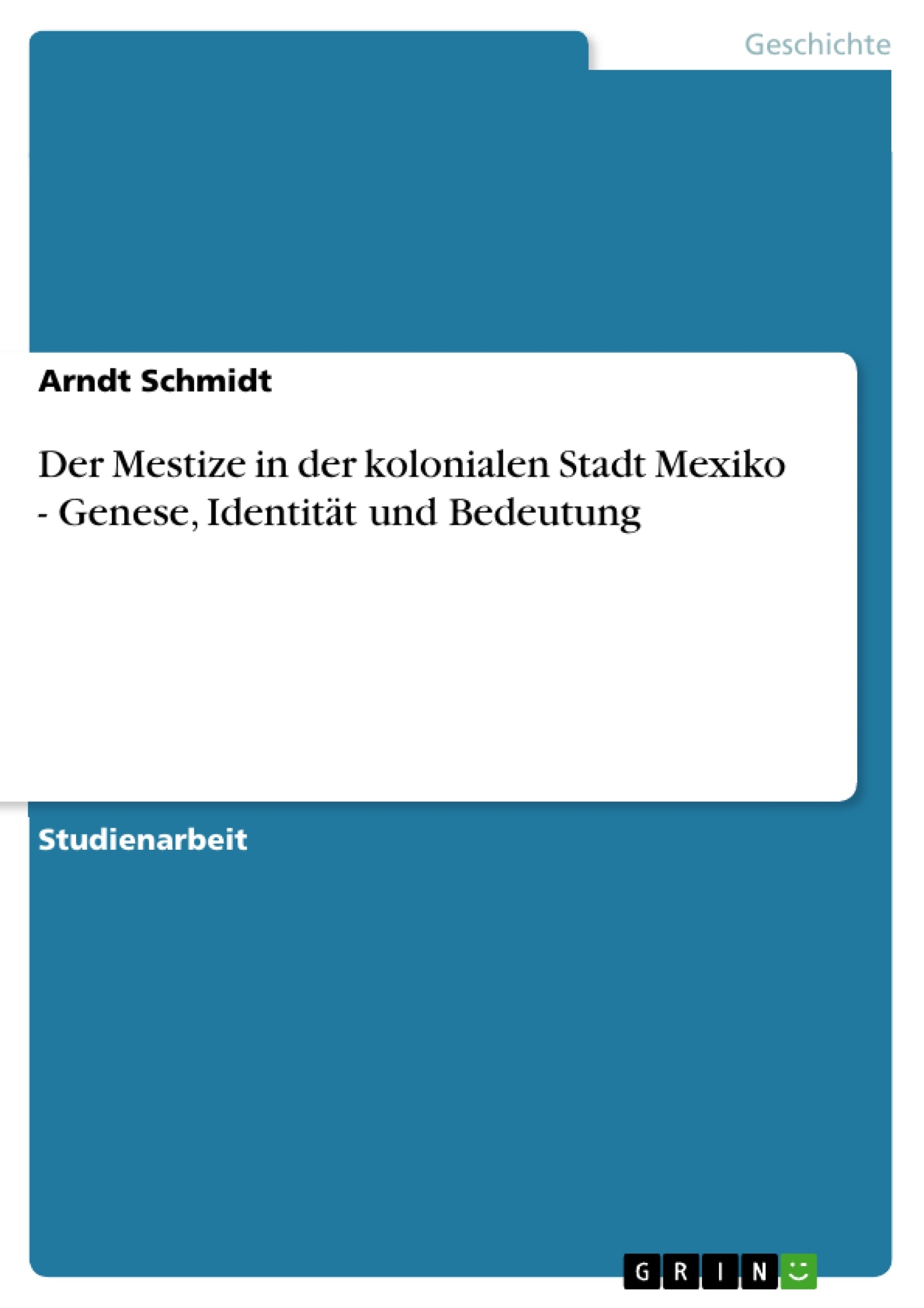Das Standardwerk zu dem Thema „Race Mixture“ von Magnus Mörner beginnt mit dem Hinweis auf eine Vision des mexikanischen Philosophen José Vasconcelos. Dieser betrachtete Lateinamerika als „fatherland and achievement of mestizos“. Seine Auslegung der „mestizaje“, dem Prozess der ethnischen Vermischung in Lateinamerika, zeugt von viel Enthusiasmus und idealistischem Pathos. Allerdings zeugt sie auch von einem gewandelten Bild des Mestizen. Von einem der Gesellschaft entfremdeten Außenseiter wurde er zu einem Symbol nationaler Identität, wie Eric Wolf es darstellt.
Dabei ist anzumerken, dass gerade bei der Einordnung von Menschen in Kategorien Vorstellung und Realität sehr flexible Größen sind, die bei Weitem nicht immer deckungsgleich sein müssen. Eine übergeordnete Frage dieser Arbeit wird daher sein, was sich über eine gemeinsame Identität von Mestizen aussagen lässt. Denn geprägt wurde die Kategorie des „mestizo“ von den Kolonisatoren, nicht von den Ange-hörigen dieser Gruppe.Dieser Vorgang wirkt nicht nur erstaunlich, er ist auch zentra-ler Bestandteil des Mythos vom „melting pot“ Lateinamerika. Um diesen Mythos hinterfragen zu können, ist es notwendig zu verstehen, was im historischen Zusammen-hang hinter dem Konzept des Mestizen steht.
Zuvor gilt es, die Entwicklung der ethnischen Vermischung zu skizzieren und ihre Ursachen aufzuzeigen. Dieser Prozess soll dann in Beziehung zur spanischen Herr-schaftsideologie gesetzt werden. Wie reagierten die Kolonisatoren auf diesen Wider-spruch zu ihrem Prinzip der „limpieza de sangre“, der „Reinheit des Blutes“? Veränderte sich ihr Weltbild? Eine weitere Rolle werden die Fragen spielen, mit welcher Sicherheit Personen überhaupt als Mestizen eingestuft werden konnten und wie stark für Mestizen Kastenzugehörigkeit und sozioökonomischer Status festgelegt wa-ren.
Viele Aussagen über Mestizen ließen sich auf andere Mischgruppen übertragen oder zumindest beziehen. Der begrenzte Rahmen dieser Arbeit legt es aber nahe, sich thematisch auf die Mestizen sowie räumlich auf ein Fallbeispiel zu konzentrieren. Die Stadt Mexiko eignet sich dazu am besten, da sie wirtschaftliches und kulturelles
Zentrum Neu-Spaniens war. 1574 lebte etwa ein Drittel der (neu-)spanischen Bevöl-kerung in der Hauptstadt der Kolonie
und wie zu zeigen sein wird, war die ethnische Vermischung hier besonders ausgeprägt. Man darf annehmen, dass Mexiko-Stadt richtungsweisend für den Rest der Kolonie war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Genese
- Die erste Generation
- Ausformung einer neuen Gruppe
- „Sistema de castas“: Die Perspektive der Spanier
- Die Realität des Kastensystems
- Bestimmung von Kastenzugehörigkeit und „passing“
- Sozioökonomischer Status
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Bedeutung des Mestizen in der kolonialen Stadt Mexiko. Sie untersucht den Prozess der ethnischen Vermischung in Lateinamerika und hinterfragt den Mythos vom „melting pot“. Die Arbeit beleuchtet die Konstruktion der Mestizen-Kategorie durch die spanischen Kolonisatoren und die Herausforderungen, die mit der Bestimmung von Kastenzugehörigkeit und sozioökonomischem Status verbunden waren.
- Die Genese der Mestizen-Gruppe
- Die Rolle des „Sistema de castas“
- Die Realität des Kastensystems
- Die Frage der Identität und Bedeutung von Mestizen
- Die Auswirkungen der ethnischen Vermischung auf die spanische Herrschaftsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These auf, dass der Mestize im historischen Zusammenhang als Symbol nationaler Identität in Lateinamerika konstruiert wurde. Die Arbeit will den Mythos vom „melting pot“ hinterfragen und die Entwicklung der ethnischen Vermischung sowie die Ursachen und Folgen für die spanische Herrschaftsordnung aufzeigen.
Genese
Die erste Generation
Die erste Generation von Kreolen, die in Lateinamerika geboren wurden, bestand größtenteils aus Mestizen. Die geringe Anzahl an spanischen Frauen führte dazu, dass sich spanische Männer mit indigenen Frauen paarten. Die ethnisch gemischten Beziehungen wurden jedoch von den Spaniern als unehrenhaft empfunden, und die Zahl offizieller Ehen zwischen Spaniern und Indigenen war gering.
Ausformung einer neuen Gruppe
Im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts entwickelte sich die ursprünglich marginale Mestizen-Gruppe zu einer sichtbaren Gruppe in der Gesellschaft. Die Entstehung einer gemischten Unterschicht, die durch Promiskuität und die Organisation von Arbeit in der Stadt Mexiko gekennzeichnet war, trug zu dieser Entwicklung bei.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen ethnische Vermischung, Mestizaje, „Sistema de castas“, Identität, Kolonialisierung, Stadtgeschichte, Mexiko-Stadt, Spanische Herrschaftsordnung, „limpieza de sangre“, Sozioökonomischer Status, Kastenzugehörigkeit, „passing“.
- Arbeit zitieren
- Arndt Schmidt (Autor:in), 2005, Der Mestize in der kolonialen Stadt Mexiko - Genese, Identität und Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188868