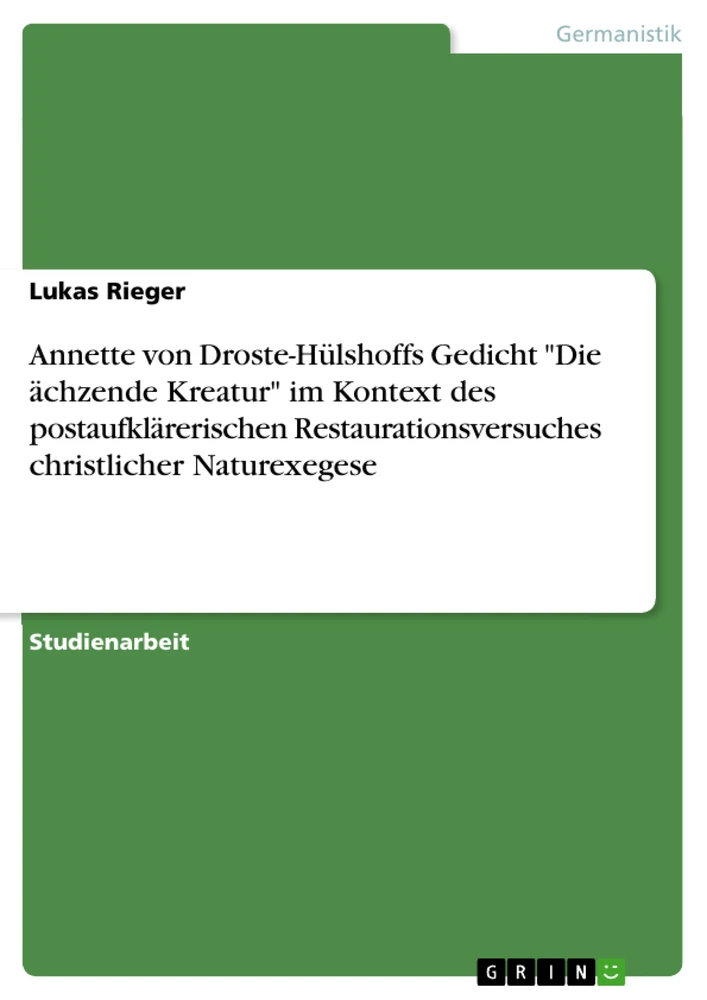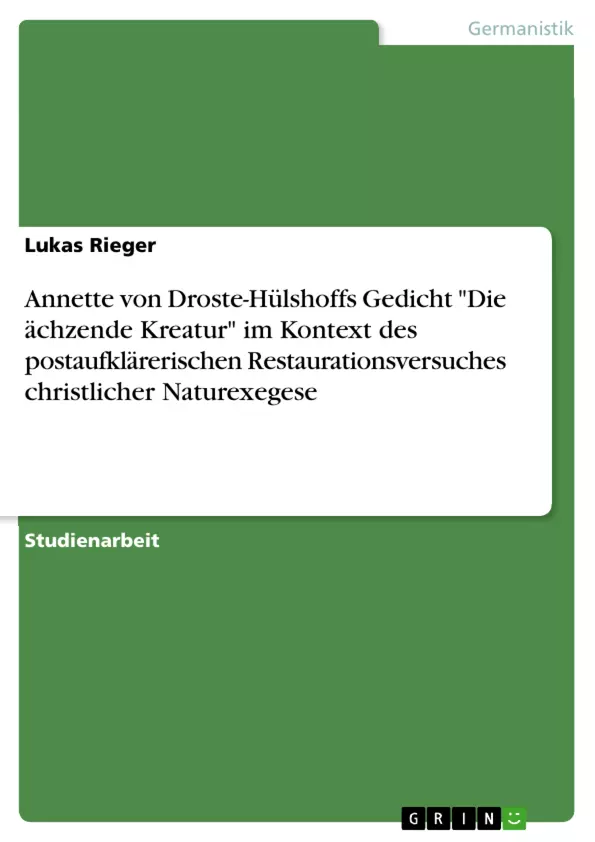Die Arbeit verfolgt ausführlich die Entstehungsgeschichte Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht "Die ächzende Kreatur"/"<An einem Tag, wo feucht der Wind>" nach. Sie leistet dabei eine knappe Einordnung in zeitgenössische Diskurse um den Natur-Begriff. In diesem Zusammenhang stellt sie auch die Anregung zum Gedicht durch den Freund und Förderer Schlüter, insbesondere dessen in die genannten Diskurse eingeordnete Motivation zu dieser Anregung dar. Zu diesem Zweck analysiert die Arbeit auch den exegetischen Gehalt des im Gedicht verarbeiteten Bibelpassus. Im Abgleich zu diesen Hintergründen schließlich interpretiert sie ausführlich das Gedicht und verfolgt dabei insbesondere die Frage, inwieweit sich die Droste bei der Abfassung des Gedichtes von der schlüterschen Intention entfernt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Deutungsthesen
- II. Entstehungsgeschichte
- III. Einordnung in zeitgenössische Diskurse
- 1. Die Bedrohung des theistischen Weltbildes durch den Deismus
- 2. Die Bedrohung des theistischen Weltbildes durch Pantheismus und Naturalismus
- 3. Die Emanzipation des Natur-Begriffes: kosmologische und anthropologische Konsequenzen
- IV. Zum Quelltext
- 1. Textanalyse unter Berücksichtigung zeitgenössischer Exegese
- a) Vers 18: Themensetzung und Tenor
- b) Vers 19: die problematische Denotation des „,creatura\"-Begriffes
- c) Verse 20 & 21: Kulminationspunkt von Offenbarungs- und Problemgehalt
- d) Vers 22: Leiden als notwendiger Bestandteil der Erlösung
- 2. Schlüters Textauffassung und sein Arbeitsauftrag an die Droste
- 1. Textanalyse unter Berücksichtigung zeitgenössischer Exegese
- V. Gedichtanalyse
- 1. Formales
- 2. Inhaltliches
- a) Strophe 1: Psychische und somatische Ausgangslage
- b) Strophe 2: Meditative Melancholie
- c) Strophe 3: Melancholisch geläuterte Naturbegegnung
- d) Strophe 4: Das ernüchternde Paradigma der Natur
- e) Strophe 5: Das Ächzen der Kreatur als Ausdruck ihres Leidens und einer ziellosen Erlösungshoffnung
- f) Strophe 6: Der Sündenfall als Quelle des ontologischen Spezifikums menschlicher Schuld
- g) Strophe 7: Die allgemeine Unausweichlichkeit der vererbten Schuld
- h) Strophe 8: Die Unleugbarkeit der vererbten Schuld
- i) Strophe 9: Der Mord an der Natur als eigentliches Problem des Sündenfalls
- j) Strophe 10 und Gesamtdeutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Gedicht „Die ächzende Kreatur" von Annette von Droste-Hülshoff, das sich mit der christlichen Erbsündenlehre auseinandersetzt und die menschliche Schuld im Kontext der Natur betrachtet. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Gedichtes im Rahmen der postaufklärerischen Diskussionen über Religion und Natur aufzuzeigen und die zentrale Rolle der Erbsünde im Werk der Droste zu beleuchten.
- Die theistische Deutung der Welt im Kontext der aufklärerischen Kritik
- Die christliche Anthropologie und die Problematik der Erbsünde
- Die Rolle der Natur in der Erbsündenlehre und ihre Bedeutung für die menschliche Existenz
- Die Auseinandersetzung mit dem Deismus und dem Pantheismus als alternativem Weltbild
- Annette von Droste-Hülshoffs eigene Auseinandersetzung mit Glauben und Zweifel.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Deutungsthesen: Dieser Abschnitt legt die zentralen Argumente der Arbeit dar, die sich auf die Interpretation von "Die ächzende Kreatur" und ihre Einordnung in den zeitgenössischen Diskurs konzentrieren. Es werden die Hauptideen des Gedichtes sowie die besonderen Aspekte der Erbsündenlehre und der Rolle der Natur erläutert.
- II. Entstehungsgeschichte: Hier wird die Entstehung des Gedichtes beleuchtet. Es wird auf die Entstehung des Gedichtes, die erste Fassung und die Bedeutung des Titels „Die ächzende Kreatur" eingegangen.
- III. Einordnung in zeitgenössische Diskurse: Dieser Abschnitt beleuchtet die gesellschaftlichen und intellektuellen Strömungen, die die Entstehung des Gedichtes beeinflusst haben. Es wird die Bedrohung des theistischen Weltbildes durch den Deismus und den Naturalismus sowie die Emanzipation des Natur-Begriffs diskutiert.
- IV. Zum Quelltext: Hier wird eine detaillierte Textanalyse des Gedichtes unter Berücksichtigung der zeitgenössischen Exegese durchgeführt. Der Fokus liegt auf der Interpretation einzelner Verse und ihrer Bedeutung im Kontext des Römerbriefs, der als Grundlage für das Gedicht dient.
- V. Gedichtanalyse: In diesem Abschnitt wird die Analyse des Gedichtes fortgesetzt. Es werden die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichtes untersucht, wobei die einzelnen Strophen im Detail betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Erbsünde, Natur, Theismus, Deismus, Pantheismus, Naturalismus, christliche Anthropologie, Annette von Droste-Hülshoff, "Die ächzende Kreatur", Römerbrief, Exegese, postaufklärerischer Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt das Gedicht „Die ächzende Kreatur“ von Annette von Droste-Hülshoff?
Das Gedicht setzt sich mit der christlichen Erbsündenlehre und dem Leiden der Natur auseinander, die durch die Schuld des Menschen mitbetroffen ist.
Welche biblische Grundlage hat das Gedicht?
Das Gedicht basiert auf einer Passage aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, die das „Seufzen der Kreatur“ im Kontext der Erlösungshoffnung beschreibt.
In welchem zeitgenössischen Diskurs steht das Werk?
Es steht im Kontext des postaufklärerischen Versuchs, ein theistisches Weltbild gegen Deismus, Pantheismus und Naturalismus zu verteidigen.
Wer gab den Anstoß für die Entstehung des Gedichts?
Der Freund und Förderer Christoph Bernhard Schlüter gab Droste-Hülshoff den Auftrag, das Thema der „ächzenden Kreatur“ literarisch zu verarbeiten.
Wie wird die Schuld des Menschen im Verhältnis zur Natur dargestellt?
Der Mensch wird als Urheber eines „Mordes an der Natur“ durch den Sündenfall gesehen, wodurch die gesamte Schöpfung in einen Zustand des Leidens geraten ist.
Was ist das Ergebnis der Gedichtanalyse bezüglich Drostes eigener Meinung?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Droste-Hülshoff von der ursprünglichen Intention Schlüters abgewichen ist und ihre eigenen Zweifel und melancholischen Naturbegegnungen eingeflochten hat.
- Quote paper
- Lukas Rieger (Author), 2011, Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht "Die ächzende Kreatur" im Kontext des postaufklärerischen Restaurationsversuches christlicher Naturexegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189343