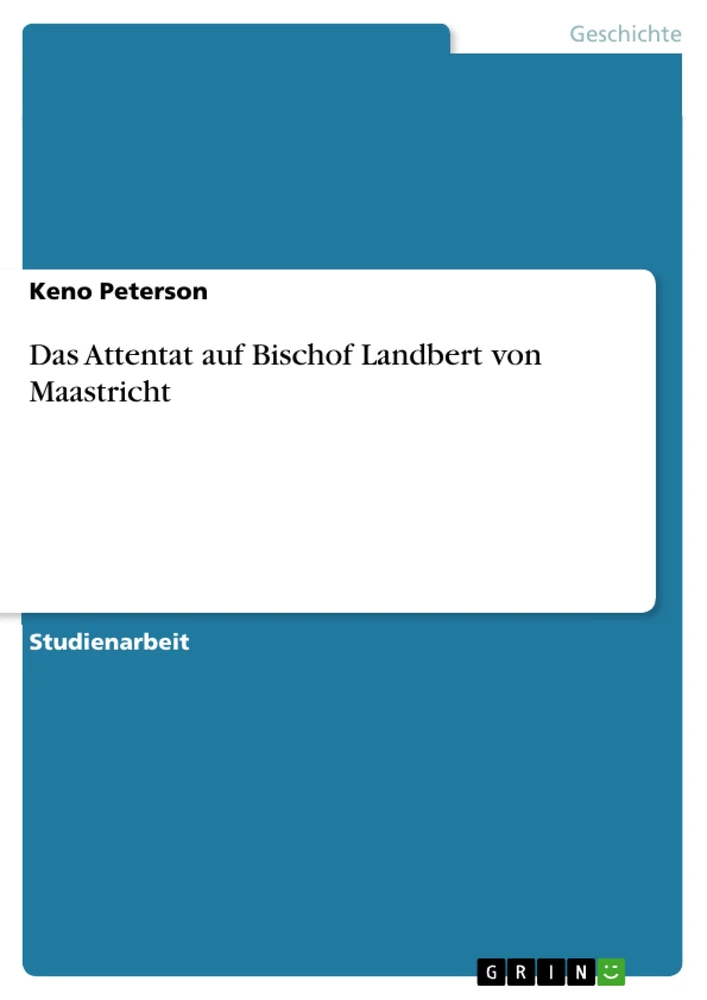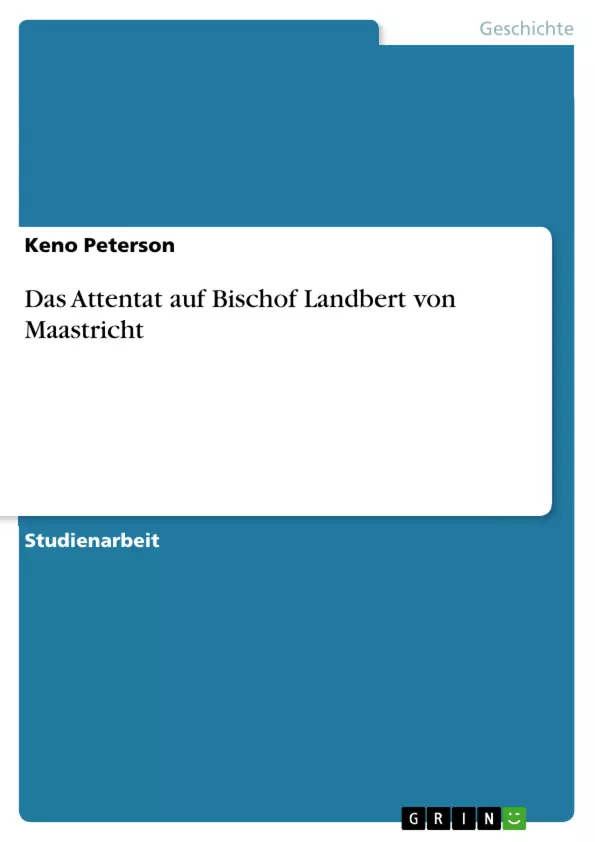Das Attentat auf Bischof Landbert von Maastricht im Jahre 705 ist eines der bedeutendsten Beispiele des mittelalterlichen Bischofsmordes. Es steht stellvertretend für den Dualismus zwischen
klerikalem, gottgefälligem Lebenswandel und der frühmittelalterlichen, auf physische Gewalt
ausgelegten Adels- und Sippenstrukturen. Was dieses Attentat allerdings von anderen, zahlreich
geschehenen Angriffen auf Bischöfe im Mittelalter unterscheidet, ist die zeitliche Brisanz: Bischof
Landbert starb zu einer Zeit des Umbruchs und Wandels der frühmittelalterlichen Gesellschaft: Die
Ablösung des merowingischen Königsgeschlechtes durch die karolingischen Hausmeier am Ende
des 7./ Anfang des 8. Jahrhunderts.
Deutlich wird dies in den verwendeten Primärquellen: Zum einen die merowingisch geprägte
Heiligenvita Vita Landiberrti [sic!] episcopi traiectensis vetustissima1 eines unbekannten Autors aus
dem Jahre 730, sowie die 350 Jahre später verfasste Vita Landiberti episcopi traiectensis auctore
Sigeberto2 des Sigebert von Gembloux, die karolingischen Stil und Sprache aufweist. Als
Ergänzung sei die zweite Vita Landberts Vita Landiberti episcopi traiectensis auctore Stephano3
von seinem Amtsnachfolger Stephan von Lüttich aus dem frühen 10. Jahrhundert erwähnt.
Im Folgenden soll untersucht werden, wie sich im Laufe der 350 Jahre der hagiographische Stil der
Viten unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitlichen Umstände verändert hat. Wie wird die
Person Bischof Landberts dargestellt, wo setzen die einzelnen Viten ihre Schwerpunkte? Wie
wirken sich die veränderten Herrschaftsverhältnisse auf die Inhalte aus? Um das Thema bearbeiten
zu können sollten die zeitlichen und räumlichen Umstände geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das Bischofsamt von der Spätantike bis zur Zeit Landberts
- Die Vita Landberts
- Herkunft, Jugend und Erziehung Landberts
- Die Amtszeit Landberts bis zum Exil im Kloster Stablo
- Exil Landberts im Kloster Stablo und Wiedereinsetzung
- Die Vorboten der Ermordung Landberts
- Das Martyrium Landberts
- Schlussbemerkung
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Attentat auf Bischof Landbert von Maastricht im Jahre 705 und untersucht die Veränderungen im hagiographischen Stil der Viten Landberts im Laufe von 350 Jahren. Dabei werden die jeweiligen zeitlichen Umstände, die Darstellung der Person Landberts, die Schwerpunkte der einzelnen Viten und der Einfluss der sich ändernden Herrschaftsverhältnisse auf die Inhalte beleuchtet.
- Veränderungen im hagiographischen Stil der Viten Landberts
- Darstellung der Person Bischof Landberts in den Viten
- Schwerpunkte der einzelnen Viten Landberts
- Einfluss der sich ändernden Herrschaftsverhältnisse auf die Inhalte der Viten
- Das Bischofsamt im Frühmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Attentat auf Bischof Landbert von Maastricht als Beispiel für den Dualismus zwischen klerikalem und weltlichem Leben im Frühmittelalter dar. Sie erläutert den historischen Kontext und die Bedeutung der Primärquellen, die für die Arbeit herangezogen werden.
Der erste Teil des Hauptteils beleuchtet das Bischofsamt von der Spätantike bis zur Zeit Landberts. Er beschreibt die Herausbildung des Bischofsamtes als eine Institution, die in der Zeit des römischen Reichszerfalls an Macht gewann. Die Bischöfe waren zu dieser Zeit nicht nur geistliche Führer, sondern auch weltliche Herrscher, die oft in Konflikte mit dem Adel gerieten.
Der zweite Teil des Hauptteils befasst sich mit der Vita Landberts, in der die verschiedenen Phasen seines Lebens, von seiner Herkunft bis zu seinem Martyrium, dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Bischofsmord, Frühmittelalter, Vita Landberts, Bischofsamt, hagiographischer Stil, merowingische Herrschaft, karolingische Herrschaft, Machtstrukturen, Lütticher Raum, Quellenvergleich, Heiligenvita.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Bischof Landbert von Maastricht?
Landbert war ein bedeutender Bischof im 7. und frühen 8. Jahrhundert, dessen Ermordung im Jahr 705 als eines der bekanntesten Beispiele für mittelalterliche Bischofsmorde gilt.
Warum ist das Attentat auf Landbert historisch so brisant?
Sein Tod fiel in eine Zeit des Umbruchs, als das merowingische Königsgeschlecht durch die karolingischen Hausmeier abgelöst wurde.
Wie unterscheiden sich die Quellen über Landberts Leben?
Die früheste Vita (um 730) ist merowingisch geprägt, während spätere Fassungen (wie die von Sigebert von Gembloux) einen karolingischen Stil und andere Schwerpunkte aufweisen.
Welche Rolle spielte das Bischofsamt im Frühmittelalter?
Bischöfe waren damals nicht nur geistliche Führer, sondern verfügten auch über erhebliche weltliche Macht, was sie oft in Konflikte mit lokalen Adelsstrukturen brachte.
Was war der Grund für die Ermordung Landberts?
Die Tat steht stellvertretend für den Dualismus zwischen klerikalem Lebenswandel und den auf physische Gewalt ausgelegten Adels- und Sippenstrukturen der Zeit.
Was versteht man unter hagiographischem Stil?
Es bezeichnet die Art und Weise, wie Heiligenbiografien (Viten) verfasst wurden, wobei die Darstellung oft von den politischen und religiösen Absichten des Autors beeinflusst war.
- Quote paper
- Keno Peterson (Author), 2008, Das Attentat auf Bischof Landbert von Maastricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189531