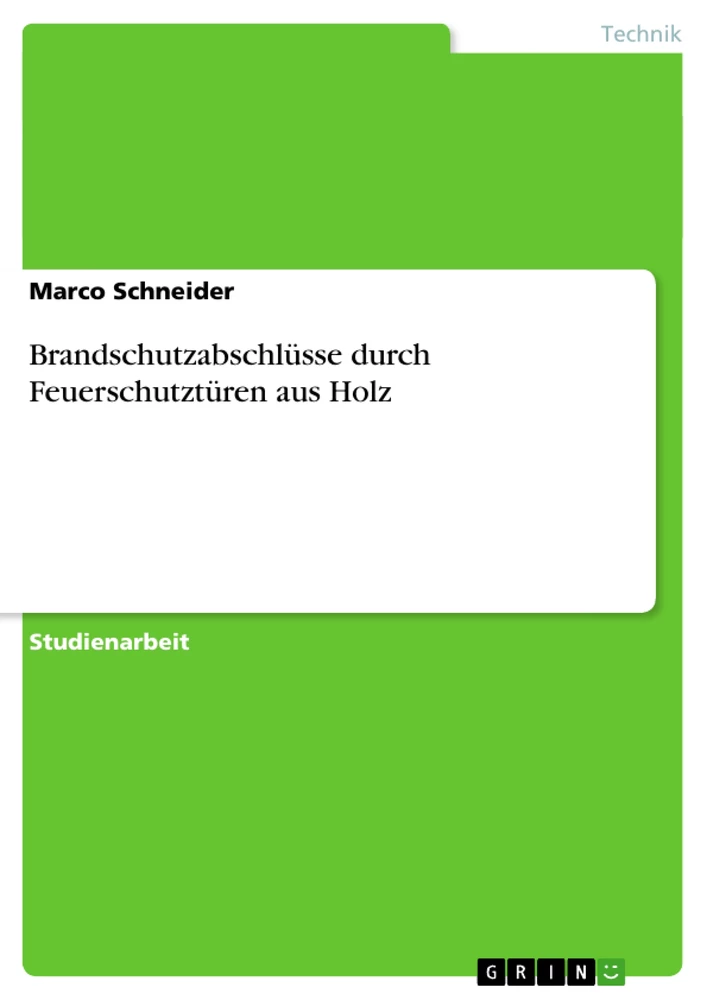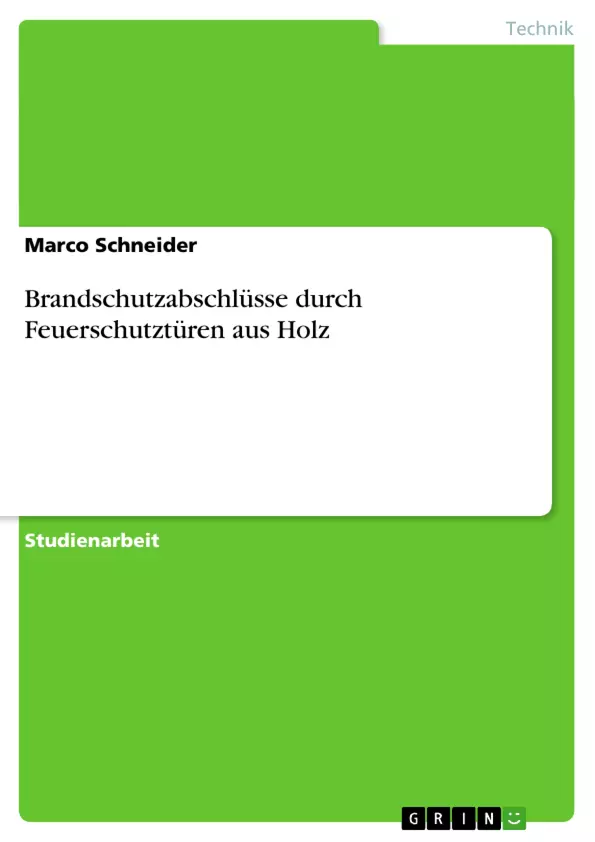Im Laufe der Entwicklung von Städten und der Industrialisierung nahm das Thema "Baulicher Brandschutz" im mehr an Bedeutung zu. Die Städte und Industriebgebiete innerhalb der Siedlungsbereiche wuchsen und dehnten sich aus. Hierbei verstärkte sich jedoch die Gefahr, dass aus einem einzelnen Brand in einer baulichen Anlage innerhalb kürzester Zeit ein Großbrand werden konnte, dem weite Teile eines Siedlungsgebietes zum Opfer fallen konnten.
Zu Beginn des 18.Jahrhunderts schon wurde dem Thema Brandschutz bereits Bedeutung beigemessen, obgleich die Wirksamkeit dieser Mittel in Frage gestellt werden darf.
Man formulierte dies 1701 so:
"Zur Brandbekämpfung ist eine Mischung aus Hirschbrunst, welches Hirsche in ihrer Brunst fallen lassen, im Feuer mit Teilen eines Schwalbennestes und Wachs zu verschmelzen, das Ganze mit einem schwarzen Huhn, das man geköpft und dem man den Magen herausgeschnitten hat, sowie einem am Gründonnerstag gelegten Ei und dem Menstruationsblut einer Jungfrau zu vermischen und in einem Holzbehälter un-ter der Hausschwelle zu vergraben." [1] Da dies offensichtlich nicht hilfreich bei der Brandbekämpfung war, wurde im späten Mittelalter, z.B. 1715 in Karlsruhe die ersten Feuerlöschordnungen erlassen. Das dies nicht ausreichend war und nach einer Nachbesserung verlangte, wurde am Brand des Karlsruher Hoftheaters 1847 deutlich, der mehrere Hundert Todesopfer forderte. Hiernach erkannte man die Bedeutung der Brandbekämpfung und gründete eine Freiwillige Feuerwehr. Aufgrund der jedoch schnell wachsenden Stadt und der somit mitwachsenden Anforderungen an die Wehren wurde Mitte 1920 die Berufsfeuerwehr gegründet.
Das man jedoch bereits im Vorfeld eines möglichen Brandes Einfluss auf dessen Entstehung nehmen kann, wurde erst später in die Auflagen der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren eingearbeitet. Aus heutiger Sicht wird dies wie folgt formuliert: "Bauliche Anlagen müssen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten durchgeführt werden können." [2]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines zum baulichen Brandschutz
- 1.1. Der Brandschutz im Wandel der Zeit
- 1.2. Gesetzliche Regelungen im baulichen Brandschutz
- 2. Feuerschutztüren (bzw. Feuerschutzabschlüsse)
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Einbauhinweise und -anforderungen
- 2.3. Einbindung von Feuerschutzabschlüssen in Wandkonstruktion
- 2.3.1. Einbau in Betonwände
- 2.3.2. Einbau in Mauerwerkswände am Beispiel von KS
- 2.3.3. Einbau in Gipskartonständerwände
- 3. Feuerschutztüren aus Holz oder Holzwerkstoffen
- 3.1. Allgemeines zu Feuerschutztüren aus Holz/Holzwerkstoffen
- 3.2. Konstruktionsmerkmale
- 3.2.1. Kantenverdichtete Spezialspanplatten
- 3.2.2. Zweischalige Sandwichkonstruktion
- 3.2.3. Mehrschichtig aufgebaute Spanplattentüren
- 3.3. Wirkungsweisen der Holz- u. Holzwerkstofftüren
- 3.3.1. Kantenverdichtete Spezialspanplatten
- 3.3.2. Zweischalige Sandwichkonstruktion
- 3.3.3. Mehrschichtig aufgebaute Spanplattentüren
- 4. Sonderkonstruktionen und -anforderungen
- 4.1. Türschließmittel
- 4.2. Verglasungen in Feuerschutztüren aus Holz u. Holzwerkstoffen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Semesterarbeit befasst sich mit der Thematik des Brandschutzes im Bauwesen, insbesondere mit Feuerschutzabschlüssen aus Holz und Holzwerkstoffen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Brandschutzes im Laufe der Zeit, beleuchtet die relevanten gesetzlichen Regelungen und vertieft das Verständnis für die Konstruktion, Funktion und Einsatzmöglichkeiten von Feuerschutzabschlüssen aus Holz.
- Entwicklung des baulichen Brandschutzes
- Gesetzliche Regelungen und Normen im Brandschutz
- Konstruktionsmerkmale von Feuerschutzabschlüssen aus Holz
- Funktionsweise von Feuerschutzabschlüssen aus Holz
- Einsatzmöglichkeiten und besondere Anforderungen bei Feuerschutzabschlüssen aus Holz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des baulichen Brandschutzes und beleuchtet die Bedeutung von gesetzlichen Regelungen. Im zweiten Kapitel werden Feuerschutzabschlüsse allgemein definiert und die verschiedenen Feuerwiderstandsklassen erläutert. Die Kapitel drei und vier konzentrieren sich auf Feuerschutzabschlüsse aus Holz, wobei die verschiedenen Konstruktionsmerkmale, ihre Wirkungsweisen und Einsatzmöglichkeiten sowie Sonderkonstruktionen und -anforderungen im Detail behandelt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselthemen: Brandschutz, Feuerschutzabschlüsse, Feuerschutztüren, Holz, Holzwerkstoffe, Bauwesen, Konstruktion, Funktion, Normen, DIN 4102, Feuerwiderstandsklassen.
Häufig gestellte Fragen
Können Türen aus Holz tatsächlich als Feuerschutzabschlüsse dienen?
Ja, durch spezielle Konstruktionen wie kantenverdichtete Spanplatten oder Sandwichbauweisen können Holztüren hohe Feuerwiderstandsklassen erreichen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern.
Welche gesetzlichen Regelungen gelten für den baulichen Brandschutz?
In Deutschland ist vor allem die DIN 4102 maßgeblich, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt und die Anforderungen für bauaufsichtliche Genehmigungen definiert.
Wie werden Feuerschutztüren in verschiedene Wandarten eingebaut?
Es gibt spezifische Einbauanforderungen für Betonwände, Mauerwerk (z. B. Kalksandstein) und Gipskartonständerwände, um die Brandschutzwirkung im Verbund sicherzustellen.
Was sind die Konstruktionsmerkmale einer Feuerschutztür aus Holz?
Dazu gehören mehrschichtig aufgebaute Spanplatten, zweischalige Sandwichkonstruktionen und spezielle Türschließmittel sowie Brandschutzverglasungen.
Warum hat der bauliche Brandschutz historisch an Bedeutung gewonnen?
Mit dem Wachstum der Städte und der Industrialisierung stieg die Gefahr von Großbränden. Historische Katastrophen führten zur Entwicklung von Feuerlöschordnungen und modernen Brandschutzauflagen.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. (BA), M.Sc. Marco Schneider (Author), 2003, Brandschutzabschlüsse durch Feuerschutztüren aus Holz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18977