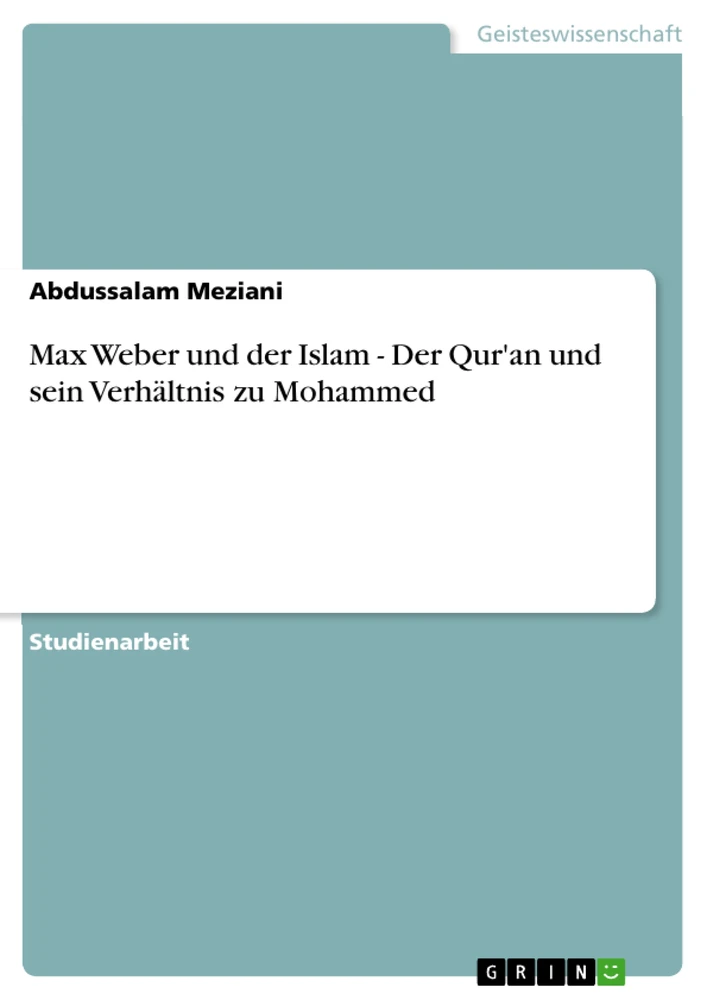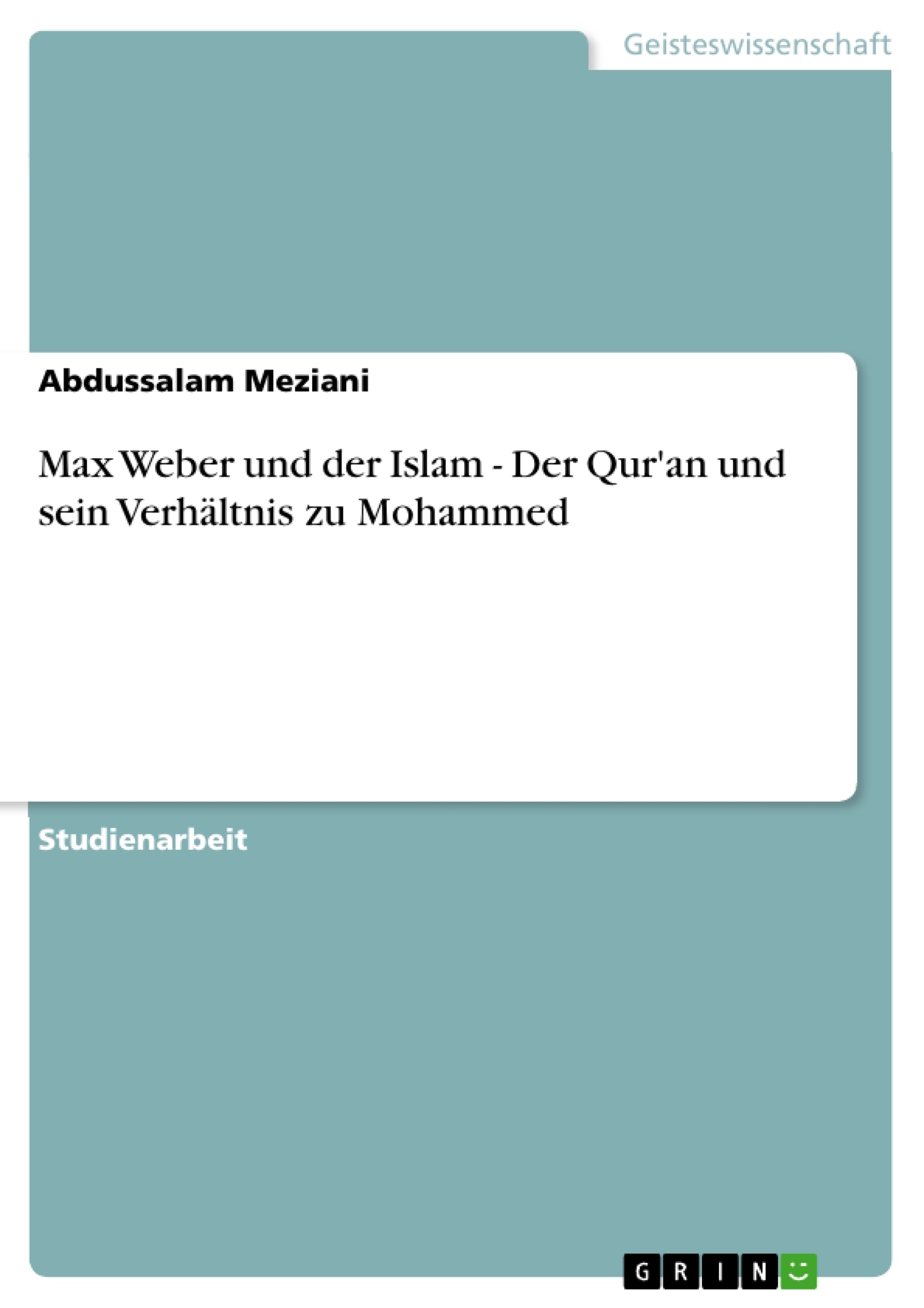Bei der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich primär mit dem Qur’an und dessen Verhältnis zu Mohammed, welcher auch im Rahmen der Veranstaltung „Max Weber und der Islam“ behandelt wurde. Hervorzuheben ist, dass dieser Veranstaltung die Aufgabe zugrundelag, die Differenz und Gemeinsamkeiten soziologisch zu bestimmen, und nicht beabsichtigte, den Qur’an etwa zu exotisieren. Das Ziel, das Max Weber mit seiner Religionssoziologie verfolgte, ist die Entstehung einer „Theorie der Religion“. Dabei bedient er sich seines umfassenden historischen Wissens als Grundlage, legt es hermeneutisch aus und bringt es in ein Sytem verdichteter Begriffe, das als Gerüst für den interkulturellen und intertemporalen Vergleich von Religionen dienen kann. Die Theorie dient dabei als ein Instrument der Explikation. Max Weber würde sagen: „Eine Definition, was Religion ist, machen wir erst gar nicht. Ich versuche erst gar nicht, Religion systematisch zu definieren“. Das Islamverständnis bildete den Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Religionskritik in der Soziologie - vor allem die von Max Weber - war immer vorsichtig. Das Glaubenssystem des Islam wurde in dieser Veranstaltung nicht kritisiert. Die Wahrung der Dignität lag also im Fokus der Auseinandersetzung mit dem Islam.
Nach der islamischen Überlieferung gilt der Qur’an als das unverfälschte Wort Gottes und als das größte Werk, das der Prophet Mohammed – nach seinem Ableben – der Menschheit hinterlassen hat. Der Qur’an bildet für die gläubigen Muslime eine normative Richtschnur, nach der sie ihre alltägliche Lebensführung gestalten. Der Qur’an besitzt eine mündliche Tradition und wird weltweit (von den Muslimen) täglich rezitiert, studiert, verehrt und auswendig gelernt. Zudem zählt der Qur’an zu eines der meistgelesenen Büchern der Welt und gegenwärtig vielleicht auch sogar am häufigsten diskutierte.
Bis heute gilt der Qur’an als das wichtigste Literaturwerk der arabischen Sprache.Durch die von ihm vorgelebte islamische Lebensführung, bekannt als die „Sunna“ , nimmt diese im Hinblick auf die Lebensentwürfe zahlreicher Muslime eine besondere Stellung ein.
Darüber hinaus werde ich einen interessanten Diskussionsstrang aus dem Seminar aufgreifen, in der es im Wesentlichen darum gehen wird, weshalb der Qur’an keine chronologische oder narrative Struktur aufweist bzw. aufweisen kann. Diese Frage werde ich am Ende versuchen näher zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Konzipierung des Qur'an.
- 2.1. Begriffsdefinition
- 2.2. Strukturmerkmale des Qur'an
- 2.3. Sprache und Literarische Form
- 2.3.1. Sprachliche Form
- 2.3.2. Literarische Form
- 2.4. Die Sieben Lesearten des Qur'an
- 3. Das Verhältnis zwischen Mohammed und dem Qur'an
- 3.1. Mohammed vor seiner Berufung
- 3.2. Der Beginn der Offenbarung
- 3.3. Die Vorgehensweise Mohammeds den Qur'an an seine Mitmenschen weiter zu geben.
- 3.3.1. Erst die nächsten Verwandten
- 3.3.2. Der erste Aufruf vom Hügel Safa
- 3.3.3. „Das Wort“
- 3.3.4. Prophetische Lehrmethoden
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Qur'an und seinem Verhältnis zu Mohammed. Ziel der Arbeit ist es, die Konzeption und Struktur des Qur'an zu beleuchten, sowie den Offenbarungsprozess und die Rolle Mohammeds als Vermittler der göttlichen Botschaft zu erforschen.
- Die Konzeption des Qur'an
- Die Bedeutung und Strukturmerkmale des Qur'an
- Die sprachliche und literarische Form des Qur'an
- Der Offenbarungsprozess und Mohammeds Rolle als Vermittler der Botschaft
- Die Weitergabe des Qur'an an Mohammeds Mitmenschen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung des Qur'an für die muslimische Welt. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Konzeption des Qur'an, seiner Struktur und seiner sprachlichen Besonderheiten. Kapitel 3 widmet sich dem Verhältnis zwischen Mohammed und dem Qur'an, indem es den Offenbarungsprozess und Mohammeds Rolle als Vermittler der Botschaft schildert. Schließlich beleuchtet Kapitel 3, wie Mohammed den Qur'an an seine Mitmenschen weitergab. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den Qur'an, Mohammed, Offenbarungsprozess, Konzeption, Struktur, Sprachliche und Literarische Form, Rolle des Propheten, Weitergabe der Botschaft, Islam, Religionssoziologie.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts (B.A.) Abdussalam Meziani (Autor:in), 2011, Max Weber und der Islam - Der Qur'an und sein Verhältnis zu Mohammed, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190253