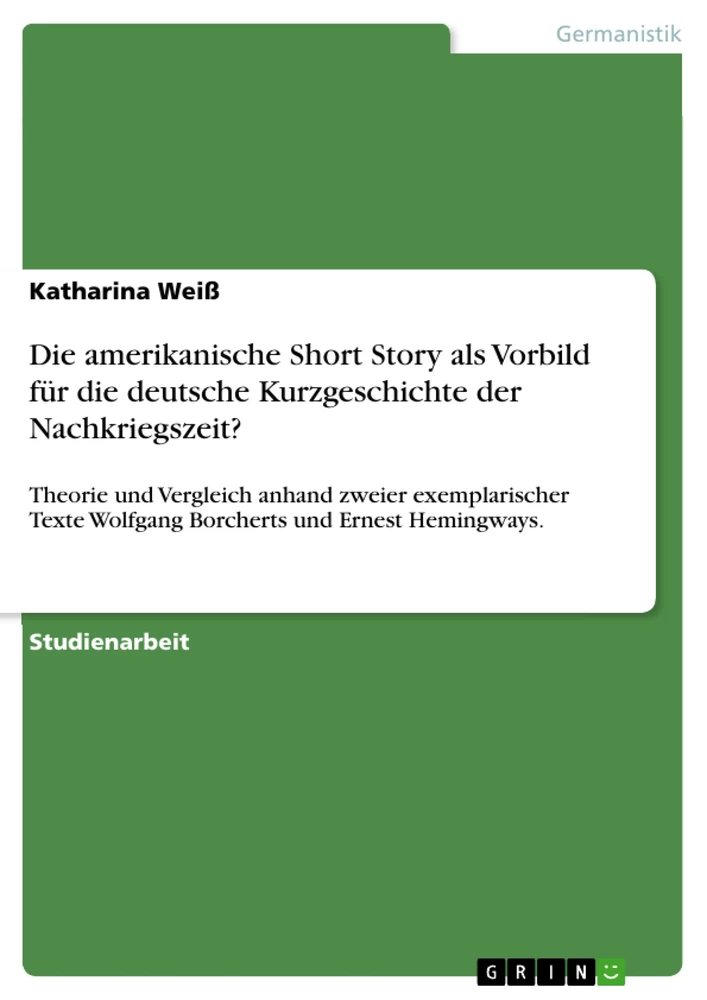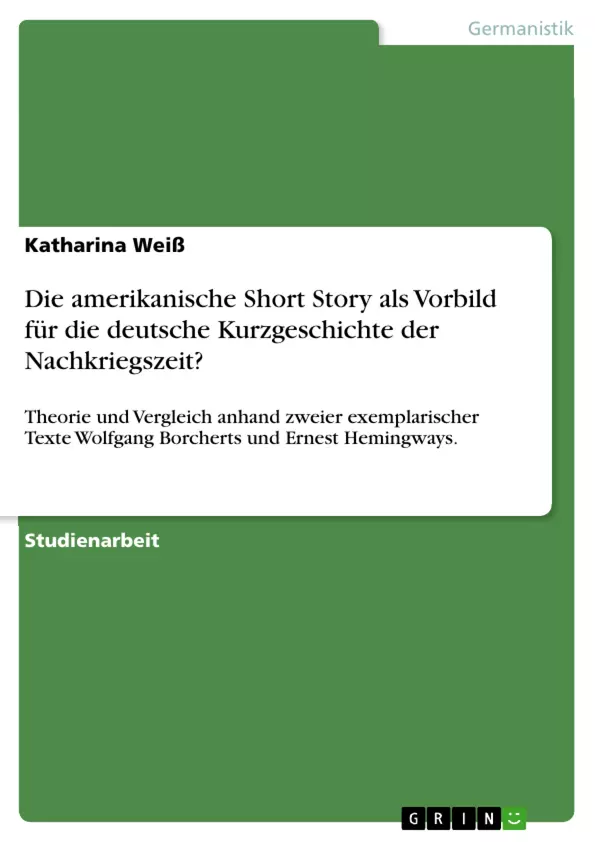Spricht man über das Thema Kurzgeschichte, so ist es nicht verwunderlich ohne Zögern von seinem Gegenüber Begriffe wie Trümmerliteratur, Wolfgang Borchert oder gar Titel seiner Kurzgeschichten wie „Das Brot“, „Nachts schlafen die Ratten doch“ oder „Die Küchenuhr“ genannt zu bekommen. Doch gleichermaßen ist es Ernest Hemingway, der charakteristische Amerikaner und Nobelpreisträger, der in solchem Kontext angesprochen wird. Titel wie „Snows of Kilimanjaro“, „The short happy life of Francis Macomber“ oder „The Nick Adams Stories“ sind vielgelesen und weltberühmt. Doch stellt sich die Frage, warum ausgerechnet diese beiden Schriftsteller- als nur kleiner Teil einer schier riesigen Auswahl an Autoren und Autorinnen- immer und immer wieder im Themenbereich Kurzgeschichte bzw. Short Story als exemplarisch dargestellt und genannt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieaspekte der Kurzgeschichte
- Definition, Charakteristika und Geschichte der amerikanischen Short Story
- Theoretische Schwerpunkte der Kurzgeschichtenforschung: Gattungsmerkmale von Anfang bis Zeitstruktur
- Die deutsche Kurzgeschichte der Nachkriegszeit (ca. 1945-1950/52)
- Die literarische `Stunde Null'
- Die Rezeption der Short Story nach dem Krieg
- Formentypen und Themenvielfalt der Kurzgeschichte
- ,,Nachts schlafen die Ratten doch“ und „Old Man at the Bridge“. Ein Vergleich
- Die amerikanische Short Story als Vorbild für die Nachkriegskurzgeschichte in Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Frage, ob die amerikanische Short Story ein Vorbild für die deutsche Kurzgeschichte der Nachkriegszeit war. Sie befasst sich mit den Charakteristika, der Geschichte und Entwicklung beider Gattungen und beleuchtet die theoretischen Schwerpunkte der Kurzgeschichtenforschung. Der Fokus liegt dabei auf amerikanischen Kurzgeschichten, wobei andere englischsprachige Länder und Texte nicht miteinbezogen werden. Der Zeitrahmen für die Anfänge der Short Story beschränkt sich auf Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Für Vergleiche werden die Geschichten Hemingways als exemplarische Texte verwendet. Die Nachkriegskurzgeschichte in Deutschland wird auf ihre Blütezeit zwischen 1945 und 1950/52, also die unmittelbaren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, behandelt. Hier stehen die Texte Borcherts als Beispiele im Vordergrund.
- Analyse der Merkmale der amerikanischen Short Story
- Untersuchung der Entwicklung der deutschen Kurzgeschichte nach dem Krieg
- Vergleich der beiden Gattungen anhand exemplarischer Texte von Hemingway und Borchert
- Beurteilung des Einflusses der amerikanischen Short Story auf die deutsche Kurzgeschichte
- Betrachtung der Rolle von Kriegserfahrungen in der Kurzgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kurzgeschichte ein und stellt die zentrale Leitfrage der Arbeit vor. Sie beleuchtet die besonderen Aspekte der Werke von Hemingway und Borchert und erläutert die Intention der Untersuchung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Theorie der Kurzgeschichte und beleuchtet die Definition, die Charakteristika und die Geschichte der amerikanischen Short Story. Es werden verschiedene Forschungsbeiträge und Definitionen diskutiert, die sich mit der Abgrenzung zur deutschen Kurzgeschichte befassen. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung der Short Story als eigenständige Gattung in den USA und die Besonderheiten ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die amerikanische Short Story und die deutsche Kurzgeschichte der Nachkriegszeit. Zentrale Begriffe sind: Short Story, Kurzgeschichte, Gattungsmerkmale, Vergleich, Vorbildfunktion, Hemingway, Borchert, Kriegserfahrungen, Trümmerliteratur, Stunde Null, Zeitgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
War die amerikanische Short Story ein Vorbild für die deutsche Kurzgeschichte?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Autoren wie Ernest Hemingway auf die deutsche Nachkriegsliteratur (ca. 1945–1952).
Was verbindet Wolfgang Borchert mit Ernest Hemingway?
Beide gelten als exemplarische Vertreter der Gattung; Borchert für die deutsche Trümmerliteratur und Hemingway für die klassische amerikanische Short Story.
Was versteht man unter „Trümmerliteratur“?
Es ist die Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland, die sich mit Heimkehr, Kriegserfahrungen und der „Stunde Null“ befasst.
Was sind die Merkmale einer Kurzgeschichte?
Dazu gehören ein unvermittelter Beginn, eine knappe Zeitstruktur, Alltagssprache und oft ein offenes Ende oder eine Pointe.
Welche Geschichten werden in der Arbeit verglichen?
Es findet ein direkter Vergleich zwischen Borcherts „Nachts schlafen die Ratten doch“ und Hemingways „Old Man at the Bridge“ statt.
- Arbeit zitieren
- Katharina Weiß (Autor:in), 2009, Die amerikanische Short Story als Vorbild für die deutsche Kurzgeschichte der Nachkriegszeit? , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190844