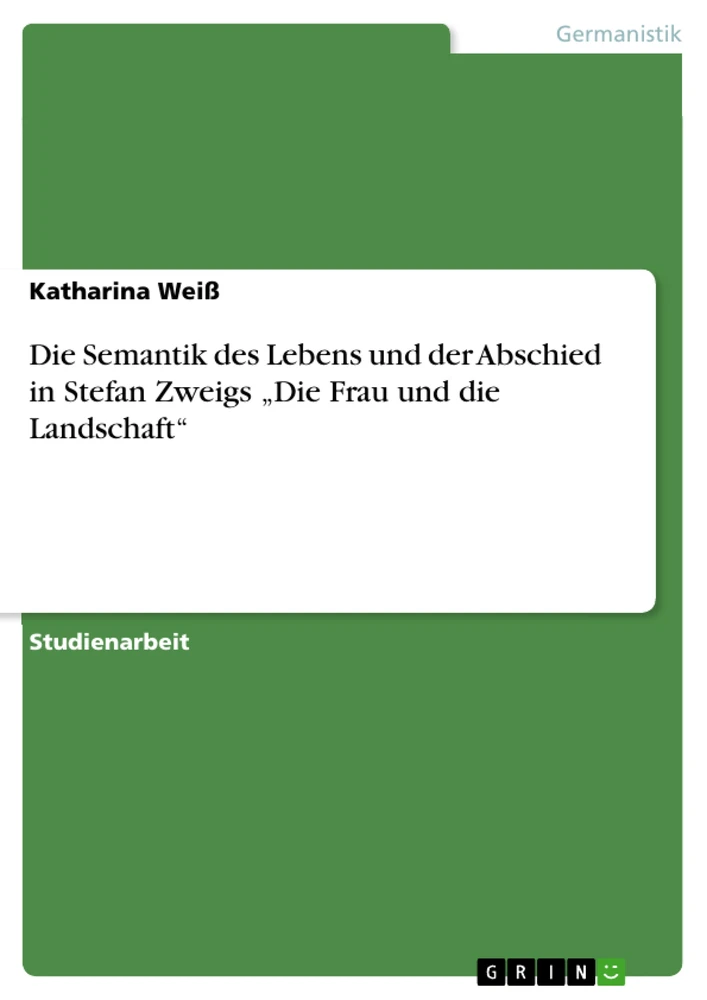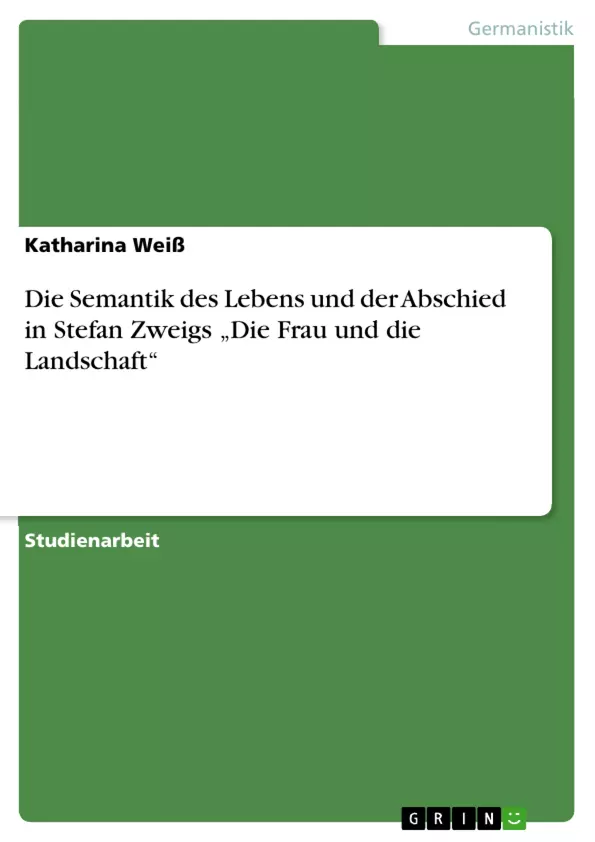Jeder Abschied ist wie ein kleiner Tod sagt man. Jeder kennt Abschiede der verschiedensten Formen, Intensitäten und Stimmungen, jeder hat selbst schon häufig Abschied genommen, sei es von Freunden, vom ersten Auto, der ersten Wohnung, von einem Urlaubsland, der Schule oder einem geliebten Menschen. Die Subjekte und Objekte, von denen man sich dabei verabschiedet sind von völliger Beliebigkeit und vor allem von subjektiv geprägter Wichtigkeit, d. h. sie können einerseits durchaus profan und unwichtig erscheinen, andererseits von enormer Bedeutung sein.
Die Abschiede in der Literatur sind wohl genauso alt, wie die Erfindung der Schrift selbst: Der Abschied Hektors von Andromache, Orpheus´ von Euridike, Jesus´ von seinen Jüngern, Siegfrieds von Krimhild, Julias von Romeo usw. legen Zeugnis darüber ab, auf welche Weise sich Figuren voneinander verabschieden. Doch was genau ist ein Abschied? Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist er sicherlich ein Motiv, doch ist er auch eine Reflexionsfigur als notwendig ästhetische Größe, die nicht als narrativ-dramaturgisches Strukturelement betrachtet werden muss.
Ein „Leb wohl“ ist ebenso eine Formel des Abschieds wie ein „Auf Wiedersehen“, doch steht im Fokus von Abschieden wohl meist das Endgültige, das Ende, der Tod. Viele Menschen assoziieren etwas dauerhaftes und trauriges mit einem Abschied und verbinden nicht unbedingt etwas positives, das daraus entsteht oder entstehen kann. Ziel dieser Arbeit ist es Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft“ aus dem Zeitverständnis der Frühen Moderne heraus auf deren Motivik des Abschieds und des emphatischen Lebens zu interpretieren. Dazu ist es zunächst wichtig, sich über die besondere Auffassung des Lebens in dieser Epoche bzw. der speziellen `Lebensideologie´ überhaupt erst klar zu werden; ebenso wie über den dazu gehörenden `metaphorischen´ Tod. Erst durch diese Herangehensweise kann über die Art des Abschieds bzw. über den Vollzug des Abschieds ein Urteil gebildet werden. Die besondere Schwierigkeit ergibt sich aus dem Stand der Forschung, der bezüglich dieser Novelle Zweigs nahezu bei Null steht, weshalb zunächst in einem ersten Schritt der Zugang über die Epoche und ihre `Lebensideologie´ erfolgen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Semantik des 'Lebens' und der Abschied in Stefan Zweigs „Die Frau und die Landschaft“
- Begriffsdefinition von `Leben´ und Lebensraum in der Frühen Moderne
- Die Krise
- Normbruch und Erotik als Pfad zu emphatischem Leben
- „Die Frau und die Landschaft“
- Die Funktion der Landschaft und ihre Einordnung in die Lebenssemantik
- Die Beziehung der Figuren zueinander und deren 'lebensideologische Konzeption
- Bedeutung von Erotik und Normbruch
- Die Geschichte einer metaphorischen Widergeburt?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Motivik des Abschieds und des emphatischen Lebens in Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft" im Kontext der Frühen Moderne. Ziel ist es, die Novelle aus dem Zeitverständnis der Epoche heraus zu interpretieren und die besondere Auffassung des Lebens und den dazugehörigen `metaphorischen' Tod in dieser Zeit zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Funktionen von Abschied und Lebensraum sowie deren Einfluss auf die Figuren und deren 'lebensideologische Konzeption'.
- Das 'Leben' und seine Semantik in der Frühen Moderne
- Die Rolle des Abschieds als Motiv und Reflexionsfigur in der Literatur
- Die Bedeutung der Landschaft und des Lebensraums für die Figuren und deren Seelenlandschaft
- Die Bedeutung von Erotik und Normbruch im Kontext des 'emphatischen Lebens'
- Die Frage nach der Authentizität des Abschieds und der Möglichkeit einer metaphorischen Wiedergeburt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Abschieds in der Literatur vor und erläutert die Bedeutung des Abschieds als Motiv und Reflexionsfigur. Sie führt zudem in die Zielsetzung der Arbeit und die spezifische Herangehensweise an Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft" ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Semantik des Lebens und der Bedeutung des Lebensraums in der Frühen Moderne. Es analysiert die besondere Auffassung des Lebens und den dazugehörigen `metaphorischen' Tod in dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen 'Leben', 'Abschied', 'Emphatisches Leben', 'Frühe Moderne', 'Lebensideologie', 'Landschaft', 'Lebensraum', 'Erotik', 'Normbruch' und 'metaphorische Wiedergeburt'.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Stefan Zweigs Novelle „Die Frau und die Landschaft“?
Die Novelle thematisiert das Zusammenspiel von innerer Seelenlandschaft und äußerer Natur sowie das Motiv des Abschieds und des emphatischen Lebens.
Was bedeutet „Semantik des Lebens“ in der Frühen Moderne?
Es beschreibt eine spezifische Lebensideologie jener Zeit, in der das Leben als dynamische, oft erotisch aufgeladene und normbrechende Kraft verstanden wurde.
Welche Rolle spielt die Landschaft in der Erzählung?
Die Landschaft fungiert als Spiegel der Emotionen und als Raum, in dem sich die lebensideologische Konzeption der Figuren entfaltet.
Ist der Abschied in der Literatur nur ein Ende?
Nein, die Arbeit interpretiert den Abschied auch als Reflexionsfigur und ästhetische Größe, die eine metaphorische Wiedergeburt ermöglichen kann.
Warum gibt es so wenig Forschung zu dieser speziellen Novelle?
Die Arbeit stellt fest, dass der Forschungsstand zu „Die Frau und die Landschaft“ im Vergleich zu anderen Werken Zweigs gering ist, weshalb ein Zugang über die Epochenideologie gewählt wurde.
- Arbeit zitieren
- Katharina Weiß (Autor:in), 2011, Die Semantik des Lebens und der Abschied in Stefan Zweigs „Die Frau und die Landschaft“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190847