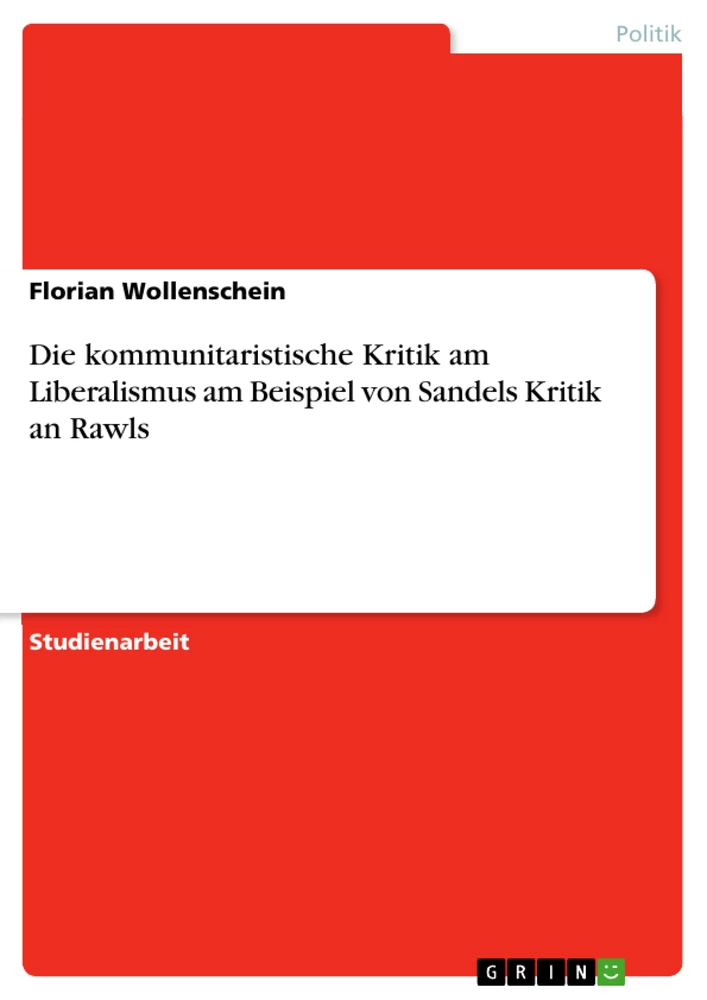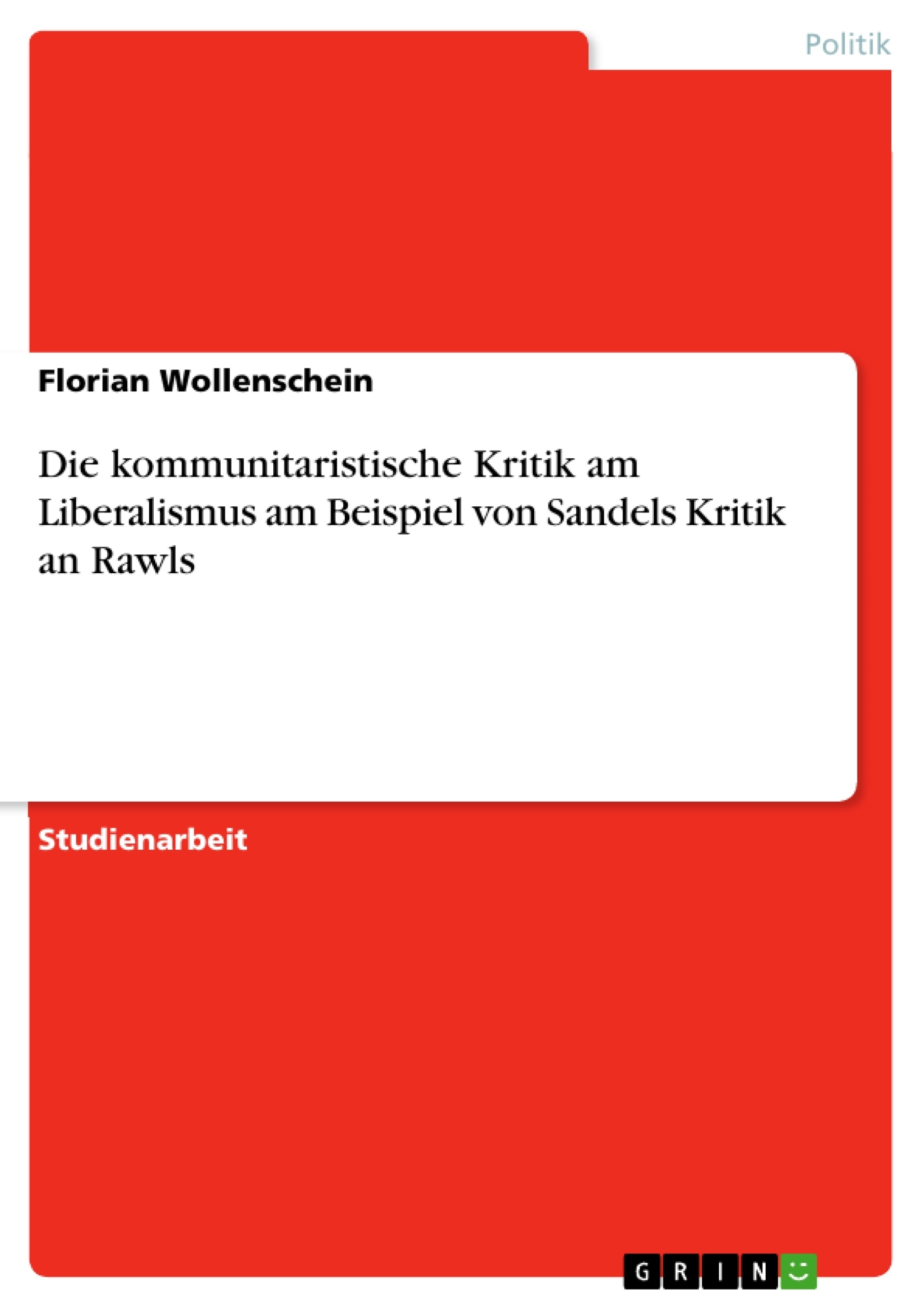John Rawls gilt als einer der wichtigsten Vertreter der politischen Philosophie des Zwanzigsten Jahrhunderts. Mit seinem erstmals 1971 erschienenen Werk A Theory of Justice begründete er die Abkehr vom Utilitarismus, der – ausgehend von Jeremy Bentham und John Stuart Mill – nahezu zweihundert Jahre lang die anglo-amerikanische Moralphilosophie sowie die politische Philosophie dominiert hatte. Rawls verwarf die Vorstellungen des Utilitarismus und setzte diesen eine liberale Konzeption von Gerechtigkeit als Fairness entgegen.
Die kommunitaristische Kritik, seine Theorie der Gerechtigkeit als Fairness sei „kontextvergessen“, nahm Rawls zum Anlass, seine Gerechtigkeitskonzeption zu überdenken und in seinem zweiten Hauptwerk Politischer Liberalismus umfassende Änderungen an ihr vorzunehmen. Er lässt den Allgemeingültigkeitsanspruch der Gerechtigkeit als Fairness fallen und bettet sie in den Kontext des modernen demokratischen Verfassungsstaates ein. Sie beansprucht nun nur noch für solche Gesellschaften und deren Bürger Gültigkeit.
Doch auch diese weitergehende politische Theorie blieb von kommuni-taristischer Seite nicht unbeantwortet. Sandel fügte der zweiten Auflage seiner Liberalismuskritik ein Kapitel hinzu, in dem er sich mit den Anpassungen und den neuen Ideen von Rawls auseinandersetzt.
Zwar wurde die Debatte zwischen Liberalen und Kommunitaristen von einigen Autoren bereits für nahezu beendet erklärt; jedoch ist Hartmut Rosa der Ansicht, dass gewichtige Argumente der kommunitaristischen Kritik am Liberalismus bis heute nicht widerlegt seien.
Sandel selbst weist zwar darauf hin, dass es Rawls gelungen sei, seine Kritik an Eine Theorie der Gerechtigkeit zu widerlegen, sich jedoch aus dieser Widerlegung in Politischer Liberalismus einige neue problematische Aspekte ergeben hätten. In der vorliegenden Arbeit soll daher beispielhaft die Kritik Sandels an Rawls‘ politischem Liberalismus vorgestellt und auf ihren Gehalt und ihre Plausibilität überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- John Rawls' Theorie des politischen Liberalismus
- Gerechtigkeit als Fairness
- Gerechtigkeitsgrundsätze
- Urzustand
- Vorrang des Rechten vor dem Guten
- Öffentlicher Vernunftgebrauch
- Gerechtigkeit als Fairness
- Michael Sandels Kritik am politischen Liberalismus
- Ausklammern gewichtiger moralischer Fragen
- Überlegungsgleichgewicht umfassender Lehren
- Restriktivität des öffentlichen Vernunftgebrauchs
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Kritik des Kommunitarismus am politischen Liberalismus, insbesondere am Werk des Philosophen John Rawls, und stellt dabei die Argumentation Michael Sandels heraus. Ziel ist es, die zentralen Kritikpunkte Sandels an Rawls' Konzept der Gerechtigkeit als Fairness darzulegen und deren Plausibilität zu untersuchen.
- Die Theorie der Gerechtigkeit als Fairness von John Rawls
- Der Einfluss von Gemeinschaftswerten auf die politische Philosophie
- Der Vorrang des Rechten vor dem Guten im politischen Liberalismus
- Die Bedeutung des öffentlichen Vernunftgebrauchs
- Die Grenzen der liberalen Gerechtigkeitskonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Werk von John Rawls und seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen des Rawlsschen politischen Liberalismus erläutert, inklusive der Gerechtigkeitsgrundsätze, des Urzustands, des Vorrangs des Rechten vor dem Guten und des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Das dritte Kapitel widmet sich der Kritik von Michael Sandel an Rawls, insbesondere an dessen Ausklammern gewichtiger moralischer Fragen, dem Überlegungsgleichgewicht umfassender Lehren und der Restriktivität des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Der letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die zentrale Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus, insbesondere im Kontext der politischen Philosophie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gerechtigkeit als Fairness, politische Philosophie, John Rawls, Michael Sandel, Liberalismus, Kommunitarismus, öffentlicher Vernunftgebrauch, Gemeinschaftswerte.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Michael Sandel an der Theorie von John Rawls?
Sandel kritisiert insbesondere das Ausklammern gewichtiger moralischer Fragen und die Restriktivität des öffentlichen Vernunftgebrauchs in Rawls' politischem Liberalismus.
Was bedeutet "Gerechtigkeit als Fairness" bei John Rawls?
Es handelt sich um eine liberale Konzeption von Gerechtigkeit, die Rawls als Alternative zum Utilitarismus entwickelte und die auf Prinzipien basiert, die in einem fairen Urzustand gewählt würden.
Warum überarbeitete Rawls sein Werk "A Theory of Justice"?
Rawls reagierte auf die kommunitaristische Kritik, seine Theorie sei „kontextvergessen“, und passte sie in seinem zweiten Hauptwerk "Politischer Liberalismus" an den Kontext moderner demokratischer Verfassungsstaaten an.
Was ist der zentrale Punkt der Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus?
Die Debatte dreht sich primär um den Vorrang des Rechten vor dem Guten und die Frage, wie stark Gemeinschaftswerte in der politischen Philosophie berücksichtigt werden müssen.
Was ist der "öffentliche Vernunftgebrauch"?
Dies ist ein Konzept von Rawls, das beschreibt, wie Bürger in einer demokratischen Gesellschaft über grundlegende politische Fragen auf der Basis gemeinsamer politischer Werte diskutieren sollten.
- Quote paper
- Florian Wollenschein (Author), 2012, Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus am Beispiel von Sandels Kritik an Rawls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190848