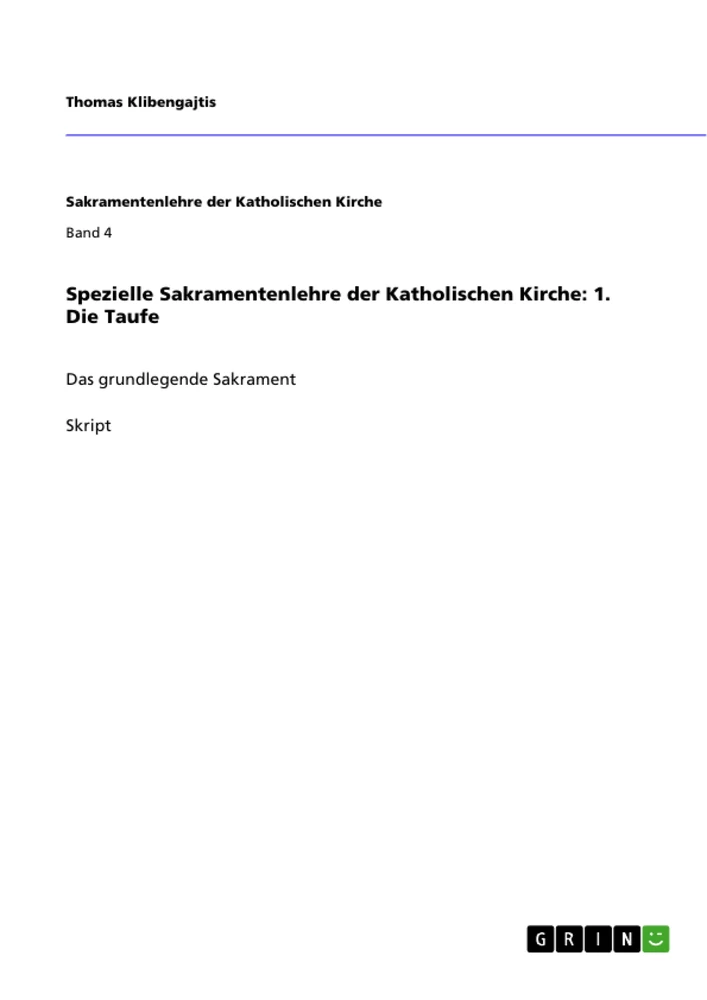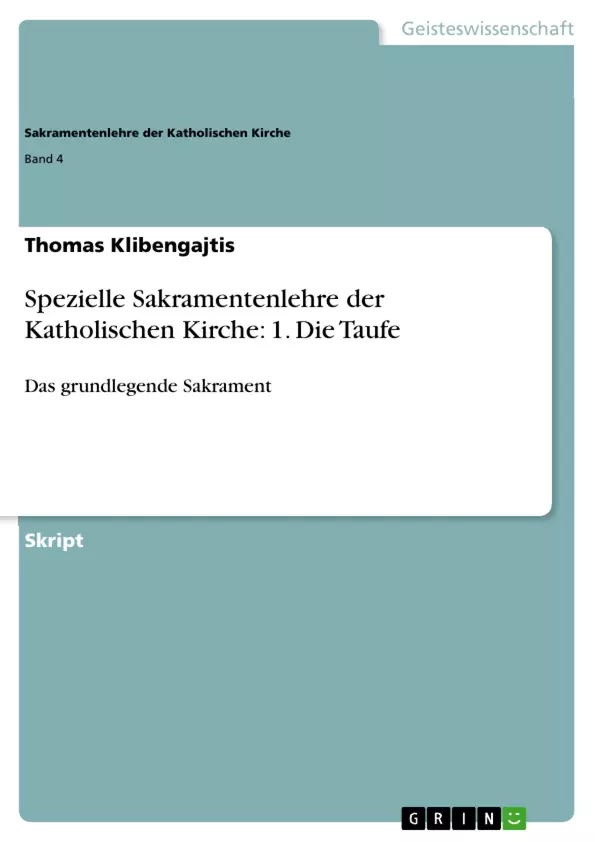Im ersten Teil der speziellen Sakramentenlehre wird die Taufe vorgestellt. Biblisch fundiert, patristisch erläutert und ökumenisch relevant. Eine allgemeinverständliche Darstellung für Theologiestudenten und theologisch Interessierte, welche nach Rechtfertigung und Untermauerung ihres Glaubens suchen.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegendes
- Vorbilder der christlichen Taufe im Heidentum und Judentum
- Mysterien
- Beschneidung
- Johannestaufe
- Taufe Jesu
- Einsetzung der Taufe durch Jesus und ihre Biblische Grundlegung
- Einsetzung der Taufe durch Jesus
- Biblische Grundlegung der Taufe
- Materie und Form der Taufe
- Materie der Taufe
- Form der Taufe
- Wirkungen der Taufe
- Wirkungen für den Einzelnen
- Wirkungen für die kirchliche Gemeinschaft
- Heilsnotwendigkeit der Taufe
- Spender der Taufe
- Empfänger der Taufe
- Katechumenat
- Kindertaufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch beleuchtet die Lehre der katholischen Kirche zur Taufe als grundlegendes Sakrament. Es analysiert die biblische Grundlage der Taufe und ihre Einsetzung durch Jesus sowie die Materie und Form des Sakraments. Des Weiteren werden die Wirkungen der Taufe für den Einzelnen und die kirchliche Gemeinschaft, die Heilsnotwendigkeit der Taufe und die verschiedenen Formen der Taufspeicherung untersucht.
- Biblische Grundlage der Taufe
- Einsetzung der Taufe durch Jesus
- Materie und Form der Taufe
- Wirkungen der Taufe für den Einzelnen und die Kirche
- Heilsnotwendigkeit der Taufe
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit den Vorbildern der christlichen Taufe im Heidentum und Judentum. Es werden die Mysterien der Antike, die Beschneidung im Judentum und die Johannestaufe als Vorbilder der christlichen Taufe beleuchtet.
- Das zweite Kapitel untersucht die Einsetzung der Taufe durch Jesus und die biblische Grundlegung des Sakraments.
- Kapitel drei beschäftigt sich mit der Materie und Form der Taufe. Es analysiert die Bedeutung des Wassers als Element der Taufe und die unterschiedlichen Formen der Taufspendung.
- Im vierten Kapitel werden die Wirkungen der Taufe für den Einzelnen und die kirchliche Gemeinschaft betrachtet. Es werden die heilende und heiligende Wirkung der Taufe sowie die Bedeutung der Taufe für die Gemeinschaft der Christen analysiert.
- Kapitel fünf beleuchtet die Heilsnotwendigkeit der Taufe.
- Das sechste Kapitel behandelt die Spender der Taufe.
- Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit den Empfängern der Taufe. Es werden das Katechumenat und die Kindertaufe erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Taufe, Sakrament, Mysterien, Beschneidung, Johannestaufe, Einsetzung, Materie, Form, Wirkungen, Heilsnotwendigkeit, Spender, Empfänger, Katechumenat, Kindertaufe. Darüber hinaus werden wichtige Themen wie die biblische Grundlage der Taufe, die Bedeutung des Wassers und die heilende Wirkung der Taufe behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die biblische Grundlage der Taufe?
Die Taufe basiert auf dem Missionsbefehl Jesu und seiner eigenen Taufe durch Johannes im Jordan. Sie wird als Einsetzung durch Christus selbst verstanden.
Was sind die „Materie“ und die „Form“ der Taufe?
Die Materie ist natürliches Wasser. Die Form sind die begleitenden Worte: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“.
Welche Wirkungen hat die Taufe für den Einzelnen?
Sie bewirkt die Vergebung der Erbsünde und aller persönlichen Sünden, die Wiedergeburt als Kind Gottes und die Einprägung eines unverlierbaren geistlichen Merkmals.
Wer kann die Taufe spenden?
Ordentliche Spender sind Bischöfe, Priester und Diakone. Im Notfall kann jedoch jeder Mensch (auch ein Nichtgetaufter) die Taufe gültig spenden, sofern er die Absicht der Kirche teilt.
Gibt es Vorbilder der Taufe im Judentum?
Ja, die Arbeit nennt unter anderem die Beschneidung als Zeichen des Bundes und die Johannestaufe als Bußritus als wichtige Vorläufer der christlichen Taufe.
- Quote paper
- Dr. phil. Mag. theol. Thomas Klibengajtis (Author), 2008, Spezielle Sakramentenlehre der Katholischen Kirche: 1. Die Taufe , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190988