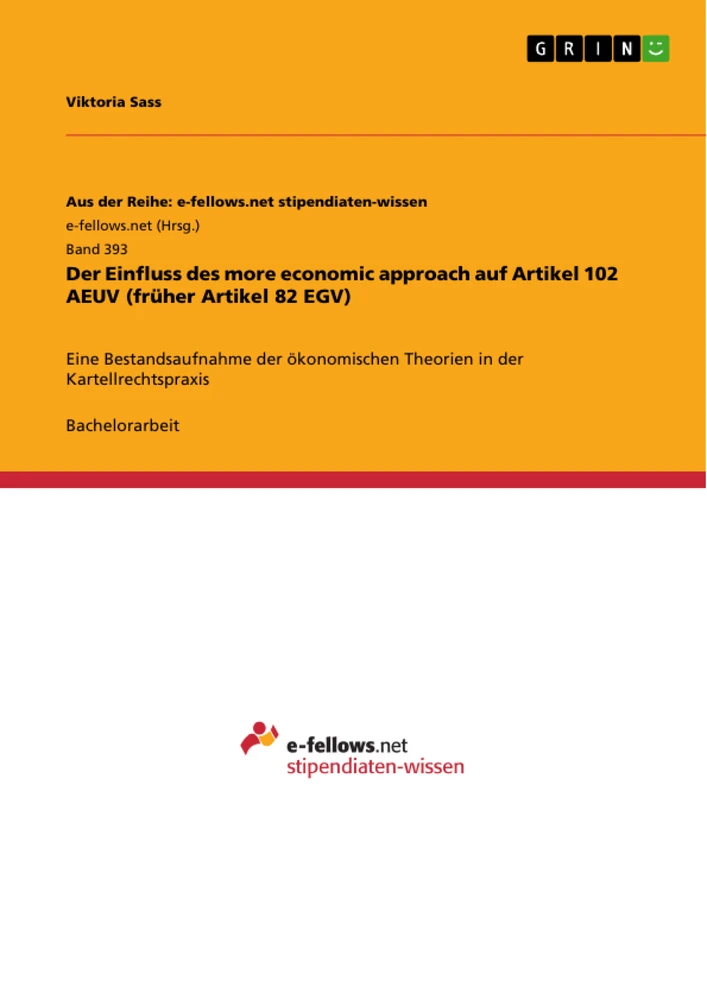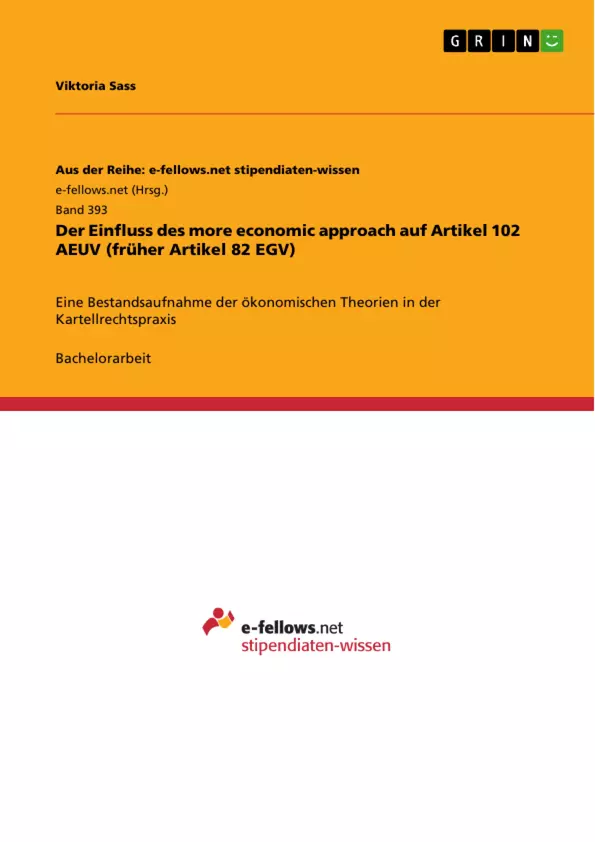Nach Art. 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(im Folgenden: AEUV) ist die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten.
Damit fügt sich Art. 102 AEUV, die Grundlage der Missbrauchsaufsicht in
der Europäischen Union, als dritte Säule der europäischen Wettbewerbspolitik
– neben dem Kartellverbot und der Fusionskontrolle – in ein System aus
Wettbewerbsregeln ein, welches das Ziel hat, einen freien Wettbewerb im
Binnenmarkt zu gewährleisten.
In Bezug auf Artikel 102 AEUV wurde ab dem Jahr 2005 durch die Organe
der Europäischen Union, insbesondere die Kommission, ein weit reichender
Reformprozess angestoßen: der sog. „more economic approach“, der nach
dem lange praktizierten verhaltensorientierten Ansatz mit seinen per se-
Verboten nun ökonomische Analysen ermöglichen soll, die den positiven
wie negativen Auswirkungen der missbräuchlichen Verhaltensweisen Rechnung
tragen und die die Qualität der Entscheidungen verbessern.
Theorie und Praxisbezug des more economic approach in Bezug auf Art.
102 AEUV zu untersuchen, ist Gegenstand dieser Arbeit. Dazu werden in
Kapitel 2 zunächst eine kurze rechtliche Einführung in den Art. 102 AEUV
gegeben und die Kernelemente des more economic approach beschrieben.
Anschließend werden in Kapitel 3 zwei der wichtigsten potenziell missbräuchlichen
Verhaltensweisen von marktbeherrschenden Unternehmen
ökonomisch untersucht: Ausschließlichkeitsbindungen und Rabatte, wobei
letztere den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden. Darauf aufbauend erfolgt
eine Bestandsaufnahme der ökonomischen Theorien in der jüngeren Entscheidungspraxis:
Es wird überprüft, ob und inwiefern die Europäische
Kommission in den jüngsten Entscheidungen nach Anstoß des Reformprozesses
tatsächlich ökonomische Modelle bei ihrer Argumentation zu Grunde
gelegt hat. Schließlich erfolgt eine zusammenfassende Beurteilung, in welcher
der Reformprozess in Bezug auf die jüngere Entscheidungspraxis noch einmal reflektiert wird. Wie sich zeigen wird, bringt der more economic
approach noch einige Nachteile und Schwierigkeiten bei der Umsetzung mit
sich und die Kommission hat die bisherige Entscheidungspraxis auch noch
nicht gänzlich außer Acht gelassen. Allerdings hat sie in den jüngeren Entscheidungen
tatsächlich schon viele Elemente des more economic approach
eingearbeitet und lässt somit den Beginn einer neuen Herangehensweise
erkennen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Art. 102 AEUV und der „more economic approach“
- 2.1 Rechtsgrundlage: Art. 102 AEUV
- 2.1.1 Bedeutung
- 2.1.2 Marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens
- 2.1.3 Missbrauch
- 2.1.3.1 Begriff
- 2.1.3.2 Einzelne Tatbestandsgruppen
- 2.2 Der „,more economic approach“
- 2.2.1 Entwicklung und Ziele
- 2.2.2 Merkmale
- 3 Ausschließlichkeitsbindungen und Rabatte - Ökonomie und Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission
- 3.1 Ökonomische Analyse
- 3.1.1 Ausschließlichkeitsbindungen
- 3.1.2 Rabatte
- 3.1.2.1 Verschiedene Rabattformen
- 3.1.2.2 Wettbewerbsschädliche Wirkungen
- 3.1.2.3 Wettbewerbsförderliche Wirkungen
- 3.2 Entscheidungspraxis der Kommission
- 3.2.1 Ausschließlichkeitsbindungen
- 3.2.2 Rabatte
- 3.2.2.1 Feststellung einer wettbewerbswidrigen Marktverschließung
- 3.2.2.2 Objektive Rechtfertigungsgründe und Effizienzgewinne
- 3.2.2.3 Vergleich mit der älteren Kartellrechtspraxis und deren Kritik
- 3.3 Zusammenfassende Beurteilung
- 4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss des „more economic approach“ auf Art. 102 AEUV, früher bekannt als Artikel 82 EGV, und untersucht die ökonomischen Theorien in der Kartellrechtspraxis. Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der ökonomischen Analyse im Kartellrecht zu vermitteln und die praktische Anwendung des „more economic approach“ in der Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission zu beleuchten.
- Die Bedeutung von Art. 102 AEUV im europäischen Wettbewerbsrecht
- Die Entwicklung und Ziele des „more economic approach“
- Die ökonomischen Aspekte von Ausschließlichkeitsbindungen und Rabattpraktiken
- Die praktische Anwendung des „more economic approach“ durch die Europäische Kommission
- Die Kritik an der Anwendung des „more economic approach“ im Kartellrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Rechtsgrundlage des Art. 102 AEUV dar, einschließlich seiner Bedeutung, der marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens und des Begriffs des Missbrauchs. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem „more economic approach“ und beleuchtet dessen Entwicklung, Ziele und Merkmale. Das dritte Kapitel analysiert die ökonomischen Auswirkungen von Ausschließlichkeitsbindungen und Rabattpraktiken, wobei sowohl die wettbewerbswidrigen als auch die wettbewerbsförderlichen Wirkungen beleuchtet werden. Anschließend wird die Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission in Bezug auf diese Praktiken vorgestellt und die Anwendung des „more economic approach“ im Detail analysiert. Schließlich werden die Erkenntnisse des dritten Kapitels zusammengefasst und bewertet.
Schlüsselwörter
Art. 102 AEUV, Kartellrecht, „more economic approach“, Wettbewerbsrecht, ökonomische Analyse, Ausschließlichkeitsbindungen, Rabatte, Europäische Kommission, Marktbeherrschung, Missbrauch, wettbewerbswidrige Praktiken, wettbewerbsförderliche Wirkungen, Entscheidungspraxis
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Artikel 102 AEUV?
Artikel 102 AEUV verbietet die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen innerhalb des EU-Binnenmarktes.
Was ist der „more economic approach“?
Dies ist ein Reformprozess im EU-Wettbewerbsrecht, der weg von starren Verboten hin zu detaillierten ökonomischen Analysen führt, um die tatsächlichen Auswirkungen von Verhalten auf den Markt zu bewerten.
Wie werden Rabattsysteme ökonomisch bewertet?
Es wird zwischen wettbewerbsschädlichen (Marktverschließung) und wettbewerbsförderlichen Wirkungen (Effizienzgewinne) unterschieden, anstatt Rabatte pauschal als Missbrauch einzustufen.
Welche Rolle spielen Ausschließlichkeitsbindungen?
Diese Bindungen verpflichten Abnehmer, ihren Bedarf nur beim marktbeherrschenden Unternehmen zu decken; der more economic approach prüft hierbei die konkrete Gefahr einer wettbewerbswidrigen Marktverschließung.
Wendet die Europäische Kommission den neuen Ansatz konsequent an?
Die Arbeit zeigt, dass die Kommission in jüngeren Entscheidungen zwar viele ökonomische Elemente eingearbeitet hat, die bisherige Praxis aber noch nicht gänzlich aufgegeben wurde.
Was sind objektive Rechtfertigungsgründe im Kartellrecht?
Ein Unternehmen kann ein potenziell missbräuchliches Verhalten rechtfertigen, wenn es nachweist, dass dadurch erhebliche Effizienzgewinne entstehen, die auch den Verbrauchern zugutekommen.
- Citation du texte
- Viktoria Sass (Auteur), 2010, Der Einfluss des more economic approach auf Artikel 102 AEUV (früher Artikel 82 EGV), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190997