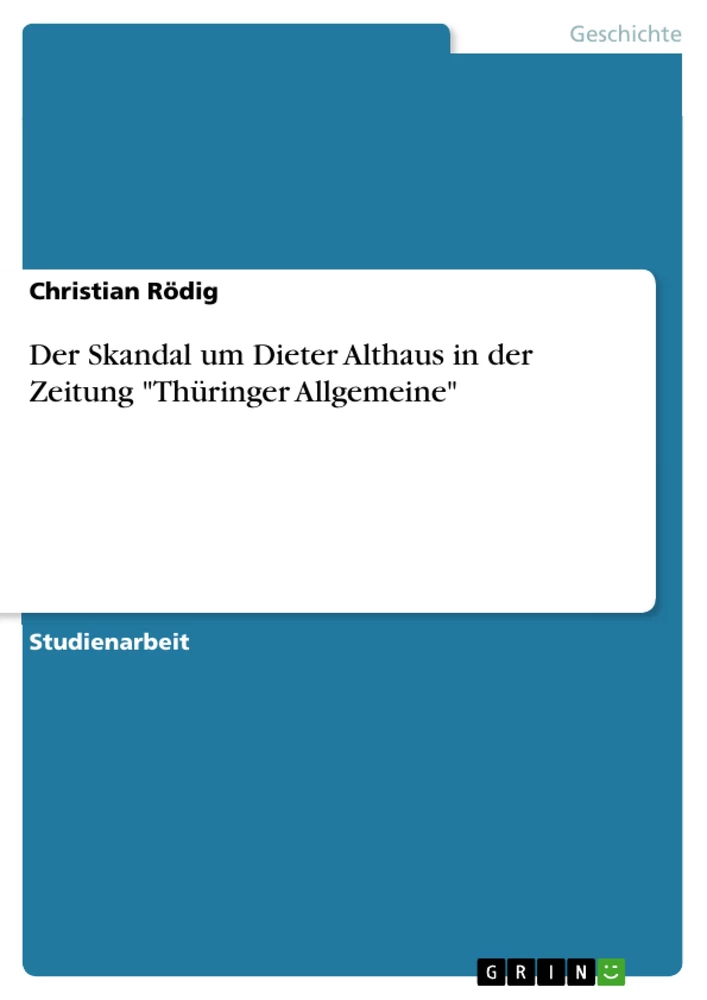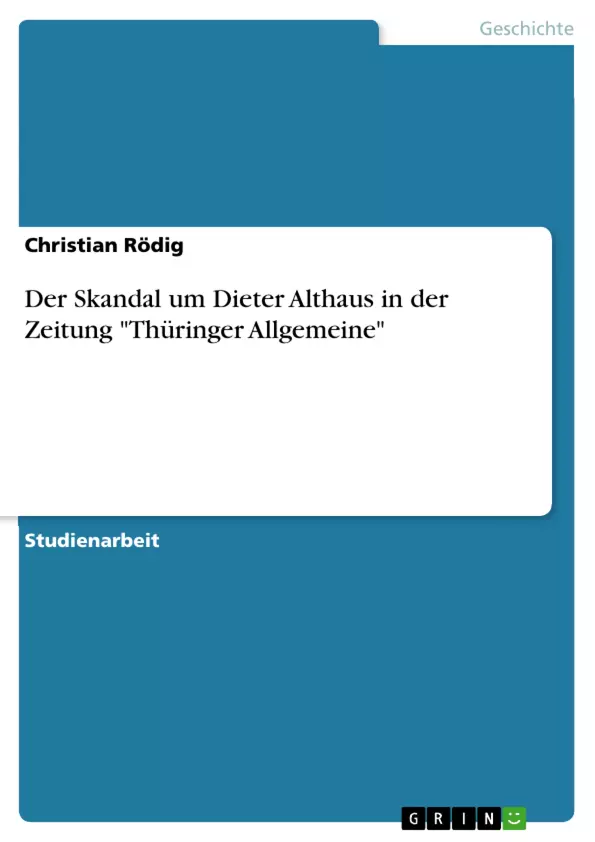Medienwissenschaftliche Untersuchung zum Unfall des ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus, anhand empirischer Beispiele aus der "Thüringer Allgemeinen Zeitung".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Skandalkonglomerat
- 3. Die Berichterstattung in der „Thüringer Allgemeinen“
- 3.1 Der Unfall
- 3.2 Die Verurteilung
- 3.3 Zwischen Tabuisierung und Eigennutz: Der Umgang Althaus' mit der Presse
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Skandal um Dieter Althaus, den ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens, und seine Darstellung in der „Thüringer Allgemeinen“. Ziel ist es, die Entwicklung des Skandals anhand der Berichterstattung der Zeitung nachzuvollziehen und zu analysieren, welche Schwerpunkte gesetzt wurden und welche Haltung die Zeitung einnahm. Die Arbeit beleuchtet einen Skandal, der zwar bundesweit bekannt wurde, aber vor allem auf regionaler Ebene von Bedeutung war.
- Die Konstruktion des „Skandalkonglomerats“ Althaus aus verschiedenen Ereignissen
- Die Berichterstattung der „Thüringer Allgemeinen“ und ihre Rolle in der Skandalentwicklung
- Die Anwendung von Theorien der Skandalforschung auf den Fall Althaus
- Der Vergleich zwischen regionaler und überregionaler Berichterstattung
- Die Bedeutung des Skandals im Kontext der regionalen Politik Thüringens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Skandals um Dieter Althaus ein und begründet die Wahl dieses Fallbeispiels. Der Fokus liegt auf der Analyse der Berichterstattung der „Thüringer Allgemeinen“, da diese Zeitung regional von großer Bedeutung war und somit einen differenzierten Blick auf den Skandal ermöglichen kann. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung des Skandals in der Zeitung und dessen Entwicklung. Der Autor betont die Notwendigkeit, den „Skandal“ als ein Konglomerat aus verschiedenen Ereignissen zu verstehen, die in ihrer Gesamtheit den Skandal ausmachen.
2. Das Skandalkonglomerat: Dieses Kapitel identifiziert die drei zentralen Ereignisse, die den „Skandalkonglomerat Althaus“ bilden: den Skiunfall, die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und Althaus' Umgang mit den Medien, insbesondere der „Bild“-Zeitung. Es wird diskutiert, welche Aspekte dieser Ereignisse Skandalpotenzial besitzen und wie sie im Kontext der Skandalforschung einzuordnen sind. Der Autor bezieht sich auf Steffen Burkhardt und dessen Theorie zur Skandalisierung, wobei er diese teilweise kritisch hinterfragt und erweitert.
3. Die Berichterstattung in der „Thüringer Allgemeinen“: Dieses Kapitel analysiert die Berichterstattung der „Thüringer Allgemeinen“ über den Skandal um Dieter Althaus. Es beschreibt die Darstellung des Unfalls, der Verurteilung und des Medienumgangs des Politikers. Der Umgang der Zeitung mit der Thematik wird detailliert untersucht und die Haltung der Redaktion wird im Kontext der regionalen und politischen Lage Thüringens erläutert. Es wird im Detail der Umgang mit dem Ereignis, der juristischen Verurteilung sowie der Kritik an den Interviews in der Bild-Zeitung analysiert.
Schlüsselwörter
Dieter Althaus, Thüringer Allgemeine, Medienskandal, Skandalforschung, Regionalzeitung, Politik, Fahrlässige Tötung, Skiunfall, Medienberichterstattung, politische Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der Skandal um Dieter Althaus in der Thüringer Allgemeinen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert den Skandal um den ehemaligen Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus und dessen Darstellung in der „Thüringer Allgemeinen“. Sie untersucht die Berichterstattung der Zeitung über den Skandal und die Rolle der Zeitung in dessen Entwicklung.
Welche Ereignisse bilden den Kern des „Skandalkonglomerats“ Althaus?
Der „Skandalkonglomerat Althaus“ setzt sich aus drei zentralen Ereignissen zusammen: dem Skiunfall, der Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und Althaus' Umgang mit den Medien, insbesondere der „Bild“-Zeitung. Diese Ereignisse werden in der Arbeit einzeln betrachtet und hinsichtlich ihres Skandalpotentials analysiert.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Althaus-Skandals anhand der Berichterstattung der „Thüringer Allgemeinen“ nachzuvollziehen. Dabei wird analysiert, welche Schwerpunkte die Zeitung setzte, welche Haltung sie einnahm und wie die regionale Berichterstattung im Vergleich zur überregionalen Berichterstattung ausfiel. Die Bedeutung des Skandals für die regionale Politik Thüringens wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Theorien werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Theorien der Skandalforschung, insbesondere auf die Theorie der Skandalisierung von Steffen Burkhardt. Diese Theorie wird jedoch teilweise kritisch hinterfragt und erweitert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum „Skandalkonglomerat“, ein Kapitel zur Berichterstattung der „Thüringer Allgemeinen“ (unterteilt in die Aspekte Unfall, Verurteilung und Medienumgang) und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die „Thüringer Allgemeine“ in der Analyse?
Die „Thüringer Allgemeine“ steht im Mittelpunkt der Analyse, da sie als regionale Zeitung einen differenzierten Blick auf den Skandal ermöglicht und regionale Bedeutung hatte. Die Arbeit untersucht detailliert, wie die Zeitung den Unfall, die Verurteilung und Althaus' Medienumgang darstellte und welche Haltung die Redaktion einnahm.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dieter Althaus, Thüringer Allgemeine, Medienskandal, Skandalforschung, Regionalzeitung, Politik, Fahrlässige Tötung, Skiunfall, Medienberichterstattung, politische Verantwortung.
- Quote paper
- B.A. Christian Rödig (Author), 2011, Der Skandal um Dieter Althaus in der Zeitung "Thüringer Allgemeine", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192394