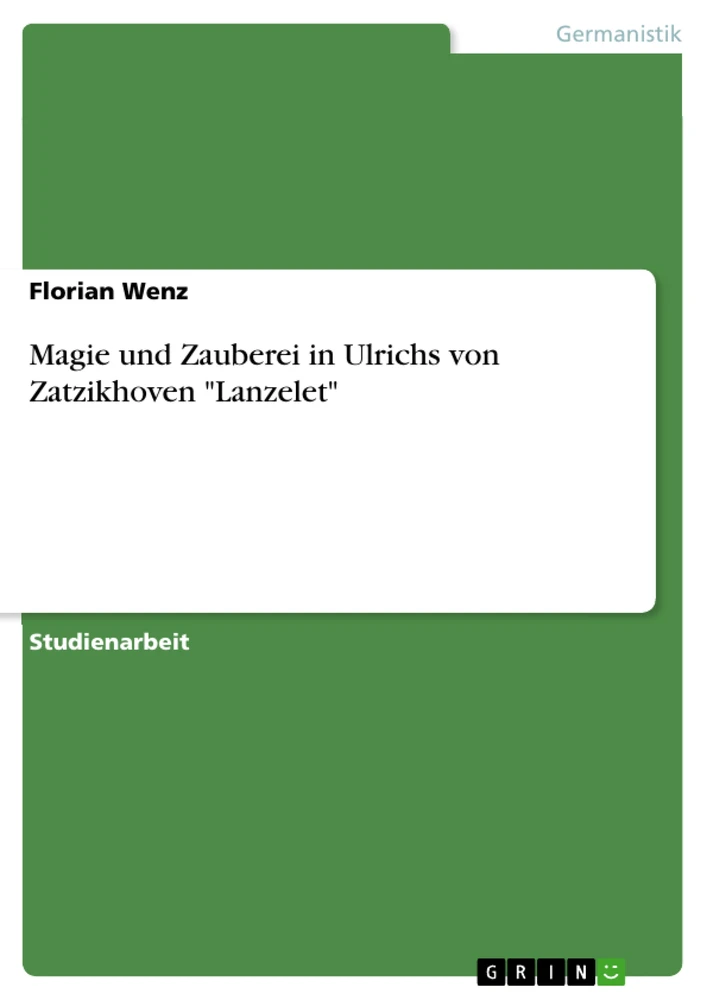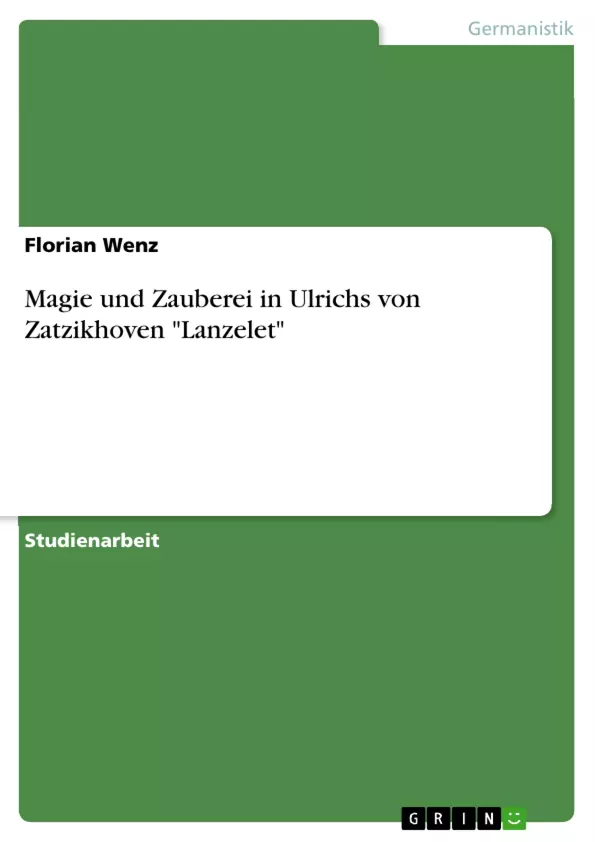Der erste Teil dieser Arbeit wird sich mit dem Begriff der Magie befassen, die geschichtliche Entwicklung bis zum 12. Jahrhundert darstellen und Unterscheidungsmöglichkeiten für die damalige Magie präsentieren. Auch auf das Magieverständnis in der höfischen Kultur wird eingegangen, da Werke wie der „Lanzelet“ ursprünglich und hauptsächlich für ein höfisches Publikum geschrieben wurden. Mit dieser historischen Grundlage im Rücken, befasst sich der zweite Teil dann explizit mit der Magie im „Lanzelet“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Magie und Zauberei
- Zum Begriff
- Geschichte der Magie bis zum Mittelalter
- Unterscheidungsmöglichkeiten
- Magie in der höfischen Kultur des Mittelalters
- Magie im Lanzelet
- Magische Personen
- Malduc
- Elidîâ
- Magische Orte
- Mâbûz auf Schatel le mort
- Wahsende warte
- Magische Gegenstände
- Der Mantel
- Das Minnezelt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Magie im mittelhochdeutschen Werk „Lanzelet“ von Ulrich von Zatzikhoven. Ziel ist es, die im Text präsentierten magischen Elemente im Kontext des mittelalterlichen Magieverständnisses zu analysieren und deren Funktion innerhalb der Erzählung zu beleuchten. Dabei wird der historische Hintergrund berücksichtigt, um die Rezeption und die Bedeutung der Magie im Werk besser zu verstehen.
- Der Begriff der Magie im Mittelalter
- Die historische Entwicklung des Magieverständnisses
- Unterschiede und Kategorien mittelalterlicher Magie
- Die Rolle der Magie in der höfischen Kultur
- Die Darstellung von Magie im „Lanzelet“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des historischen Kontextes für das Verständnis der Magie im „Lanzelet“. Sie beschreibt den Wandel des Magieverständnisses vom Mittelalter bis zur Gegenwart und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in einen historischen Teil und einen Teil zur Analyse des „Lanzelet“ gliedert. Die Einleitung hebt die Allgegenwart des Glaubens an Magie im Mittelalter hervor und betont die Notwendigkeit, diesen Glauben zu verstehen, um die Darstellung der Magie im „Lanzelet“ adäquat zu interpretieren.
Magie und Zauberei: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Magie im Mittelalter und dessen vielschichtige Entwicklung. Es beschreibt die Magie als eine Mischung aus antiken Traditionen (persisch, babylonisch, ägyptisch), germanischen und keltischen Einflüssen und einheimischen Volkstraditionen. Das Kapitel beleuchtet die Unklarheit des Begriffs und die damit verbundenen Missverständnisse und den negativen Beigeschmack. Es skizziert die Einteilung der Magie in verschiedene Kategorien wie schwarze und weiße Magie oder himmlische und zeremonielle Magie, die zeigen, wie komplex und vielseitig das mittelalterliche Verständnis von Magie war. Die Entwicklung des Denkens über Magie vom 13. Jahrhundert an wird ebenfalls behandelt.
Magie im Lanzelet: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Darstellung von Magie in Ulrichs von Zatzikhoven's „Lanzelet“. Es untersucht die magischen Personen, Orte und Gegenstände im Werk und analysiert deren Rolle in der Erzählung. Die Untersuchung wird exemplarisch an ausgewählten Textstellen durchgeführt und konzentriert sich auf die Funktion der magischen Elemente innerhalb der Handlung und deren Einfluss auf die Figuren und die narrative Entwicklung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Zauberei, das der Leser durch die Darstellung im „Lanzelet“ vermittelt bekommt.
Schlüsselwörter
Magie, Zauberei, Mittelalter, Lanzelet, Ulrich von Zatzikhoven, höfische Kultur, Magieverständnis, magische Personen, magische Orte, magische Gegenstände, Naturmagie, schwarze Magie, weiße Magie.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Lanzelet" und der Darstellung von Magie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Magie im mittelhochdeutschen Werk „Lanzelet“ von Ulrich von Zatzikhoven. Sie untersucht die im Text präsentierten magischen Elemente im Kontext des mittelalterlichen Magieverständnisses und deren Funktion innerhalb der Erzählung. Der historische Hintergrund wird berücksichtigt, um die Rezeption und Bedeutung der Magie im Werk besser zu verstehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Magie im Mittelalter, die historische Entwicklung des Magieverständnisses, Unterschiede und Kategorien mittelalterlicher Magie, die Rolle der Magie in der höfischen Kultur, sowie die spezifische Darstellung von Magie in „Lanzelet“, inklusive magischer Personen, Orte und Gegenstände.
Welche Aspekte der Magie im "Lanzelet" werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die magischen Personen (z.B. Malduc, Elidîâ), Orte (z.B. Mâbûz auf Schatel le mort, Wahsende warte) und Gegenstände (z.B. der Mantel, das Minnezelt) im „Lanzelet“. Es wird untersucht, welche Rolle diese Elemente in der Erzählung spielen und wie sie die Handlung, Figuren und narrative Entwicklung beeinflussen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Magie und Zauberei im Mittelalter, ein Kapitel zur Magie im „Lanzelet“ und ein Fazit. Die Einleitung erläutert den historischen Kontext und den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel über Magie und Zauberei analysiert den Begriff, die historische Entwicklung und verschiedene Kategorien der Magie im Mittelalter. Das Kapitel über die Magie im „Lanzelet“ untersucht die spezifische Darstellung im Werk.
Welchen historischen Kontext berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit berücksichtigt den Wandel des Magieverständnisses vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie beschreibt Magie als eine Mischung aus antiken Traditionen (persisch, babylonisch, ägyptisch), germanischen und keltischen Einflüssen und einheimischen Volkstraditionen. Die Unklarheit des Begriffs und die damit verbundenen Missverständnisse, sowie die Einteilung in verschiedene Kategorien (schwarze und weiße Magie etc.) werden beleuchtet. Die Entwicklung des Denkens über Magie ab dem 13. Jahrhundert wird ebenfalls behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Magie, Zauberei, Mittelalter, Lanzelet, Ulrich von Zatzikhoven, höfische Kultur, Magieverständnis, magische Personen, magische Orte, magische Gegenstände, Naturmagie, schwarze Magie, weiße Magie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Darstellung von Magie im „Lanzelet“ im Kontext des mittelalterlichen Magieverständnisses zu analysieren und deren Funktion innerhalb der Erzählung zu beleuchten. Es geht darum, die Rezeption und Bedeutung der Magie im Werk zu verstehen.
- Citation du texte
- Dipl. Germ. Florian Wenz (Auteur), 2008, Magie und Zauberei in Ulrichs von Zatzikhoven "Lanzelet", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192721