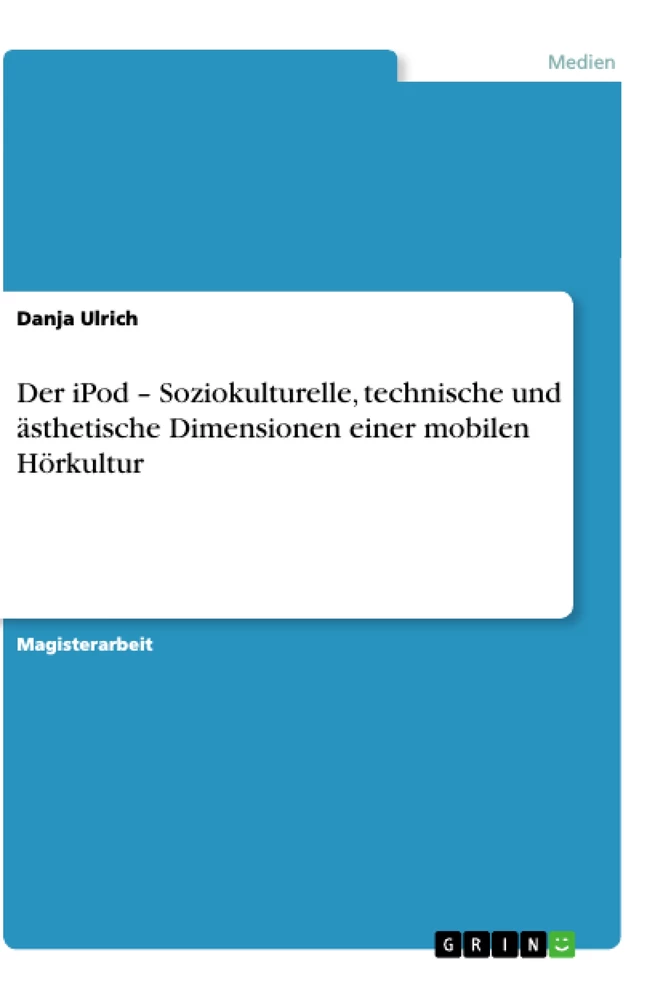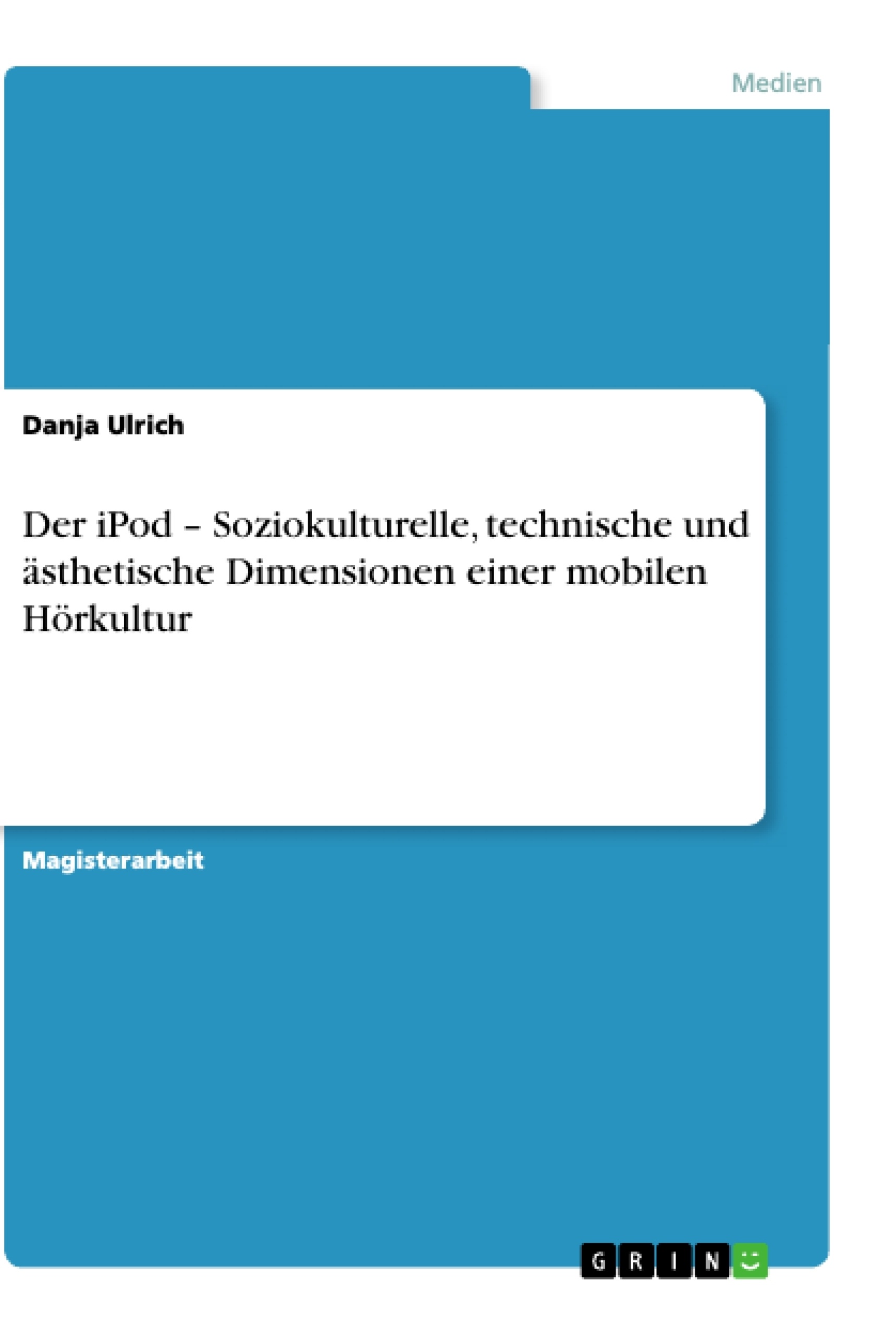„Es müsste einfach immer Musik da sein, bei allem was du machst“ sagt Floyd 1998 im Film Absolute Giganten. Was damals als romantische Idee erscheint, ist knapp neun Jahre später Alltagsphänomen westlicher Kulturen. 2007 verkündet Apple den Verkauf des 100-millionsten iPod.1 Mobilisierter Musikkonsum ist angesichts dieser hohen Verkaufszahlen kein sub- oder jugendkulturelles Phänomen mehr, sondern avanciert vielmehr zu einem dominanten Hörmodus unserer Zeit.
Doch nicht nur das Musikhören unterwegs, auch der mobile Zugriff auf Internet und persönliche mediale Inhalte, sowie die Möglichkeit jederzeit und an jedem Ort Gespräche über das Telefon zu führen, entwickeln sich zu festen kulturellen Werten.2Technologien wie iPod, iPhone oder iPad sind dabei Ausdruck eines aktuellen weltumspannenden Mobilisierungsprozesses, bei dem vormals stationäre technische Artefakte zu mobilen Alltagsbegleitern avancieren. Analog zu dieser Entwicklung wird in der Literatur von einer „mobilen Revolution“3 oder gar vom Ausbruch eines „nomadischen Zeitalters“4 gesprochen. Der französische Philosoph und Medienkritiker Paul Virilio spricht vom „Zeitalter der allgemeinen Mobilmachung.“5 In dieser Ära des Nomadentums wird der Mensch nicht mehr heimatlos umherstreifen, sondern mit Hilfe von Medien bereits überall zuhause sein.6 Virilio prophezeit in diesem Sinne eine Zeit des „bewohnbaren Verkehrs“.7 Reinhard Olschanski weist darauf hin, dass die Mobilisierung von Technik weit reichende soziale Folgen haben wird, die bis in den Alltag stoßen.8 Auch Ulrich Dolata und Raymund Werle sprechen von „neuartigen Beziehungsmustern zwischen Mensch und Technik, die unsere Lebensweisen und Konsummuster beeinflussen.“9
Doch welche Folgen sind es, die mit der Nutzung mobiler Technologien für die Gesellschaft und den Alltag einhergehen? Welche sozialen und kulturellen Konsequenzen hat die Popularität einer Technologie wie der iPod oder eines internetfähigen Smartphones? Welche Folgen hat Mobilität für die Musik und ihre Rezeption?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Perspektivierung / Vorgehen
- 3. Soziokulturelle Dimension
- 3.1 Kulturkritik am Walkman
- 3.2 Shuhei Hosokwa: Der Walkman-Effekt
- 3.2.1 Das Wirkungs-Ereignis
- 3.2.2 Die integrative Funktion des Walkman
- 3.2.3 Kritik
- 3.3 Michael Bull: Sound Moves: Dialectic of 'mediated isolation'
- 3.3.1 These: Der iPod isoliert
- 3.3.1.1 Auditory Epistemology of urban Experience
- 3.3.1.2 The Concept of 'warm' and 'chilly'
- 3.3.2 Antithese: Der iPod verbindet
- 3.3.3 Synthese: Verbindung durch Isolation
- 3.3.4 Kritik
- 3.4 Zwischenfazit: Zwischen affirmativer und isolierender Distanz
- 4. Technische Dimension
- 4.1 Der iPod als materielle Kultur
- 4.2 Technikgeschichte: Die iPod-Generationen
- 4.3 iPod touch und iPhone
- 4.4 Applikationen
- 4.5 Archivierungskonzepte / Playlist-Generatoren
- 4.5.1 iTunes
- 4.5.2 Last.fm
- 4.5.3 mufin/Globalmusic2one
- 4.6 Zwischenfazit: Gemeinschaft durch Individualisierung
- 5. Ästhetische Dimension
- 5.1 Mobiler Hörmodus
- 5.2 Der mobile Hörer als Typ musikalischen Verhaltens
- 5.3 „Verdorbenes Gehör?“ Mobiles Hören zwischen Werk- und Wirkungsästhetik
- 5.4 Es schläft ein Lied in allen Dingen: Die Aisthetik Gernot Böhmes
- 5.4.1 Mobiles Hören und die Schaffung von Atmosphären
- 5.5 Sabine Sanios 'erweiterte Ästhetik' der Klangkunst
- 5.5.1 Und die Welt hebt an zu singen: Walkman-Effekt und Klangkunst
- 5.5.2 Die Performanz der ästhetischen Erfahrung
- 5.7 Zwischenfazit: Die ästhetische Qualität des Hörens
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit untersucht die soziokulturellen, technischen und ästhetischen Dimensionen des iPods als Ausdruck einer mobilen Hörkultur. Ziel ist es, die Bedeutung des iPods als kulturelles Phänomen zu beleuchten und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung von Musik und Medien in der heutigen Zeit zu analysieren.
- Der Einfluss des iPods auf die Kulturkritik am Walkman
- Die Auswirkungen des iPods auf die soziale Interaktion und Kommunikation
- Die technischen Entwicklungen und Innovationen im Zusammenhang mit dem iPod
- Die ästhetische Bedeutung des mobilen Hörens und der Einfluss des iPods auf die Wahrnehmung von Musik
- Die Rolle des iPods im Kontext der medialen Revolution und des „nomadischen Zeitalters“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den iPod als Phänomen der mobilen Hörkultur in den Kontext der „mobilen Revolution“ stellt und die Relevanz des Themas herausarbeitet. Kapitel 2 beschreibt die methodische Vorgehensweise und die Perspektivierung des Projekts. Kapitel 3 befasst sich mit der soziokulturellen Dimension des iPods und analysiert die Kulturkritik am Walkman, den „Walkman-Effekt“ nach Shuhei Hosokawa und die „mediated isolation“ nach Michael Bull. In Kapitel 4 wird die technische Dimension des iPods beleuchtet, wobei die materielle Kultur des Geräts, die Technikgeschichte der iPod-Generationen und die Funktionen von Applikationen und Archivierungskonzepten im Vordergrund stehen. Kapitel 5 widmet sich der ästhetischen Dimension des iPods und untersucht den mobilen Hörmodus, den mobilen Hörer als Typ musikalischen Verhaltens und die „erweiterte Ästhetik“ der Klangkunst.
Schlüsselwörter
iPod, mobile Hörkultur, Walkman-Effekt, mediated isolation, technische Dimension, ästhetische Dimension, Klangkunst, mobile Revolution, nomadisches Zeitalter, Kulturkritik, Interaktion, Kommunikation, Wahrnehmung, Medien, Musik.
- Arbeit zitieren
- M.A. Danja Ulrich (Autor:in), 2012, Der iPod – Soziokulturelle, technische und ästhetische Dimensionen einer mobilen Hörkultur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193335