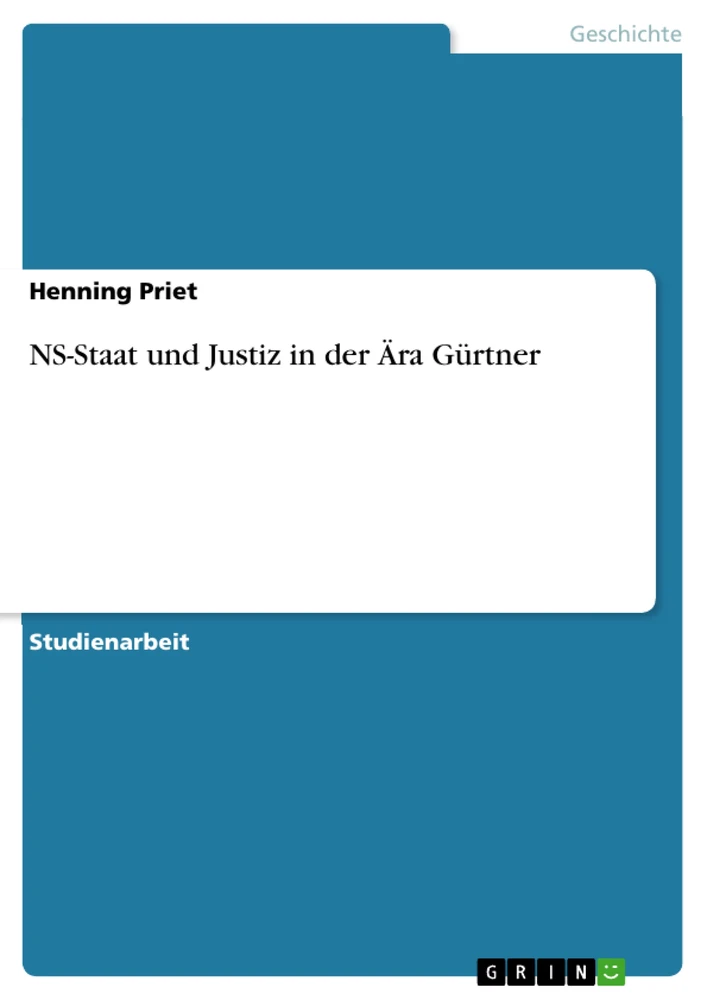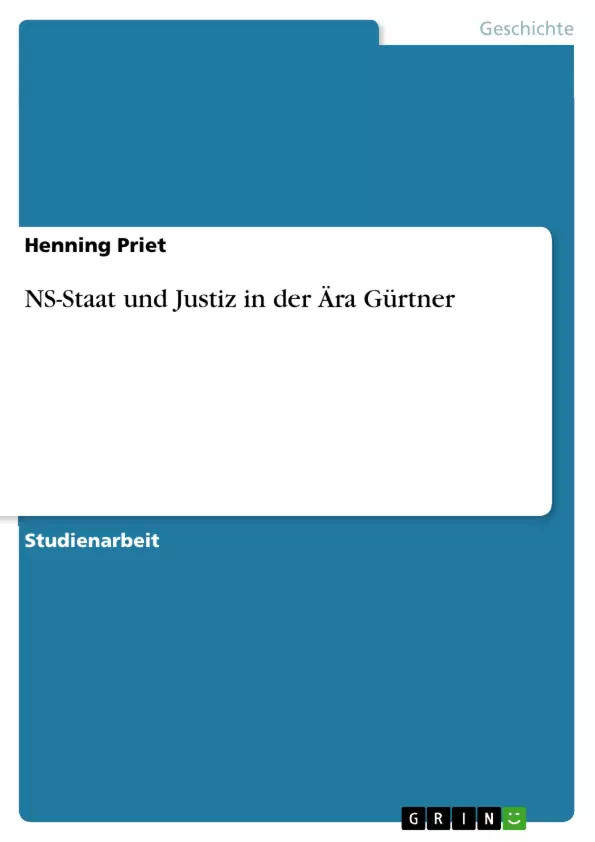Es wird zunächst ein Blick auf die NS-Gesetze geworfen, welche den legalistischen Rahmen aufzeigen, in welchem sich das interdependente Verhältnis von Justiz und NS-Staat entwickelte. In einem zweiten Schritt soll dann ein Blick auf die Erklärungsmuster geworfen werden, welche bisher in der historischen Forschung erarbeitet wurden, um das Verhalten der NS-Justiz zu erklären. Abschließend wird auf den Reichsjustizminister Franz Gürtner eingegangen, da in seiner Amtszeit (1932-1941), die Entscheidung fielen, welche dazu führten, dass die Justiziare unter dem späteren Minister Thierack zum Instrument der NS-Massenvernichtung wurden
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- NS-Gesetze zur Justiz
- Positionen in der historischen Forschung
- Das Reichsjustizministerium unter Gürtner
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Rolle der NS-Justiz in der Ära des Reichsjustizministers Franz Gürtner (1932-1941). Ziel ist es, das Verhältnis von Justiz und NS-Staat in dieser Zeit zu beleuchten und die These zu überprüfen, dass die NS-Justiz nicht aktiv gegen die Gleichschaltung durch die Gestapo kämpfte.
- Die Bedeutung von NS-Gesetzen für die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Justiz und NS-Staat
- Die Rolle der Juristenschaft im NS-Staat
- Die Entwicklung der NS-Justiz von 1933 bis 1941 unter Gürtner
- Die Frage, ob die Justiz ein Interesse hatte, die Fahne des Rechts aufrechtzuerhalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These der Hausarbeit vor, die besagt, dass die NS-Justiz nicht gegen die Gleichschaltung durch die Gestapo kämpfte. Der Autor begründet, warum er von dieser ursprünglichen These abweicht und die Arbeit in drei Teile gliedert: die Betrachtung von NS-Gesetzen, die Analyse der historischen Forschung und die Darstellung der Amtszeit Gürtners.
- NS-Gesetze zur Justiz: Dieses Kapitel beleuchtet die Gesetze, die im Untersuchungszeitraum erlassen wurden und einen entscheidenden Beitrag zum legalistischen Verhältnis zwischen NS-Staat und Justiz leisteten. Es werden Verordnungen zum Schutz des deutschen Volkes und zum Schutz von Volk und Staat, die Ermächtigung des Reichspräsidenten, das Gesetz zur Neuregelung der Todesstrafe und die Abschaffung des demokratischen Mehrparteienstaates analysiert.
- Positionen in der historischen Forschung: Dieses Kapitel stellt verschiedene Erklärungsmuster vor, die in der historischen Forschung entwickelt wurden, um das Verhalten der NS-Justiz zu erklären. Dabei wird auf die Bedeutung von „rassischen Diskriminierungsgesetzen“ für die Juristenschaft, die Rolle der „Märzgefallenen“ und die Interpretation von NS-Gesetzen als Mittel der Vertuschung hingewiesen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des NS-Staates wie Rechtsverständnis, Gleichschaltung, Justiz, Gestapo, NS-Gesetze, Reichsjustizministerium, Franz Gürtner, „rassische Diskriminierungsgesetze“ und der Rolle der Juristenschaft im NS-Staat.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Justiz in der Ära Gürtner?
Unter Reichsjustizminister Franz Gürtner (1932-1941) entwickelte sich ein interdependentes Verhältnis zwischen Justiz und NS-Staat, das den Weg für die spätere Instrumentalisierung der Justiz zur Massenvernichtung ebnete.
Wer war Franz Gürtner?
Franz Gürtner war der deutsche Reichsjustizminister von 1932 bis 1941. In seiner Amtszeit fielen entscheidende Weichenstellungen für die Radikalisierung des Rechtssystems im Nationalsozialismus.
Kämpfte die NS-Justiz gegen die Gleichschaltung durch die Gestapo?
Die historische Forschung setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob die Justiz aktiv Widerstand leistete. Die Arbeit untersucht die These, dass die Justiz kaum gegen die Übernahme von Befugnissen durch die Gestapo ankämpfte.
Welche NS-Gesetze veränderten das Rechtssystem maßgeblich?
Zentral waren Verordnungen zum Schutz von Volk und Staat, das Gesetz zur Neuregelung der Todesstrafe sowie rassistische Diskriminierungsgesetze, die den legalistischen Rahmen für das NS-Unrecht schufen.
Was bedeutete der Begriff "Märzgefallene" im Kontext der Juristenschaft?
Der Begriff bezieht sich auf Juristen, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1933 der NSDAP beitraten, oft aus opportunistischen Gründen oder um ihre Karriere zu sichern.
- Quote paper
- Master of Arts Henning Priet (Author), 2008, NS-Staat und Justiz in der Ära Gürtner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193803