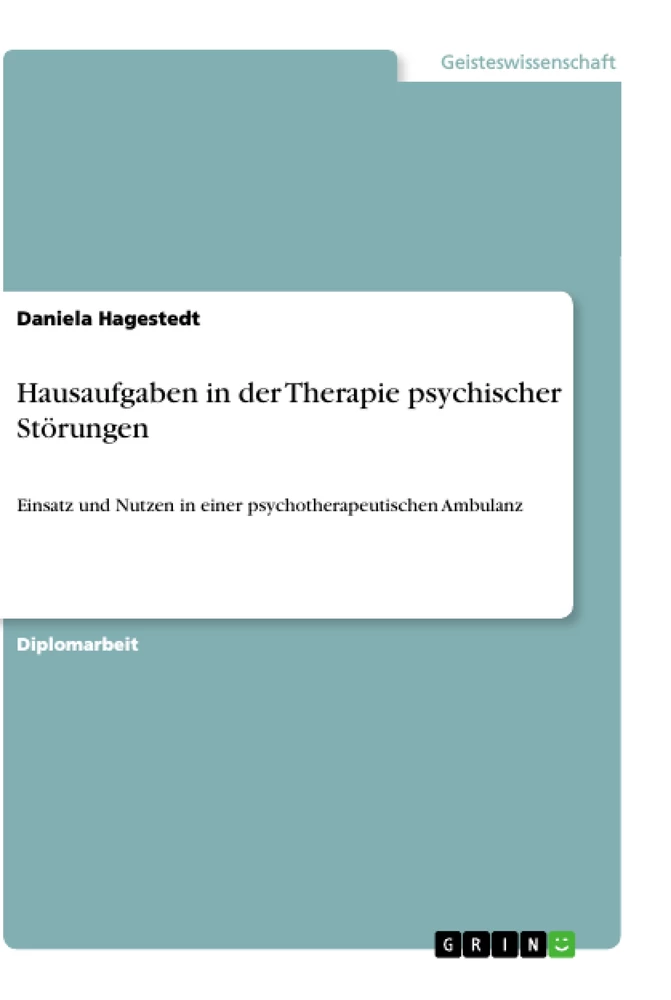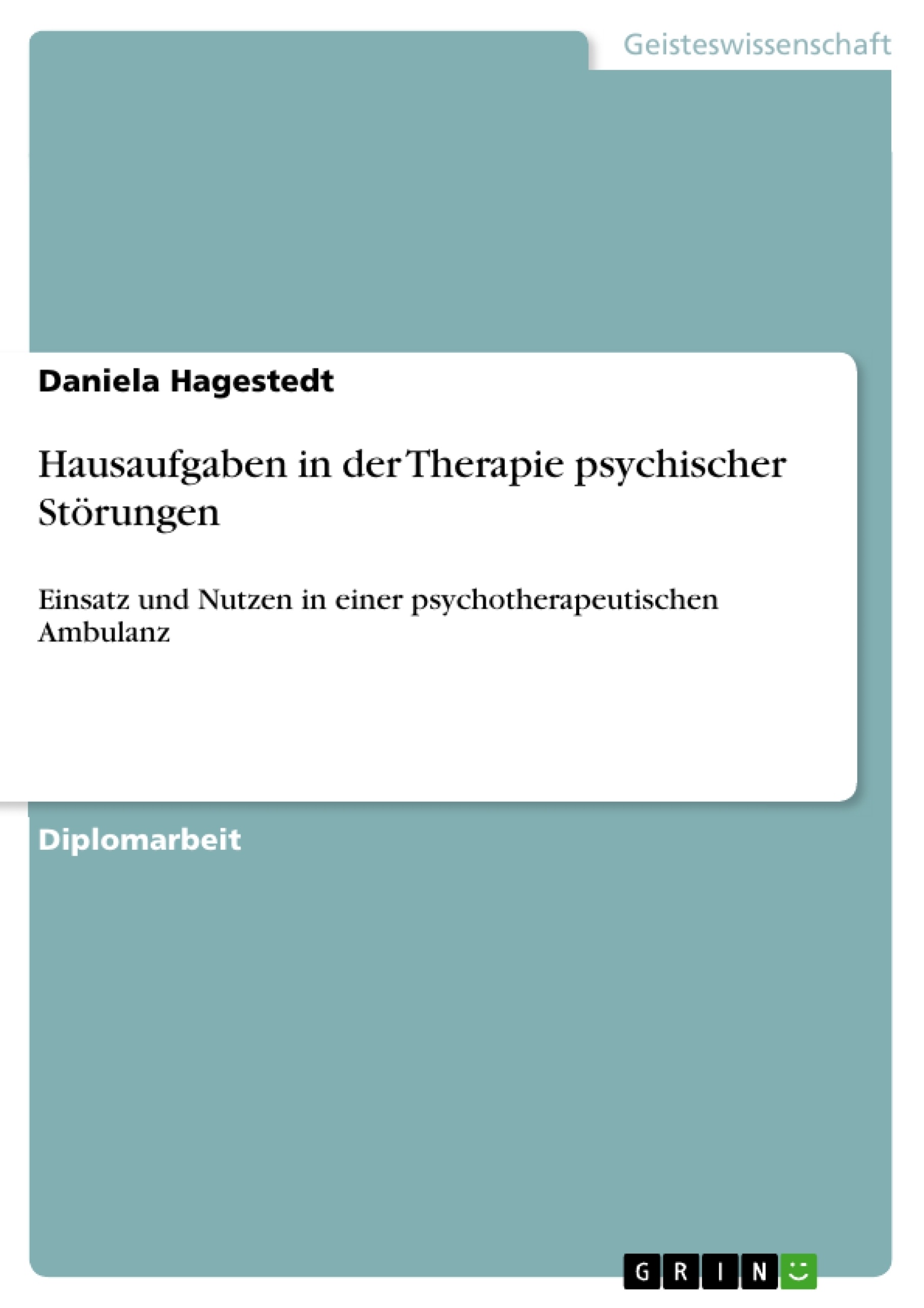Die Therapie psychischer Störungen wird häufig definiert als ein „geplanter, zielorientierter Prozess, um problematische, die Lebensführung beeinträchtigende Erlebens- und Verhaltensweisen eines Patienten zu verändern“ (Fehm & Helbig, 2008, S.7). Umfassende Veränderungen, wie sie hier angestrebt werden, lassen sich nicht ausschließlich innerhalb der zeitlich stark begrenzten Therapiesitzungen erreichen, weshalb auch die Zeit außerhalb der Sitzungen zunehmende Beachtung findet. Ein wesentliches Therapieelement, um die Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen nutzbar zu machen und einen Transfer des Gelernten in den Alltag zu erreichen, ist der Einsatz therapeutischer Hausaufgaben (Helbig & Fehm, 2005).
Heute sind Hausaufgaben ein wesentlicher Bestandteil zahlreicher Therapiemanuale für eine Reihe psychischer Störungen wie z.B. Depressionen, Panikstörungen, Bulimie, Schlafstörungen u.v.m. (Fehm & Fehm-Wolfsdorf, 2001) und ihre Wirksamkeit wurde in einer Reihe von Studien und in einigen Metaanalysen untersucht (vgl. Kazantzis, Deane & Ronan, 2000; Kazantzis, Whittington & Dattilio, 2010; Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas & Patterson, 2010). Allerdings liegen außerhalb kontrollierter Therapiestudien kaum Daten zur Nutzung von Hausaufgaben vor (Fehm & Fehm-Wolfsdorf, 2001). So existieren nur wenige Studien, die sich mit der Rolle therapeutischer Hausaufgaben in der klinischen Praxis befassen und näher untersuchen, ob Hausaufgaben tatsächlich systematisch genutzt werden und welchen Einfluss ein unsystematischer Einsatz auf das Therapieergebnis hat (vgl. Fehm & Kazantzis, 2004; Kazantzis, Busch, Ronan & Merrick, 2007; Kazantzis & Ronan, 2006). Die Nützlichkeit weiterer Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet betonen auch Kazantzis und Dattilio (2010, S.760): „An improved understanding of the day-to-day use of homework assignments in clinical practice would seem like a useful step in advancing the evidence base.”
Die vorliegende Arbeit versucht einen Beitrag zu diesem Themengebiet zu leisten, indem anhand von Stundenprotokollen einer psychotherapeutischen Ambulanz die tatsächliche Nutzung von Hausaufgaben in der klinischen Praxis näher untersucht wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Warum Hausaufgaben in der Psychotherapie?
- 2.2 Hausaufgaben: Definitionen und Ziele
- 2.2.1 Begriffsdefinition: Hausaufgaben
- 2.2.2 Begriffsdefinition: Compliance und Adhärenz
- 2.2.3 Arten von Hausaufgaben
- 2.2.4 Ziele und Wirkmechanismen von Hausaufgaben
- 2.3 Empirische Befunde zur Wirksamkeit von Hausaufgaben
- 2.3.1 Der Einsatz von Hausaufgaben und das Therapieergebnis
- 2.3.2 Der Einsatz von Hausaufgaben und die Therapiedauer
- 2.3.3 Hausaufgabenadhärenz und Therapieerfolg
- 2.3.4 Methodische Limitationen der Hausaufgabenstudien
- 2.3.5 Der Einsatz von Metaanalysen
- 2.4 Der Einsatz von Hausaufgaben in der klinischen Praxis
- 2.4.1 In welchen Bereichen werden Hausaufgaben in der Praxis eingesetzt?
- 2.4.2 Die Einstellung zu und der Einsatz von Hausaufgaben in der klinischen Praxis
- 2.4.3 Hausaufgabenadhärenz in der klinischen Praxis
- 2.4.4 Mögliche Einflussfaktoren auf die Hausaufgabenadhärenz
- 2.5 Fazit und Ausblick auf die Studie
- 3 Fragestellungen & Hypothesen
- 3.1 Explorative Fragestellungen
- 3.2 Zusammenhänge zu klinischen und Prozessvariablen
- 3.2.1 Hausaufgabenvergabe
- 3.2.2 Hausaufgabenadhärenz
- 4 Methoden
- 4.1 Vorgehen bei der Datenerhebung
- 4.2 Stichprobe
- 4.3 Operationalisierung
- 4.3.1 Hausaufgabenvariablen
- 4.3.2 Schwere der Störung
- 4.3.3 Therapieerfolg
- 4.4 Vorbereitung der Datenauswertung
- 4.5 Statistische Datenauswertung
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Explorative Fragestellungen
- 5.2 Zusammenhänge zu klinischen und Prozessvariablen
- 5.2.1 Hausaufgabenvergabe
- 5.2.2 Hausaufgabenadhärenz
- 6 Diskussion
- 6.1 Hausaufgabenvergabe
- 6.2 Hausaufgabenadhärenz
- 6.3 Zusammenhänge zu Therapiedauer und Therapieerfolg
- 6.4 Diskussion des Studiendesigns und Generalisierbarkeit der Befunde
- 6.5 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Hausaufgaben in einer psychotherapeutischen Ambulanz und deren Zusammenhänge mit klinischen und Prozessvariablen. Ziel ist es, die Wirksamkeit und die Einflussfaktoren auf die Adhärenz von Hausaufgaben zu analysieren.
- Der Einfluss von Hausaufgaben auf den Therapieerfolg
- Die Zusammenhänge zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und Therapiedauer
- Die Identifizierung von Faktoren, die die Adhärenz von Hausaufgaben beeinflussen
- Methodische Aspekte der Erhebung und Auswertung von Daten zum Thema Hausaufgaben in der Psychotherapie
- Praktische Implikationen für den Einsatz von Hausaufgaben in der klinischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz des Einsatzes von Hausaufgaben in der Psychotherapie. Sie skizziert den Forschungsstand und die Forschungslücke, die diese Arbeit zu schließen versucht. Die Forschungsfragen und Hypothesen werden kurz angerissen.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Einsatzes von Hausaufgaben in der Psychotherapie. Es werden verschiedene Definitionen von Hausaufgaben und Compliance/Adhärenz vorgestellt und die Ziele sowie Wirkmechanismen von Hausaufgaben diskutiert. Es folgt eine ausführliche Darstellung empirischer Befunde zur Wirksamkeit von Hausaufgaben, inklusive der methodischen Limitationen der bisherigen Studien. Abschließend wird der Einsatz von Hausaufgaben in der klinischen Praxis untersucht, inklusive der Einstellungen dazu und möglicher Einflussfaktoren auf die Adhärenz.
3 Fragestellungen & Hypothesen: In diesem Kapitel werden die konkreten Forschungsfragen und Hypothesen der Studie formuliert. Es werden sowohl explorative Fragestellungen als auch Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und klinischen sowie Prozessvariablen präsentiert.
4 Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, einschließlich des Vorgehens bei der Datenerhebung, der Stichprobenbeschreibung und der Operationalisierung der relevanten Variablen (Hausaufgabenvariablen, Schwere der Störung, Therapieerfolg). Die statistischen Auswertungsmethoden werden ebenfalls erläutert.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Ergebnisse zu den explorativen Fragestellungen sowie die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und den klinischen und Prozessvariablen berichtet. Die Ergebnisse werden tabellarisch und graphisch dargestellt.
Schlüsselwörter
Hausaufgaben, Psychotherapie, Compliance, Adhärenz, Therapieerfolg, Therapiedauer, klinische Praxis, empirische Befunde, Prozessvariablen, kognitiver Verhaltenstherapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Der Einsatz von Hausaufgaben in der Psychotherapie
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Hausaufgaben in einer psychotherapeutischen Ambulanz und deren Zusammenhänge mit klinischen und Prozessvariablen. Das Hauptziel ist die Analyse der Wirksamkeit von Hausaufgaben und der Einflussfaktoren auf die Adhärenz (Compliance).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der Einfluss von Hausaufgaben auf den Therapieerfolg, die Zusammenhänge zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und Therapiedauer, die Identifizierung von Faktoren, die die Adhärenz beeinflussen, methodische Aspekte der Datenerhebung und -auswertung, sowie praktische Implikationen für den klinischen Einsatz von Hausaufgaben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Definitionen, empirische Befunde und klinischer Praxis), Fragestellungen & Hypothesen, Methoden (inkl. Datenerhebung, Stichprobe, Operationalisierung und statistische Auswertung), Ergebnisse, Diskussion (inkl. Studiendesign und Generalisierbarkeit) und Literaturverzeichnis sowie Anhang.
Was wird im Kapitel "Theoretischer Hintergrund" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet Definitionen von Hausaufgaben und Adhärenz, Ziele und Wirkmechanismen, empirische Befunde zur Wirksamkeit (inkl. methodischer Limitationen und Metaanalysen), sowie den Einsatz von Hausaufgaben in der klinischen Praxis, inklusive der Einstellungen dazu und Einflussfaktoren auf die Adhärenz. Es wird ein umfassender Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit formuliert explorative Forschungsfragen und Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und klinischen sowie Prozessvariablen. Konkrete Fragestellungen und Hypothesen werden im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche Methoden wurden angewendet?
Kapitel 4 beschreibt detailliert die Methodik: Vorgehen bei der Datenerhebung, die Stichprobe, die Operationalisierung relevanter Variablen (Hausaufgabenvariablen, Schwere der Störung, Therapieerfolg) und die angewendeten statistischen Auswertungsmethoden.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse zu den explorativen Fragestellungen und den Zusammenhängen zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz und den klinischen und Prozessvariablen. Die Ergebnisse werden tabellarisch und graphisch dargestellt.
Was beinhaltet die Diskussion?
Die Diskussion (Kapitel 6) behandelt die Ergebnisse im Kontext des theoretischen Hintergrunds und des Studiendesigns. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Hausaufgabenvergabe, Adhärenz, Therapiedauer und Therapieerfolg, diskutiert die Generalisierbarkeit der Befunde und zieht ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hausaufgaben, Psychotherapie, Compliance, Adhärenz, Therapieerfolg, Therapiedauer, klinische Praxis, empirische Befunde, Prozessvariablen, kognitive Verhaltenstherapie.
- Quote paper
- Daniela Hagestedt (Author), 2012, Hausaufgaben in der Therapie psychischer Störungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194160