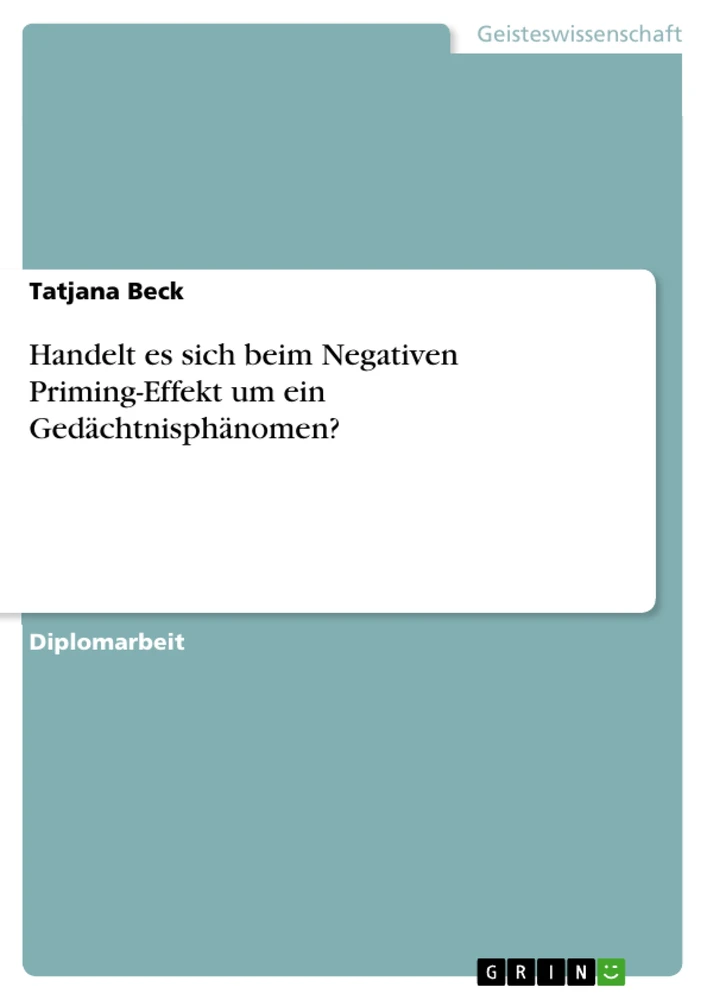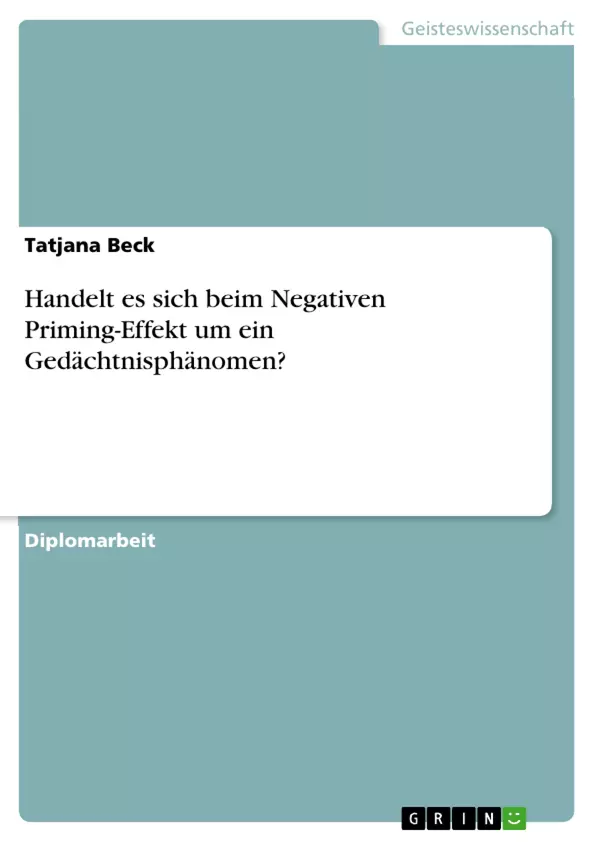Die vorliegende Untersuchung dient der Replikation und Erweiterung einer zuvor durchgeführten Studie von Buchner und Mayr (2004).
Anhand einer auditiven Identifikationsaufgabe wurde die Leistung einer jungen Gruppe mit der Leistung zweier Senioren-Gruppen verglichen, um den auditiven Negativen Priming-Effekt im Altersvergleich zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass jede Altersgruppe einen signifikanten Negativen Priming-Effekt aufzeigte, wobei das Ausmaß des Effekts in beiden Senioren-Gruppen im Vergleich zur jungen Gruppe signifikant größer ausfiel. Damit konnte der Befund von Buchner und Mayr (2004) nur insofern repliziert werden, als dass der Effekt in beiden Senioren-Gruppen nicht reduziert war.
Zusätzlich wurde mithilfe des multinomialen Modells untersucht, welcher Mechanismus den auditiven Negativen Priming-Effekt bedingt. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass episodische Abrufprozesse unabhängig vom Alter am Zustandekommen des auditiven Negativen Priming-Effekts beteiligt sind, da der spezifische Fehler in „Ignoriertes wiederholt“-Durchgängen im Vergleich zu Kontrolldurchgängen überrepräsentiert war. Dieser Effekt ist für jede Altersgruppe im selben Ausmaß eingetreten. Damit repliziert der vorliegende Befund die Vorgängerstudie von Mayr und Buchner (2006) und unterstützt das Modell des Abrufs der Prime-Reaktion im Rahmen des episodischen Abrufmodells.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Theoretischer Hintergrund: Der Negative Priming-Effekt
- 1.1 Erklärungsmodelle
- 1.2 Kognitive Leistungsfähigkeit und Negatives Priming bei älteren Versuchsteilnehmern
- 1.3 Hypothesen
- 2 Methode
- 2.1 Stichprobe
- 2.2 Material
- 2.3 Prozedur
- 2.4 Design
- 3 Ergebnisse
- 4 Diskussion
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, den auditiven Negativen Priming-Effekt im Altersvergleich zu untersuchen und bestehende Forschungsergebnisse zu replizieren und zu erweitern. Die Studie untersucht, ob und inwieweit sich der Effekt in verschiedenen Altersgruppen unterscheidet und welche kognitiven Mechanismen diesem Effekt zugrunde liegen.
- Auditiver Negativer Priming-Effekt im Altersvergleich
- Replikation und Erweiterung bestehender Studien
- Untersuchung kognitiver Mechanismen des Negativen Priming
- Vergleich der Leistungsfähigkeit verschiedener Altersgruppen
- Analyse der Ergebnisse mittels multinomialen Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Arbeit repliziert und erweitert eine vorherige Studie von Buchner und Mayr (2004) zum auditiven Negativen Priming-Effekt. Sie vergleicht die Leistung junger und älterer Teilnehmer*innen in einer auditiven Identifikationsaufgabe. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Negativen Priming-Effekt in allen Altersgruppen, wobei der Effekt bei den älteren Teilnehmer*innen stärker ausgeprägt ist als bei den jüngeren. Zusätzlich wird mittels eines multinomialen Modells untersucht, welcher Mechanismus den Effekt bedingt. Die Ergebnisse unterstützen die Rolle episodischer Abrufprozesse.
1 Theoretischer Hintergrund: Der Negative Priming-Effekt: Dieses Kapitel beschreibt den Negativen Priming-Effekt, ein Phänomen, bei dem die Reaktionszeit und die Fehlerrate erhöht sind, wenn auf einen zuvor ignorierten Stimulus reagiert werden muss. Es werden verschiedene Erklärungsmodelle vorgestellt, darunter die Distraktorinhibitionstheorie von Tipper (1985). Das Kapitel beleuchtet die bisherige Forschung, insbesondere den Unterschied zwischen visuellem und auditivem Negativem Priming, und führt zu den Hypothesen der Studie über.
2 Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, einschließlich der Stichprobenbeschreibung (Anzahl der Teilnehmer*innen in den verschiedenen Altersgruppen), der verwendeten Materialien (z.B. auditive Stimuli), der experimentellen Prozedur und des Studiendesigns. Es werden die einzelnen Schritte der Durchführung der Studie präzise dargelegt, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
3 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, die statistische Analysen und deren Interpretation. Hier werden die Daten der auditiven Identifikationsaufgabe im Detail präsentiert und im Kontext der Forschungsfrage interpretiert. Es werden die Ergebnisse der statistischen Tests dargelegt, die die Unterschiede in den Reaktionszeiten und Fehlerraten zwischen den Altersgruppen zeigen.
Schlüsselwörter
Auditiver Negativer Priming-Effekt, Selektive Aufmerksamkeit, Altersvergleich, Kognitive Leistungsfähigkeit, Episodischer Abruf, Distraktorinhibition, Multinomiales Modell, Reaktionszeit, Fehlerrate.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Auditiver Negativer Priming-Effekt im Altersvergleich
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den auditiven Negativen Priming-Effekt im Altersvergleich. Sie zielt darauf ab, bestehende Forschungsergebnisse zu replizieren und zu erweitern, indem sie die Leistung junger und älterer Teilnehmer*innen in einer auditiven Identifikationsaufgabe vergleicht und die zugrundeliegenden kognitiven Mechanismen analysiert.
Was ist der Negative Priming-Effekt?
Der Negative Priming-Effekt beschreibt ein Phänomen, bei dem die Reaktionszeit und die Fehlerrate erhöht sind, wenn auf einen zuvor ignorierten Stimulus reagiert werden muss. Die Studie konzentriert sich auf den auditiven Aspekt dieses Effekts.
Welche Methoden wurden in der Studie verwendet?
Die Studie verwendete eine auditive Identifikationsaufgabe. Die Methodik umfasste die detaillierte Beschreibung der Stichprobe (Anzahl der Teilnehmer*innen in verschiedenen Altersgruppen), der verwendeten Materialien (auditive Stimuli), der experimentellen Prozedur und des Studiendesigns. Die Ergebnisse wurden mittels eines multinomialen Modells analysiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Negativen Priming-Effekt in allen Altersgruppen. Der Effekt war bei den älteren Teilnehmer*innen stärker ausgeprägt als bei den jüngeren. Die Analyse mittels multinomialem Modell unterstützte die Rolle episodischer Abrufprozesse bei diesem Effekt.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Studie untersuchte die Hypothese, ob sich der auditive Negative Priming-Effekt in verschiedenen Altersgruppen unterscheidet und welche kognitiven Mechanismen diesem Effekt zugrunde liegen. Die Ergebnisse liefern Hinweise auf die Rolle episodischer Abrufprozesse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Auditiver Negativer Priming-Effekt, Selektive Aufmerksamkeit, Altersvergleich, Kognitive Leistungsfähigkeit, Episodischer Abruf, Distraktorinhibition, Multinomiales Modell, Reaktionszeit, Fehlerrate.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie ist in mehrere Kapitel gegliedert: Zusammenfassung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Erklärungsmodelle und Hypothesen), Methode (Stichprobe, Material, Prozedur, Design), Ergebnisse, Diskussion und Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Literatur wurde verwendet?
Ein detailliertes Literaturverzeichnis ist in der vollständigen Studie enthalten (in diesem Auszug nicht aufgeführt).
Welche Rolle spielen episodische Abrufprozesse?
Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Rolle episodischer Abrufprozesse als einen Mechanismus, der dem auditiven Negativen Priming-Effekt zugrunde liegt.
Wer sind die Zielgruppen dieser Studie?
Die Studie richtet sich an Wissenschaftler*innen und Studierende im Bereich der Kognitionspsychologie, insbesondere diejenigen, die sich mit Aufmerksamkeit, Gedächtnis und dem Altern beschäftigen. Die Ergebnisse sind für die Forschung im Bereich der kognitiven Alterung relevant.
- Quote paper
- Tatjana Beck (Author), 2011, Handelt es sich beim Negativen Priming-Effekt um ein Gedächtnisphänomen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194739