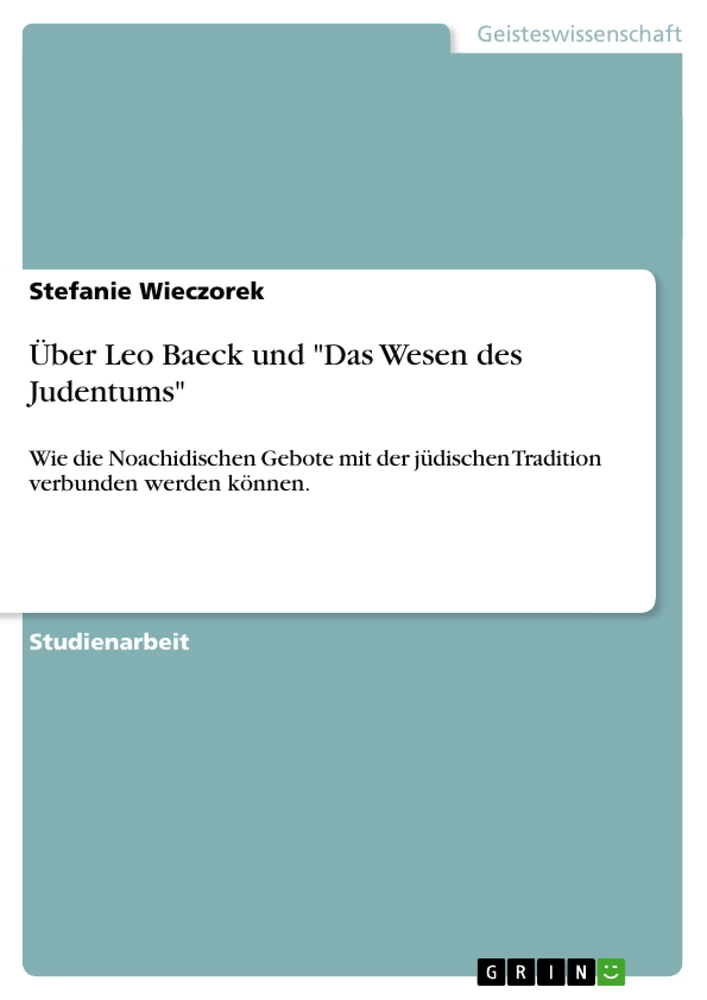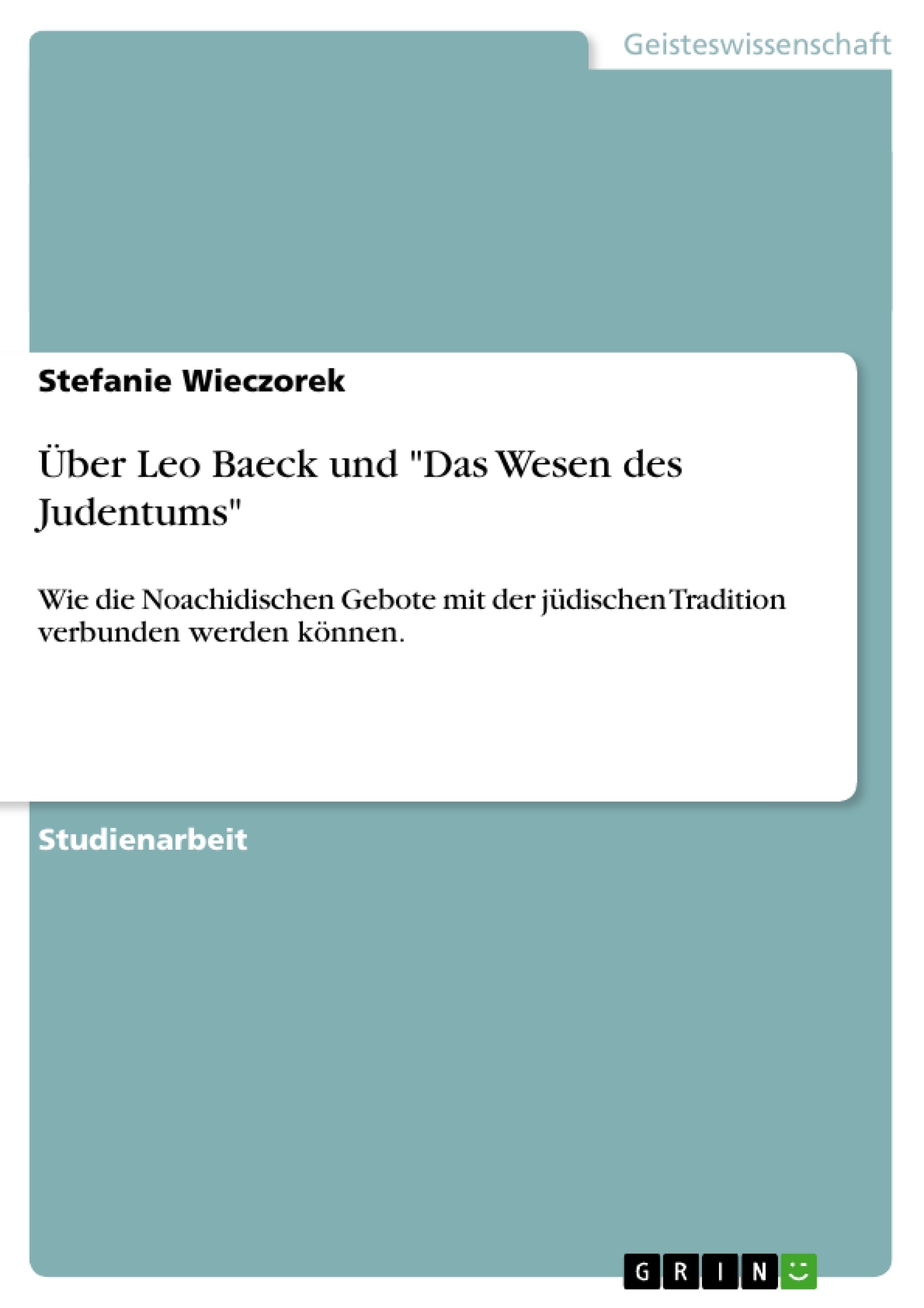„Die Noachidischen Gebote sind die sieben Grundgesetze“, welche Noah nach der Sintflutvon Gott erhielt. Sie werden „im Talmud, Traktat Sanhedrin, erläutert“ und stellen ein „Beispiel für gutes menschliches Zusammenleben“ dar. Dabei respektiert das Judentum„besonders Nichtjuden, die nach diesen Gesetzen leben und handeln“. Schon „vor demSinaibund hat Gott durch Noah, den gerechten Nichtjuden, seinen Bund mit der ganzenMenschheit gestiftet“. Die sechs Verbote und das eine Gebot lauten wie folgt: [...] Diese gelten für die gesamte außerisraelitische Menschheit. Laut Maimonides hat jener Anteilan der kommenden Welt, der „die sieben Gebote übernimmt und gewillt ist, sie zu tun“, nurdann „gehört er zu den Frommen der Weltvölker“. Somit hängt „das Heil in der kommendenWelt [...] nicht von der Zugehörigkeit zum Judentum ab“. Denn im Gegensatz zu denSöhnen Israels, die erst Gerechte genannt werden, „wenn sie die ganze Tora tun“, ist einGerechter der Weltvölker, wer „die sieben Gebote mit all ihren Einzelheiten“ tut. Im Folgenden möchte ich nun Leo Baecks Einstellung zu den Noachidischen Gebotendurchleuchten und versuchen seine Aussagen in seinem Werk „Das Wesen des Judentums“mit dieser zu verbinden.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Leo Baeck
„Das Wesen des Judentums“
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
„Die Noachidischen Gebote sind die sieben Grundgesetze“1, welche Noah nach der Sintflut von Gott erhielt. Sie werden „im Talmud, Traktat Sanhedrin, erläutert“2 und stellen ein „Beispiel für gutes menschliches Zusammenleben“3 dar. Dabei respektiert das Judentum „besonders Nichtjuden, die nach diesen Gesetzen leben und handeln“4. Schon „vor dem Sinaibund hat Gott durch Noah, den gerechten Nichtjuden, seinen Bund mit der ganzen Menschheit gestiftet“5.
Die sechs Verbote und das eine Gebot lauten wie folgt:
1) Verbot des Götzendienstes ( 'avodah zarah )
2) Verbot der Gotteslästerung ( qillelat hash - shem )
3) Verbot des Blutvergießens (shefikut damim = ungerechtfertigte Tötung eines Menschen )
4) Verbot der Unzucht ( gilluy 'arayôt = geschlechtliche Perversion )
5) Verbot des Raubes von fremden Menschen und fremdem Eigentum ( hag - gezel )
6) Gebot, eine geordnete Rechtsprechung einzurichten ( had - dîmîm )
7) Verbot, ein Stück von einem lebenden Tier zu essen ( 'ever min ha - chay )6
Diese gelten für die gesamte außerisraelitische Menschheit.7 Laut Maimonides hat jener Anteil an der kommenden Welt, der „die sieben Gebote übernimmt und gewillt ist, sie zu tun“8, nur dann „gehört er zu den Frommen der Weltvölker“9. Somit hängt „das Heil in der kommenden Welt [...] nicht von der Zugehörigkeit zum Judentum ab“10. Denn im Gegensatz zu den Söhnen Israels, die erst Gerechte genannt werden, „wenn sie die ganze Tora tun“11, ist ein Gerechter der Weltvölker, wer „die sieben Gebote mit all ihren Einzelheiten“12 tut. Im Folgenden möchte ich nun Leo Baecks Einstellung zu den Noachidischen Geboten durchleuchten und versuchen seine Aussagen in seinem Werk „Das Wesen des Judentums“ mit dieser zu verbinden.
Leo Baeck
Leo Baeck wurde am 23. Mai 1873 in Lissa/Polen als Sohn des Rabbiners Dr. Samuel Baeck geboren.13 Im Vaterhaus hat er die jüdische Tradition in ihrem Tiefsten ernst zu nehmen gelernt.14 Mit 18 Jahren begann er ein Philosophiestudium im benachbarten Breslau und besuchte gleichzeitig das Rabbinerseminar.15 1894 wechselte er an die liberale Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und studierte Philosophie, Geschichte und Religionsphilosophie.16 1895 wurde er dann Rabbiner in Oppeln und 1907 in Düsseldorf. Fünf Jahre später zog es ihn zurück nach Berlin und er wurde dort Rabbi an der neuen Berliner Synagoge in der Fasanenstraße.17 Während des Ersten Weltkrieges war Leo Baeck Feldrabbi an der West- und Ostfront und übernahm zahlreiche repräsentative Aufgaben in der Jüdischen Gemeinde Berlin.18 Er war unter anderem ab 1922 Vorsitzender des Allgemeinen Rabbinerverbandes in Deutschland, von 1925 bis 1937 Präsident der Großloge der deutschen Sektion von B'nai B'rith. Ab 1933 war Leo Baeck der Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden.19 Leo Baeck stand an der Spitze der jüdischen Vertretung und war vor 1939 mehrmals kurz inhaftiert. Immer öfter musste er mit ansehen, wie seine Mitarbeiter im Konzentrationslager verschwanden und häufig nicht mehr zurückkehrten.20 Er war während des nationalsozialistischen Regimes das geistige Oberhaupt der deutschen Juden. Während dieser Zeit unternahm er zahlreiche Auslandsreisen, um auf die Lage der Juden im Deutschen Reich aufmerksam zu machen. Trotz der mehrfachen Möglichkeit zur Emigration blieb er bei seiner Gemeinde und verhalf anderen Juden dazu Deutschland zu verlassen. Im Jahre 1943 wurde Leo Baeck mit seiner Familie nach Theresienstadt deportiert. Dort versuchte er unermüdlich den Menschen mit seinen Predigten und Vorträgen in ihrer hoffnungslosen Situation zu helfen. Er überlebte schwer misshandelt und siedelte am 05. Juni 1945 nach London um.21 Dort wurde er Präsident der von ihm bereits 1924 mitbegründeten Weltunion für Progressives Judentum und gründete 1947 das später nach ihm benannte „Institut zur 2
Erforschung des Judentums in Deutschland seit der Aufklärung“. Nebenbei hatte er von 1948 bis 1953 eine Professur am Hebrew Union College in Cincinatti inne.22 Am 02. November 1956 stirbt Leo Baeck in London.23
Leo Baeck war einer der großen Lehrer des Judentums und hat wie selten ein Jude vor ihm ohne jede Scheu seine kritische Haltung gegenüber christlichen Gedankengebäuden geäußert, zugleich ist er aber ein, gerade von Christen, anerkannter und gesuchter Partner im christlich - jüdischen Gespräch.24 Es dürfte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts keine andere Persönlichkeit im deutschen Judentum gegeben haben, die eine ähnliche Ausstrahlung gehabt hätte wie er. Wer eine derartige Fülle von Funktionen in seinem Leben in einem Zeitraum von 50 Jahren ausgeübt hat, musste Macht, Einfluss und Wirkung besitzen. Leo Baeck hat den Maßstab für ein Leben als Jude in Würde gesetzt. Er war ein Mensch, der aus der Dynamik der Polarität lebte. Er verband sensible Zuwendung und menschliche Überlegenheit, sachliche Eindeutigkeit und vornehme Distanz, vereinigte deutsche Kultur und jüdischen Glauben, Liberalismus und das Festhalten an Traditionen.25 Auch hat er sich für eine vom Staat unabhängige Kirche, sowie für die Selbstständigkeit und Individualität des Menschen eingesetzt. Er meinte, dass sich der Staat aus den religiösen Vollzügen seiner Bürger herauszuhalten habe und keinen Einfluss auf die innere Verfasstheit der Religionsgemeinschaften nehmen dürfe.26 Sein zentrales Anliegen Respekt vor dem Andersdenken zu pflegen und den Dialog mit anderen Religionen zu suchen war wegweisend.
„ Das Wesen des Judentums“
Leo Baeck schrieb „Das Wesen des Judentums“ als Antwort auf Adolf von Harnacks „Wesen des Christentums“, es darf als klassische Selbstaussage des modernen Judentums verstanden werden.27 Es ist ein Buch über den einen Gott und sein Gebot, aber auch ein Buch über die große Hoffnung. Leo Baeck führte darin die Arbeit der Wissenschaft des Judentums weiter, indem er deren kritische Fragen nach der Vergangenheit in das Gegenwärtige und Überzeitliche weiterführte. Hierin stellt er richtig, dass es kein Christentum geben könne, welches seine jüdischen Wurzeln zu bestreiten versucht. Die Religionen sollten nicht gleich 3
[...]
1 Reinhold Bohlen, Absolutheitsanspruch und Mission aus jüdischer Perspektive, hier: S. 1. (http://www.theo.uni-trier.de/_downloads/Bohlen.pdf)
2 Ebenda, hier: S. 1.
3 Ebenda, hier: S. 1.
4 Ebenda, hier: S. 1.
5 Leo Baeck, Wesen des Judentums, Fourier Verlag, Wiesbaden, 1995, 6., hier: S. 70.
6 Reinhold Bohlen, Absolutheitsanspruch und Mission aus jüdischer Perspektive, hier: S. 2.
7 Ebenda, hier: S. 2.
8 Ebenda, hier: S. 2.
9 Ebenda, hier: S. 2.
10 Ebenda, hier: S. 3.
11 Ebenda, hier: S. 3.
12 Ebenda, hier: S. 3.
13Gerhard Krause etc., Theologische Realenzyklopädie, De Gruyter, 1977, hier: Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), S. 112.
14 Walter Homolka (Hrg.), Philosophical and Rabbinical Approaches, Frank & Timme GmbH, 2007, hier: Ernst Ludwig Ehrlich, Leo Baeck, der Mensch und sein Werk, S. 19.
15 Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), hier: S. 112.
16 http://www.hagalil.com/deutschland/berlin/rabbiner/baeck.htm. 17Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), hier: S. 112.
18 Dr. E. G. Lowenthal, Leo Baeck (1873 - 1956) - Ein Leben für die Religion und die Menschen, http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/37.html,.
19Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), hier: S. 113.
20 Ernst Ludwig Ehrlich, Leo Baeck, der Mensch und sein Werk, hier: S. 29.
21 Dr. E. G. Lowenthal, Leo Baeck.
22 http://www.hagalil.com/deutschland/berlin/rabbiner/baeck.htm.
23 Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), hier: S. 113.
24 Ernst Ludwig Ehrlich, Leo Baeck, der Mensch und sein Werk, hier: S. 20.
25 Reinhold Mayer, Artikel: Baeck, Leo (1873 - 1956), hier: S. 112.
26 Walter Homolka (Hrg.), Philosophical and Rabbinical Approaches, Frank & Timme GmbH, 2007, hier: Thomas Rachel, Einleitung: Leo Baeck - Geistiger Vater einer modernen jüdischen Theologie, S. 13.
27 Ernst Ludwig Ehrlich, Leo Baeck, Der Mensch und sein Werk, hier: S. 24.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Wieczorek (Autor:in), 2009, Über Leo Baeck und "Das Wesen des Judentums", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195067