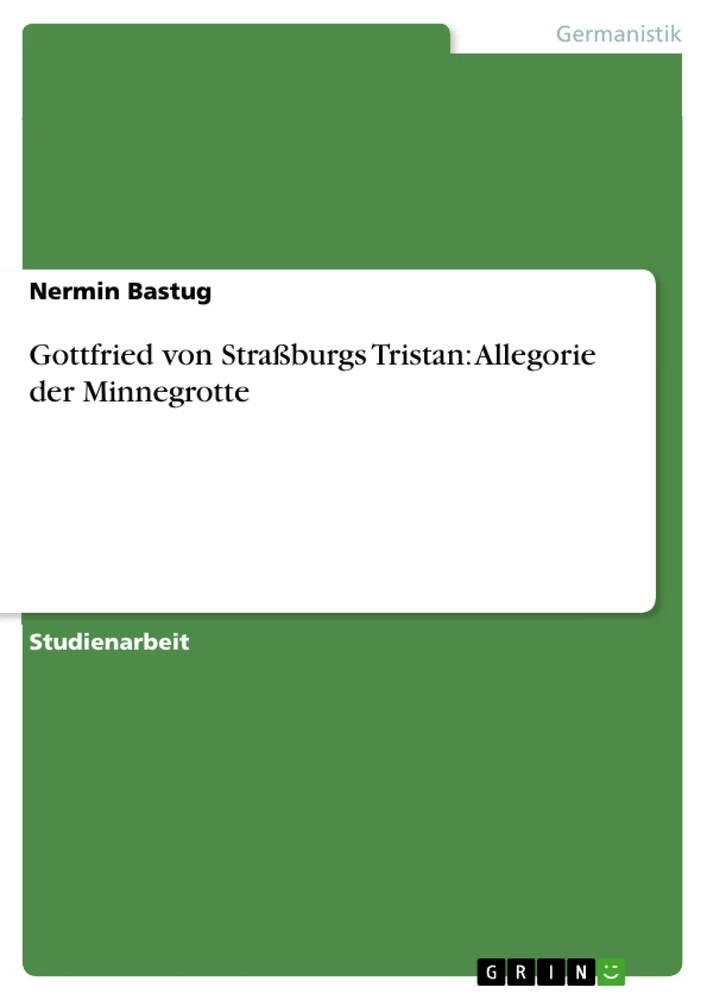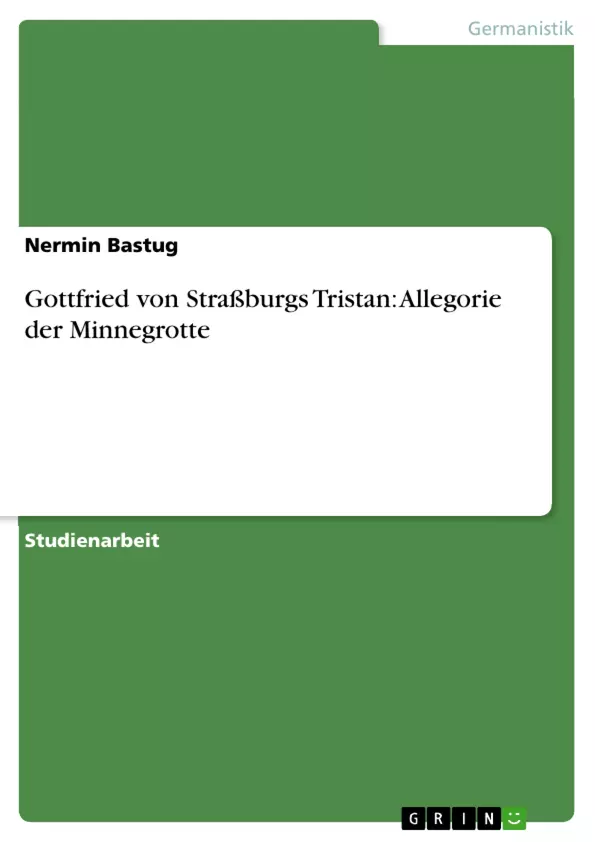In der Minnegrotte erleben Tristan und Isolde den Höhepunkt ihrer Liebe. Anders als vorherige Erzähler der Legende, widmet sich Gottfried von Straßburg dem Liebesort ganz besonders, indem er den einzelnen Grottenelementen allegorische Bedeutungen, spezielle Eigenschaften der Minne, zuschreibt.
Durch das umfangreiche Elaborat des deutschen Tristanautors erlangt die Minnegrottenepisode einen vornehmlichen Stellenwert im Roman und in der Literaturforschung. Die ergiebige Arbeit Gottfrieds bewegt viele Literaturwissenschaftler dazu, der Minnegrottenallegorie besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das Bestreben ihr gerecht zu werden, ist in einer Sammlung von verschiedenen teils unvereinbaren Auslegungen der Minnegrottenal-legorie resultiert.
Diese Arbeit schneidet einen Bruchteil dieser unterschiedlichen Deutungsansätze an. Nach einer Beschreibung des Aufbaus und der Wichtigkeit der Minnegrottenepisode, folgt eine Erklärung der Allegorie Gottfrieds und ihre Auslegung in einzelnen Theorien. Meine Schlussbetrachtung ist eine Beurteilung der Übereinstimmung von Gottfrieds Minnegrottenallegorie mit den erläuterten Forschungen darüber.
Inhalt
1. Einleitung
2. Aufbau und Wichtigkeit der Minnegrottenepisode
3. Gottfrieds Minnegrottenallegorie
3.1. Wunschleben
3.2. Vergleich zu Thomas und autobiographischer Exkurs I
3.3. Gottfrieds Auslegung
3.4. Autobiographischer Exkurs II
4. Minnegrottenallegorie in der Forschung
4.1. Locus amoenus
4.2. ÄEin Versuch zur Psychologie der Liebe“
4.3. Die ÄMinnegrotte als begrenzte Utopie“
4.4. Kritik an höfischer Kultur und Allegorie des Liebesaktes
4.5. Literarische Deutung
4.6. Kirchenallegorie
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat die Minnegrotte in Gottfried von Straßburgs "Tristan"?
In der Minnegrotte erleben Tristan und Isolde den absoluten Höhepunkt ihrer Liebe. Gottfried von Straßburg hebt diesen Ort besonders hervor, indem er den einzelnen Elementen der Grotte allegorische Bedeutungen zuschreibt, die spezifische Eigenschaften der Minne (Liebe) repräsentieren.
Was ist das Ziel dieser literaturwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene Deutungsansätze der Minnegrottenallegorie. Sie beschreibt den Aufbau der Episode, erklärt Gottfrieds Allegorie und beurteilt, wie gut moderne Forschungsmeinungen mit dem Originaltext übereinstimmen.
Welche Forschungstheorien werden zur Minnegrotte herangezogen?
Die Arbeit beleuchtet Ansätze wie den "Locus amoenus", psychologische Deutungen der Liebe, die Grotte als begrenzte Utopie, kirchenallegorische Auslegungen sowie die Kritik an der höfischen Kultur.
Warum gibt es so viele verschiedene Auslegungen der Minnegrotte?
Gottfrieds Werk ist sehr komplex und ergiebig, was dazu führt, dass Literaturwissenschaftler teils unvereinbare Theorien entwickelt haben, um der Tiefe der Allegorie gerecht zu werden.
Wird in der Arbeit ein Vergleich zu anderen Autoren gezogen?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen Vergleich zu Thomas (von Britannien) sowie autobiographische Exkurse, um Gottfrieds spezifische Auslegung der Minne besser einordnen zu können.
- Quote paper
- Nermin Bastug (Author), 2011, Gottfried von Straßburgs Tristan: Allegorie der Minnegrotte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195170