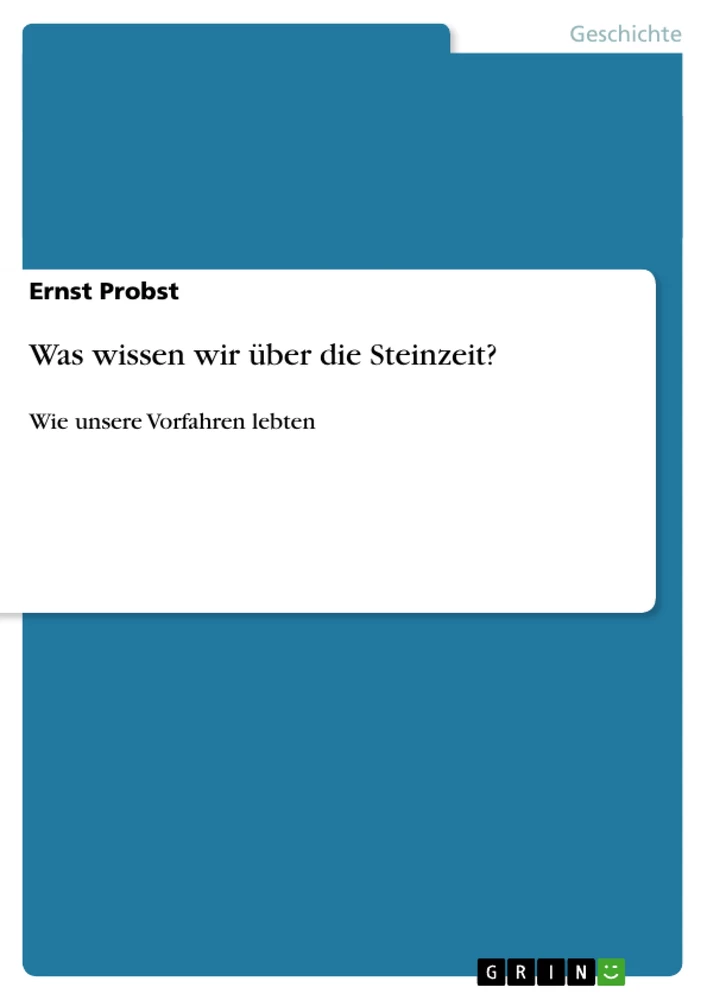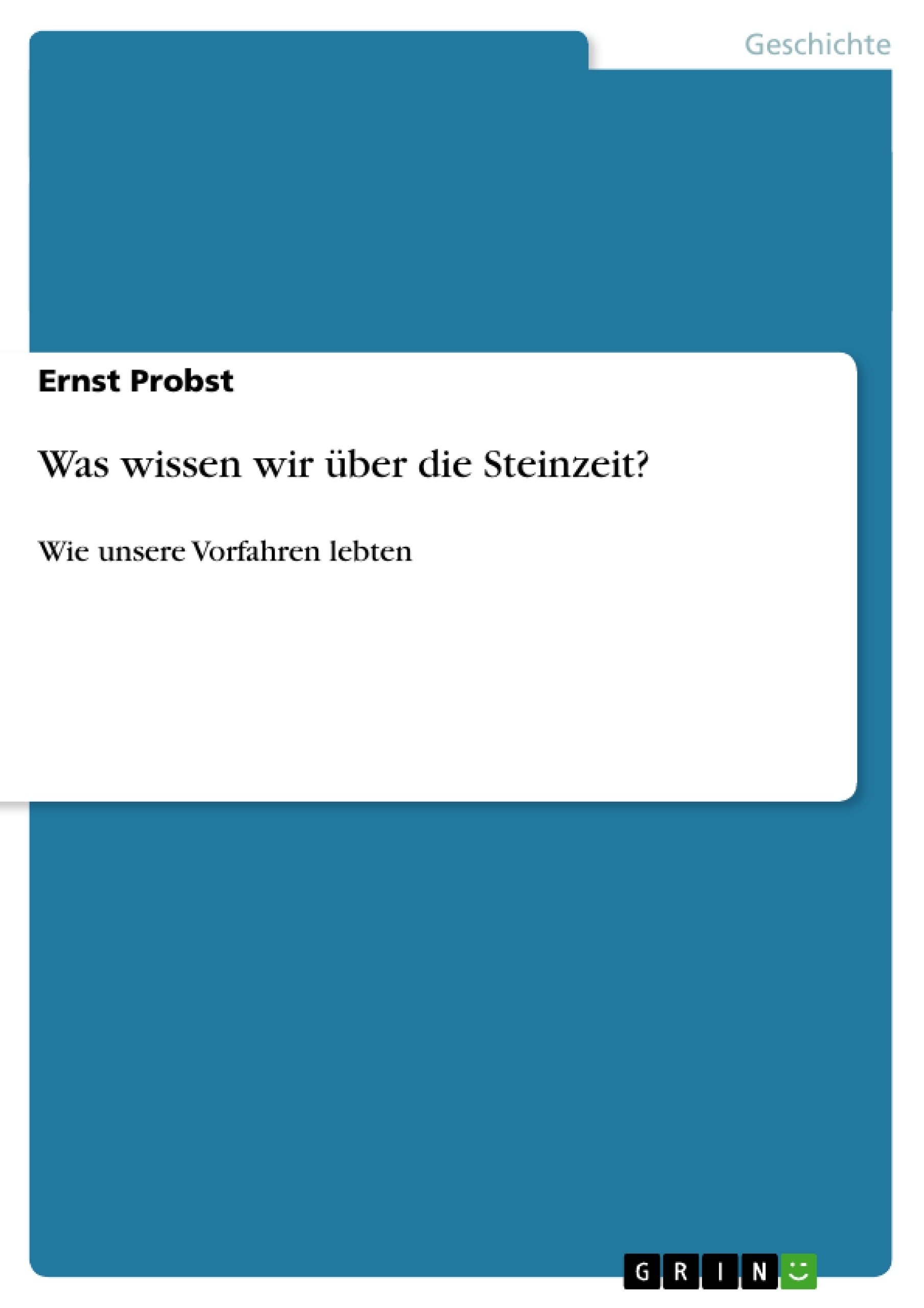Auf die Frage „Was wissen wir über die Steinzeit?“ gibt das gleichnamige kleine Taschenbuch des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst eine Antwort. Es schildert die wichtigsten Errungenschaften unserer Vorfahren in der Altsteinzeit, Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit in Wort und Bild. Ernst Probst hat sich durch Bücher, Taschenbücher, Broschüren, Museumsführer und E-Books aus den Themenbereichen Paläontologie, Archäologie und Geschichte einen Namen gemacht. Sein erstes Werk „Deutschland in der Urzeit“ wurde als „Meisterwerk der Wissenschaftspublizistik“ gelobt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Trommler in der Jungsteinzeit. Zeichnung von Fritz Wendler
Dem Kunstmaler Fritz Wendler (1941-1995) gewidmet, der f ü r meine B ü cher „ Deutschland in der Urzeit “ (1986) und „ Deutschland in der Steinzeit “ (1991) zahlreiche Ö lgem ä lde und Zeichnungen geschaffen hat, sowie Shuhei Tamura, der mich bei zahlreichen B ü chern ü ber urzeitliche Raubkatzen unterst ü tzt hat.
Jagd auf einen Waldelefanten in der Altsteinzeit vor ü ber 100.000 Jahren in Norddeutschland
Was wissen wir eigentlich über das Leben unserer steinzeitlichen Vorfahren? Ei- gentlich nur das, was mehr oder minder zufällig entdeckte archäologische Funde aussagen. Sie gelingen zum Beispiel bei Bauarbeiten, bei denen Reste von Siedlungen, Jagdbeute, Werkzeuge, Waffen, Gräber oder Friedhöfe aufgedeckt werden. Es ist ein großes Glück für die Prähisto- riker, wenn in einem solchen Fall irgendein ge- schultes Auge sofort die wahre Natur derartiger Hinterlassenschaften erkennt und der zuständi- gen Stelle meldet.
Urgeschichtliche Zeugnisse aus der Steinzeit werden aber auch beim Absuchen von Kies- und Sandgruben sowie von Äckern geborgen. Manchmal geschieht dies jahrelang, etwa wenn beim Pflügen eines Feldes immer wieder Steinwerkzeuge oder Reste von Tongefäßen an die Erdoberfläche befördert werden. Nicht in jedem Fall meldet der Landwirt oder Hobby- Archäologe sofort die Funde dem nächstlie- genden Landesamt für Denkmalpflege, Mu- seum oder Universitätsinstitut. Dadurch werden die Fundzusammenhänge unzureichend doku- mentiert, aussagekräftige Hinterlassenschaften nur unbeholfen restauriert, konserviert und nicht selten sogar zerstört. Hinzu kommt, dass ein im Wohnzimmer aufbewahrter archäologischer Fund, von dem niemand weiß, für die Fachwelt nicht existiert.
Stark eingeschränkt wird das Wissen über das Leben steinzeitlicher Menschen auch durch die Erhaltungsfähigkeit des Rohstoffes, aus dem die Produkte verschiedenster Art angefertigt sind. Denn der Nachwelt werden nur die wider- standsfähigsten Materialien überliefert. Also Gegenstände aus Stein, Geweih, Knochen, Elfenbein, Tierzähnen und Metallen. Funde aus Holz, Rinde, Tierfell und -haut oder Stoffe aus Leinen oder Schafwolle sind große Seltenheiten. Solche Stücke überdauern nur dann Jahr- tausende, wenn sie luftdicht konserviert worden sind.
Die unterschiedliche Erhaltungsfähigkeit von Rohstoffen ist einer der Gründe dafür, weshalb die Anfänge der Menschheitgeschichte heute als Steinzeit bezeichnet werden. Vor allem aus den frühesten Abschnitten sind neben menschlichen Skelettresten und ganz seltenen Resten von Be- hausungen meist nur Steinwerkzeuge bekannt. Reste von Holz, aus dem nach Ansicht vieler Prähistoriker mehr Gegenstände als aus Stein angefertigt wurden, haben dagegen lediglich in Ausnahmefällen überdauert. Wäre es anders, würde man jetzt vielleicht von einer Holzzeit sprechen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Christian J ü rgensen Thomsen (1788-1865)
Der Begriff Steinzeit, den der dänische Ar- chäologe Christian Jürgensen Thomsen (1788- 1865) aus Kopenhagen im Jahre 1836 eingeführt hat, ist dennoch gut gewählt. Denn dank der im Laufe der Zeit immer mehr vervollkommneten Steinbearbeitung mit unterschiedlichen Werk- zeugtypen lassen sich vor allem die Abschnitte der älteren und der mittleren Steinzeit einteilen. Da der Beginn der Steinzeit mit dem Auftreten der ersten Steinwerkzeuge gleichgesetzt wird, setzt die Steinzeit in Afrika schon vor mehr als zwei Millionen Jahren ein. So alt sind primitive, nur mit wenigen Steinschlägen zurechtgehauene Steinwerkzeuge von Koobi Fora in Kenia und von Omo in Äthiopien. Als Erzeuger dieser groben Geröllgeräte gilt der Frühmensch Homo habilis , der früheste Vertreter der Gattung Homo (Mensch), zu der auch wir gehören. Homo habilis lebte - nach den Funden zu schließen - nur in Afrika. Dieser Vorfahre jagte bereits Großwild, wie Jagdbeutereste von Flusspferden und Giraffen zeigen.
In Asien und Europa beginnt die Steinzeit erst vor mehr als einer Million Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die in Afrika seit mehr als 1,5 Millionen Jahren nachweisbaren Frühmenschen der Art Homo erectus (aufrecht gehender Mensch) auch andere Erdteile zu Fuß erobert.
Als die ältesten Skelettreste von Homo erectus in Asien gelten die über eine Million Jahre alten Funde von Modjokerto und Sangiran auf Java in Indonesien. In Europa wird der mehr als eine Million Jahre alte Schädelrest von Orce als Senior unter den europäischen Urmenschen betrachtet. Es sei nicht verschwiegen, dass der „Mensch von Orce“ zeitweise als Wildesel gedeutet wurde. Bis zur Entdeckung des spanischen Frühmenschen hatte man den etwa 630.000 Jahre alten Un- terkiefer des Heidelberg-Menschen von Mauer bei Heidelberg für den Überrest des ältesten Europäers gehalten.
Die Frühmenschen der Art Homo erectus haben schon vor mindestens 1,4 Millionen Jahren das auf natürliche Weise durch Blitzschläge oder Waldbrände entstandene Feuer gezähmt und gehütet. Das dokumentieren mehr als 40 Stücke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bilder auf den Seiten 14 und 15:
Heidelberg-Menschen und Tiere in der Altsteinzeit vor rund 600.000 Jahren in S ü dwestdeutschland.
Gem ä lde von Fritz Wendler f ü r das Buch „ Deutschland in der Urzeit “ (1986) von Ernst Probst
gebrannten Lehms von einer Feuerstelle bei Che- sowanja in Kenia. Als die ältesten Feuerspuren in Europa werden angekohlte Tierknochen und Holzkohlestückchen aus der Höhle Sandalja I bei Pula in Istrien (Jugoslawien) betrachtet. Sie stammen aus der Zeit vor etwa einer Million Jahren. In Deutschland belegen Feuerstellen vor kleinen Hütten in Bilzingsleben in Thüringen die Kenntnis des Feuers vor etwa 300.000 Jahren. Zu den wichtigsten Erfindungen der Homo erectus - Frühmenschen gehören der aus verschiedenen Steinarten zurechtgehauene Faustkeil, der als Universalwerkzeug zum Schlagen, Schneiden und Stechen diente, und die hölzerne Lanze, neben dem Feuer eine der wenigen Waffen gegen gefährliche Raubtiere. Die damaligen Jäger und Sammler mussten sich vor Löwen, Leoparden und Säbelzahnkatzen (Säbelzahntiger) hüten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Heidelberg-Mensch
vor mehr als 600.000 Jahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lagerleben von Fr ü hmenschen in Bilzingsleben in Th ü ringen vor rund 300.000 Jahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mosbacher L ö we (Panthera leo fossilis), ein gef ä hrlicher Zeitgenosse der Fr ü hmenschen in Europa vor etwa 700.000 bis 300.000 Jahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mosbacher L ö we (Panthera leo fossilis).
Diese Raubkatze erreichte eine Gesamtl ä nge von maximal 3,60 Metern
und war viel gr öß er als heutige L ö wen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jaguar (Panthera onca gombaszoegensis), ein Zeitgenosse
der Fr ü hmenschen in Europa
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gepard (Acinonyx pardinensis), ein Zeitgenosse
der Fr ü hmenschen in Europa
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
S ä belzahnkatze (Homotherium crenatidens), ein Zeitgenosse
der Fr ü hmenschen in Europa
Die Zeichnungen auf den Seiten 20 bis 24 wurden von dem japanischen K ü nstler Shuhei Tamura aus Kanagawa geschaffen, der eine Vorliebe f ü r urzeitliche Raubkatzen hat. Tamura zeichnete und malte unter anderem pr ä his- torische L ö wen, S ä belzahnkatzen, Dolchzahnkatzen, Jaguare, Leoparden und Geparde. Bilder von Tamura schm ü cken zahlreiche Taschenb ü cher des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Sehenswerte Farb- bilder ausgestorbener Raubkatzen von Tamura findet man bei Flickr unter folgender Adresse im Internet: http://tinyurl.com/6kz5bww
[...]
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2012, Was wissen wir über die Steinzeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195529