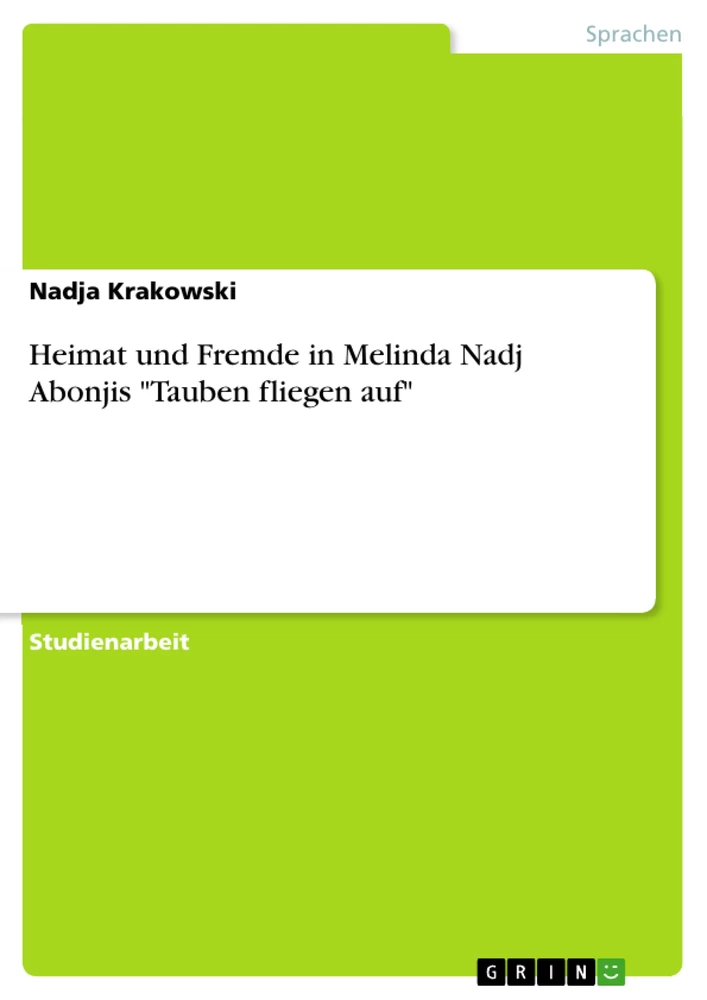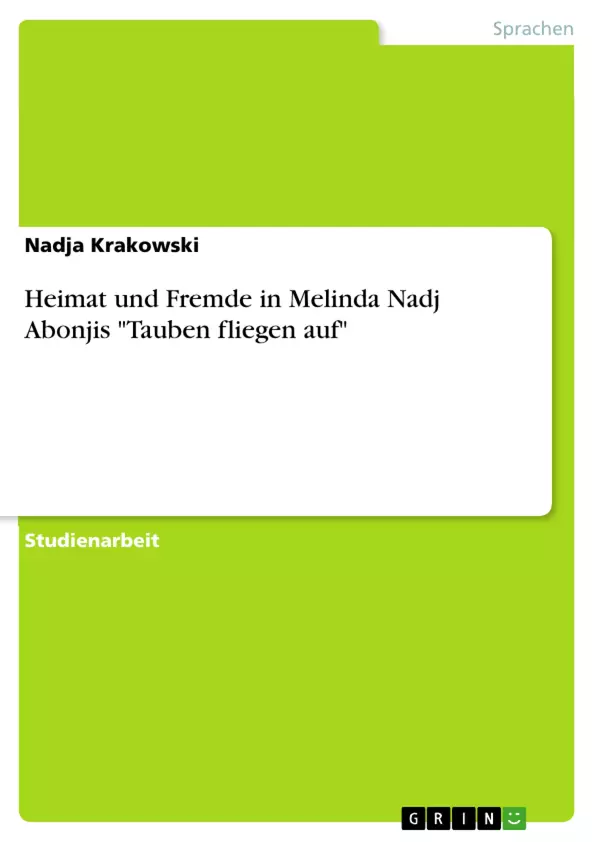Mit dem Roman Tauben fliegen auf gewann die Schweizer Autorin Melinda Nadj Abonji 2010 sowohl den Deutschen als auch den Schweizer Buchpreis. Sie traf anscheinend nicht nur den Geschmack der Kritiker, sondern auch den Zeitgeist: „Das ist sie also: die zeitgemäße Form, über Emigration, entschwindende Heimat und das Leben im Dazwischen zu schreiben.“ Die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Schriftstellerin erzählt in Rückblenden die Geschichte der Familie Kocsis aus der Vojvodina, die in die Schweiz auswandert.
Das Bewusstsein von Heimat ist stets auch von der Vorstellung der Fremde, dem Anderen bestimmt. In meiner Hausarbeit versuche ich, den Bezug der Protagonistin Ildikó zu ihren Vorstellungen von Heimat und Fremde in dem Roman Tauben fliegen auf herauszuarbeiten und für den Rahmen des Romans genauer zu bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ildikós Heimat
- Heimat und Identität
- Sehnsuchtsort Vojvodina
- Essen
- Sprache
- Leben in der Schweiz
- Integration, Assimilation und Identifikation
- Essen
- Sprache
- Fremde
- Wegzug aus der Vojvodina, Ankunft in der Schweiz
- Fremde in der Heimat Vojvodina
- Fremdenfeindlichkeit
- Ildikós Zwischenwelt
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Heimat und Fremde in Melinda Nadj Abonjis Roman "Tauben fliegen auf", indem sie die Beziehung der Protagonistin Ildikó zu diesen Begriffen analysiert. Der Fokus liegt auf den subjektiven Faktoren, die Ildikós Wahrnehmung von Heimat und Fremde prägen. Die politische Situation wird nur am Rande betrachtet.
- Die Definition von Heimat und ihre Verbindung zur Identität
- Der Einfluss von Kindheit, Sozialisation, Traditionen, Essen und Sprache auf das Heimatgefühl
- Die Erfahrung der Fremde und ihre Rolle in der Entwicklung der Identität
- Die Ambivalenz von Heimat und Fremde im Kontext der Emigration
- Die Suche nach Zugehörigkeit und Selbstfindung im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Melinda Nadj Abonjis Roman "Tauben fliegen auf" und dessen Rezeption vor. Sie thematisiert die zentrale Frage nach Heimat und Fremde in einer globalisierten Welt, insbesondere im Kontext der Emigration der Familie Kocsis aus der Vojvodina in die Schweiz. Der Essay konzentriert sich auf die subjektive Wahrnehmung der Protagonistin Ildikó und deren Einflussfaktoren, wobei der politische Kontext nur am Rande beleuchtet wird. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, die prägnantesten Beispiele für die Thematik herauszuarbeiten.
Ildikós Heimat: Dieses Kapitel erörtert Ildikós Verständnis von Heimat, insbesondere die Vojvodina. Es analysiert die enge Verbindung zwischen Heimat und Identität, wobei die Bedeutung der vertrauten Landschaft und der Wiedererkennung für Ildikós Identitätsfindung im Vordergrund steht. Der Kontrast zwischen dem Vater, der im Stillstand der Heimat einen Rückschlag sieht, und Ildikós tiefer Verbundenheit mit der Landschaft wird herausgearbeitet. Die Arbeit betont, dass sich Heimat und Identität, obwohl räumlich und innerlich unterschiedlich, im Roman eng verzahnen.
Leben in der Schweiz: Dieser Abschnitt beleuchtet Ildikós Erfahrungen mit Integration, Assimilation und Identifikation in der Schweiz. Es wird untersucht, wie die Auseinandersetzung mit der Fremde die eigene Identität prägt und die Entwicklung der Protagonistin vorantreibt. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Selbsterfahrung und Selbstfindung im Kontext der neuen Umgebung und dem Vergleich mit der vertrauten Heimat.
Fremde: Dieses Kapitel widmet sich dem Aspekt der Fremde in Ildikós Leben. Es umfasst sowohl die Erfahrung des Wegzugs aus der Vojvodina und der Ankunft in der Schweiz als auch die Wahrnehmung von Fremden in ihrer Heimat. Die Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und die Komplexität der Beziehungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten im Roman werden erörtert.
Ildikós Zwischenwelt: (Anmerkung: Da kein konkreter Inhalt zu diesem Kapitel im bereitgestellten Text vorhanden ist, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Heimat, Fremde, Identität, Emigration, Integration, Assimilation, Vojvodina, Schweiz, Familie Kocsis, Ildikó, Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf, Selbsterfahrung, Zugehörigkeit, Entfremdung.
Häufig gestellte Fragen zu "Tauben fliegen auf" von Melinda Nadj Abonji
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konzepte von Heimat und Fremde im Roman "Tauben fliegen auf" von Melinda Nadj Abonji, indem sie die subjektive Wahrnehmung der Protagonistin Ildikó untersucht. Der Fokus liegt auf den individuellen Faktoren, die Ildikós Verständnis von Heimat und Fremde prägen, während der politische Kontext nur am Rande betrachtet wird.
Welche Themen werden im Roman und in der Analyse behandelt?
Die Analyse beleuchtet die Definition von Heimat und ihre Verbindung zur Identität, den Einfluss von Kindheit, Sozialisation, Traditionen, Essen und Sprache auf das Heimatgefühl, die Erfahrung der Fremde und ihre Rolle in der Identitätsentwicklung, die Ambivalenz von Heimat und Fremde im Kontext der Emigration sowie die Suche nach Zugehörigkeit und Selbstfindung im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde.
Welche Kapitel umfasst die Analyse und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Analyse umfasst die Kapitel: Einleitung (Vorstellung des Romans und der Forschungsfrage), Ildikós Heimat (Ildikós Verständnis von Heimat, insbesondere der Vojvodina), Leben in der Schweiz (Integration, Assimilation und Identifikation in der Schweiz), Fremde (Erfahrung des Wegzugs und der Ankunft, Wahrnehmung von Fremden in der Heimat, Fremdenfeindlichkeit), Ildikós Zwischenwelt (kein konkreter Inhalt im bereitgestellten Text) und Schluss (nicht detailliert beschrieben).
Wie wird Ildikós Heimat dargestellt?
Ildikós Heimat, die Vojvodina, wird als eng mit ihrer Identität verbunden dargestellt. Die vertraute Landschaft und die Wiedererkennung spielen eine wichtige Rolle für ihre Identitätsfindung. Der Kontrast zwischen dem Vater, der die Heimat als rückständig sieht, und Ildikós tiefer Verbundenheit wird hervorgehoben.
Wie wird Ildikós Erfahrung in der Schweiz beschrieben?
Der Abschnitt über das Leben in der Schweiz beleuchtet Ildikós Auseinandersetzung mit Integration, Assimilation und Identifikation in der neuen Umgebung. Es wird untersucht, wie die Erfahrung der Fremde ihre Identität prägt und ihre Entwicklung vorantreibt.
Wie wird das Thema "Fremde" im Roman behandelt?
Das Kapitel "Fremde" behandelt sowohl die Erfahrung des Wegzugs aus der Vojvodina und der Ankunft in der Schweiz als auch die Wahrnehmung von Fremden in Ildikós Heimat. Die Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und die Komplexität der Beziehungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Roman und die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Heimat, Fremde, Identität, Emigration, Integration, Assimilation, Vojvodina, Schweiz, Familie Kocsis, Ildikó, Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf, Selbsterfahrung, Zugehörigkeit, Entfremdung.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse konzentriert sich auf die subjektive Wahrnehmung der Protagonistin und deren Einflussfaktoren. Der politische Kontext wird nur am Rande beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich darauf, die prägnantesten Beispiele für die Thematik herauszuarbeiten.
- Quote paper
- Nadja Krakowski (Author), 2012, Heimat und Fremde in Melinda Nadj Abonjis "Tauben fliegen auf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195820