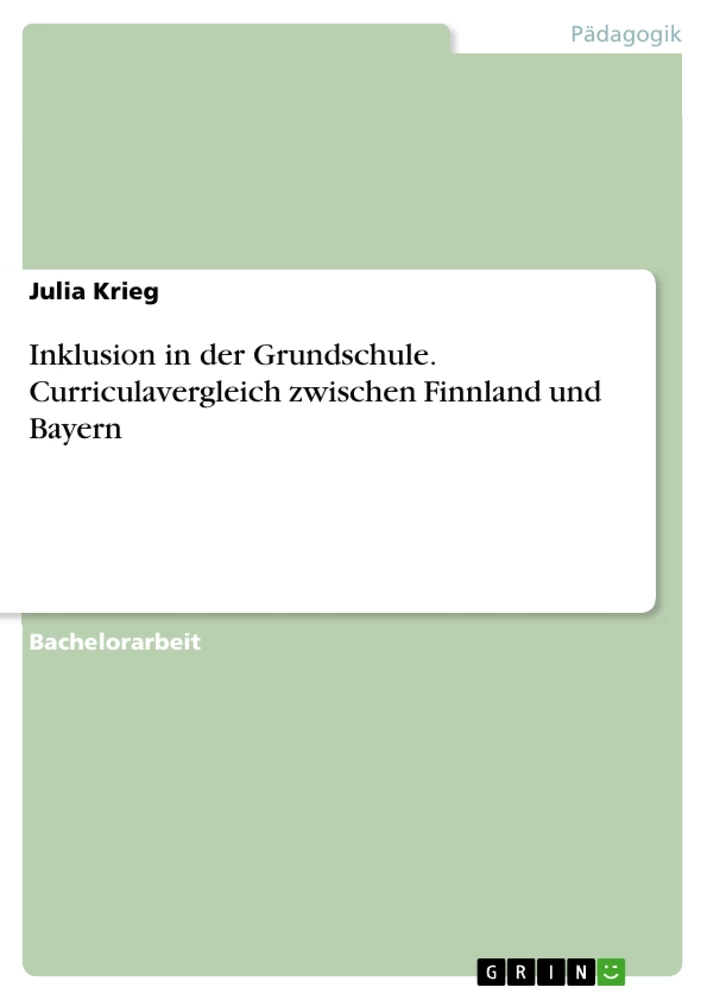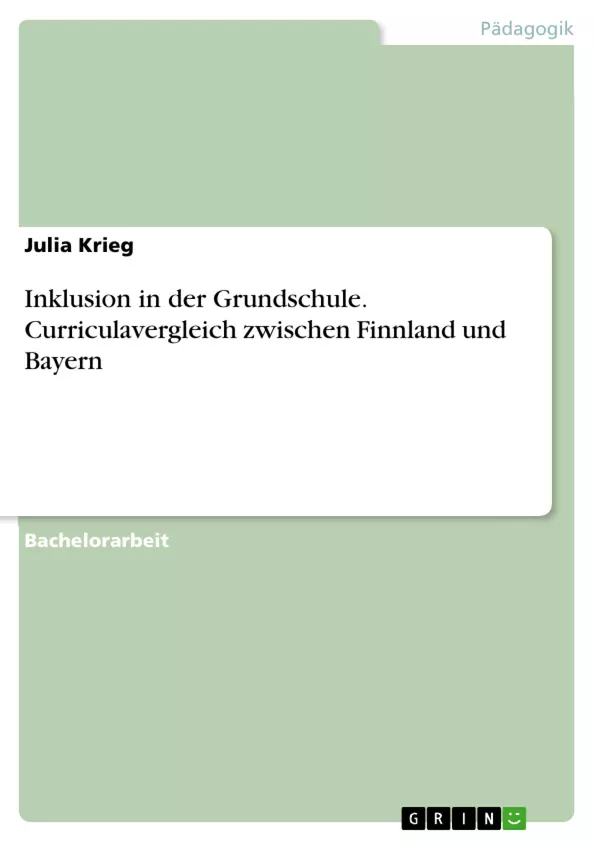„Alle Menschen sind verschieden“. Eine Selbstverständlichkeit, welche offensichtlich immer noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft und Politik verankert ist. Empirische Zugänge wie Bildungsberichte oder Leistungserhebungsstudien im internationalen Vergleich zeigen offenbar, dass Schüler/-innen aufgrund ihrer sozialen Herkunft, Religion oder auch Behinderung aus dem Bildungssystem separiert werden und dadurch das Prinzip der Chancengleichheit nicht gewährleistet ist.
Grundstein der aktuellen öffentlichen Fachdiskussion, ist die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, welche 2008 in Deutschland in Kraft getreten ist. Dadurch haben der Begriff und die Herausforderung der Inklusion enorm an Bedeutung gewonnen. Das Augenmerk wird mehr und mehr auf Menschen mit Behinderung oder mit besonderen Bedürfnissen gelegt. Bezeichnend für den Begriff ist die konsequente Gemeinsamkeit des Lebens, Lernens und Spielens von Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung. Das Prinzip erklärt sich sozusagen von selbst und scheint fast so selbsterklärend, dass die Frage offen bleibt, weshalb eine derart große Fachdiskussion stattfindet.
Die Wege des gemeinsamen Lernens werden beim Gehen sicherer werden, im Sinne von Jakob Muth, ein deutscher Professor, der durch seinen Einsatz für die Integration behinderter Kinder ins Schulwesen bekannt wurde. Die Intention steht also für die Handlung der Veränderung und nicht primär auf Diskussionen, Studien oder Ländervergleichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methode / Überblick
3. Begriffsbestimmungen
3.1.Soziale Gerechtigkeit / Ungleichheit
3.2. Integration
3.3. Inklusion
3.4. Exklusion / Segregation
3.5. Curriculum
4. Rechtliche Grundlagen
4.1. Behindertenrechtskonvention
4.2. UN- Kinderrechtskonvention
4.2.1. Artikel 2 [Achtung der Kinderrechte]; Diskriminierungsverbot
4.2.2. Artikel 23 [Förderung behinderter Kinder]
4.3. Grundgesetz
4.3.1. Artikel 1 [Schutz der Menschenwürde]
4.3.2. Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz]
4.4. Sozialgesetzbuch
4.4.1. SGB 1 § 10 [Teilhabe behinderter Menschen]
4.5.Rechtslage in Bayern
4.5.1. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
5. Entwicklung von Inklusion
5.1. Globalisierung
5.2. Demographische Entwicklung
5.3. Entwicklung in der Europäischen Union
6. Empirische Zugänge
6.1. PISA
6.2. „Gemeinsam lernen, Inklusion leben“ Bertelsmann Stiftung
6.3. Bildungsbericht 2010
7. Das Bildungswesen im Freistaat Bayern - Deutschland
7.1. Sozio-kultureller Hintergrund des Bildungs- und Sozialwesens
7.2. Entwicklung des bayerischen Schulsystems
7.3. Strukturen des bayerischen Bildungswesens im Überblick
7.4. Lehrerbildung
7.5. Sozial – und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
7.6. Pädagogisch, Didaktischer Umgang mit Minderheiten
8. Das Bildungswesen in Finnland
8.1. Sozio-kultureller Hintergrund des Bildungs- und Sozialwesens
8.2. Entwicklung des finnischen Schulsystems
8.3. Strukturen des finnischen Bildungswesens im Überblick
8.4. Lehrerbildung
8.5. Sozial – und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
8.6. Pädagogisch, Didaktischer Umgang mit Minderheiten
9. Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Systeme
9.1. Organisation von Unterstützungssystemen
9.2. Lehrerprofessionalisierung
9.3. Schulische Gestaltung pädagogischer Prozesse
10. Pädagogische Folgerungen zur Inklusiven Pädagogik
10.1. Die Gemeinschaftsschule
10.2. Individuelle Förderung
10.3. Chancengleichheit
10.4. Partizipation
10.5. Index for inclusion
11. Schlussbetrachtung
11.1. Kritische Betrachtung Inklusiver Pädagogik
11.2. Neue Forschungsfragen
11.3. Fazit
12. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration bedeutet die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in ein bestehendes System. Inklusion geht weiter: Das System selbst wird so verändert, dass alle Menschen von vornherein gleichberechtigt teilhaben können.
Welche rechtliche Grundlage ist für die Inklusion entscheidend?
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2008 in Deutschland in Kraft getreten ist, bildet den wichtigsten rechtlichen Rahmen für die Umsetzung inklusiver Bildung.
Wie unterscheidet sich das Bildungswesen in Finnland von dem in Bayern?
Finnland setzt stark auf ein gemeinsames Lernen aller Schüler in einer Gemeinschaftsschule, während Bayern traditionell ein gegliedertes Schulsystem mit verschiedenen Schularten verfolgt, was die Inklusion vor andere strukturelle Herausforderungen stellt.
Warum spielt die Lehrerbildung eine zentrale Rolle für die Inklusion?
Inklusion erfordert neue pädagogische und didaktische Kompetenzen. Lehrer müssen lernen, mit einer heterogenen Schülerschaft umzugehen und individuelle Förderpläne zu erstellen.
Was ist der „Index for Inclusion“?
Der Index for Inclusion ist ein Leitfaden, der Schulen dabei unterstützt, ihre Kulturen, Strukturen und Praktiken im Hinblick auf Inklusion zu analysieren und weiterzuentwickeln.
Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft auf den Bildungserfolg?
Empirische Studien wie PISA zeigen, dass in Deutschland der Bildungserfolg noch immer stark von der sozialen Herkunft abhängt. Inklusion zielt darauf ab, diese Ungleichheit abzubauen.
- Citar trabajo
- Julia Krieg (Autor), 2011, Inklusion in der Grundschule. Curriculavergleich zwischen Finnland und Bayern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196576