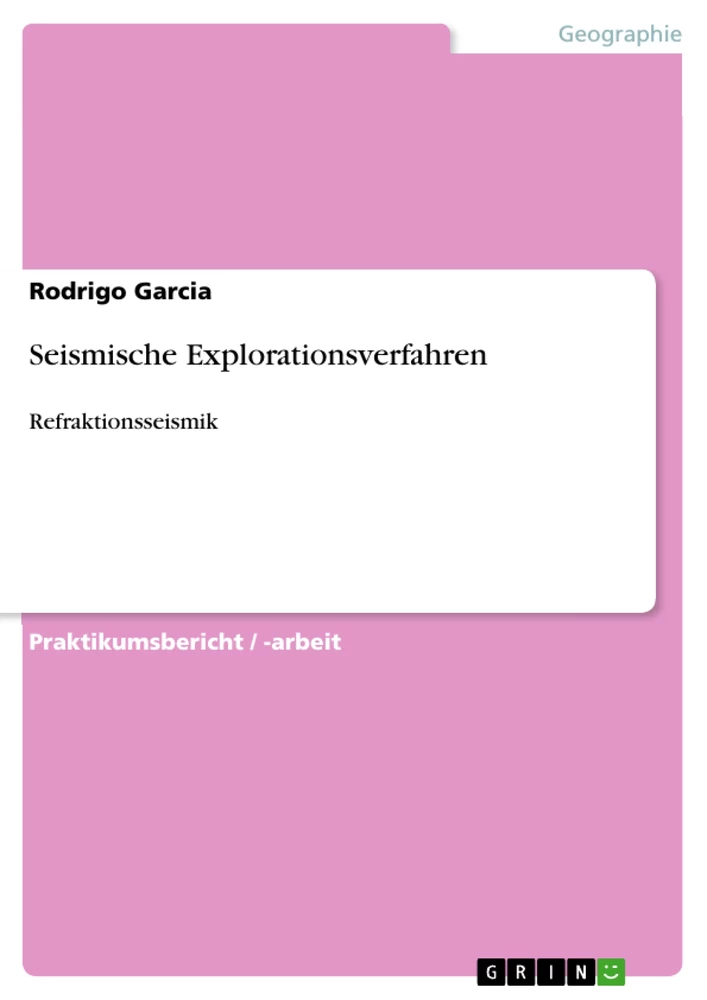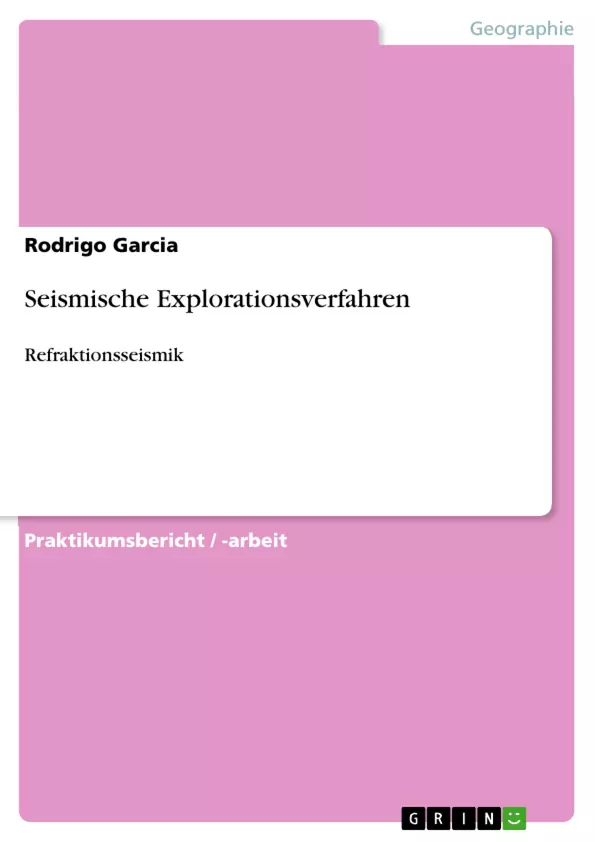In diesem Bericht wird die Refraktionsseismik anhand eines Profils aus dem Bergischen Land vorgestellt, erklärt und nachvollziehbar berechnet.
Inhaltsverzeichnis
Einführung:
Aufbau:
Laufzeitkurven:
Auswertung:
Geschwindigkeit:
Lagerung des unteren Halbraums:
Kritischer Winkel:
Tiefe:
Teufe:
Schichtgefüge:
Fehlerdiskussion:
Quellen:
Einführung:
Refraktionsseismik
Bei der Refraktionsseismik wird ein Signal zum Beispiel durch Hammerschlag oder Sprengung oder in den Boden gesendet. Das Signal pflanzt sich halbkreisförmig im Untergrund fort. Die Wellen teilen sich auf in Kompressionswellen (P-Wellen) und Scherwellen (S-Wellen). Kompressionswellen sind immer schneller als Scherwellen und bewegen sich auch im flüssigen Medium aus. Trifft die Wellenfront auf eine Schicht im Untergrund wird der Wellenstrahl gebrochen. Ist die Wellengeschwindigkeit in der unteren Schicht niedriger als in der oberen, wird der Wellenstrahl zum Lot hin gebrochen. Eine solche Schichtgrenze ist durch Refraktionsseismik nicht zu erkennen. Liegt die Wellengeschwindigkeit in der unteren Schichtjedoch höher als in der oberen Schicht, so wird der Wellenstrahl vom Lot weg gebrochen. Fällt der Einfallwinkel unter einen bestimmten Wert, wird die Welle kritisch refraktiert. Das heißt, der Wellenstrahl verläuft an der Grenzfläche zwischen den beiden Schichten. Diesen Winkel nennt man kritischen Winkel. Die Welle wird Mintropwelle oder Kopfwelle genannt. Das Signal wird nun fortlaufend im kritischen Winkel an die Oberfläche geschickt. Die Entfernung zum Schusspunkt, in der das Signal zum ersten Mal die Oberfläche erreicht, nennt man kritische Entfernung. Diese Entfernung ist abhängig vom kritischen Winkel und der Mächtigkeit der oberen Schicht. Da die sich die Kopfwelle schneller fortbewegt, als die Oberflächenwelle, überholt sie diese, obwohl sie eine deutlich längere Strecke zurücklegt. Die Entfernung zum Schusspunkt, in der die Kopfwelle die Oberflächenwelle überholt, wird Überholentfernung genannt. In der Laufzeitkurve macht sich dies durch einen Knick bemerkbar, an dem die Steigung sinkt, also die Geschwindigkeit steigt. Im Mehrschichtfall gibt es fürjede Schichtgrenze, an der kritisch refraktiert wird, einen solchen Knick. Verlängert man die Grade der Kopfwellen in der Laufzeitkurve bis zum Ursprung, bekommt man die Interceptzeit. Schwankt die Interceptzeit bei Schuss und Gegenschuss deutlich, weist das auf eine nicht-söhlige Lagerung der überdeckten Schicht hin. Die Geschwindigkeiten der Kopfwelle sind dann nicht die wahren Geschwindigkeiten, sondern scheinbare Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit der Oberflächenwelle sollte allerdings auch bei nicht-söhliger Lagerung bei Schuss und Gegenschuss die gleiche sein. Ist die Schicht zum Schusspunkt geneigt (down-dip), ist die Interceptzeit verlängert. Fällt die Schicht vom Schusspunkt weg ein (up-dip), ist die Interceptzeit verkürzt. Der aus einem einzigen Profil ermittelte Einfallwinkel ist dabei immer der Mindesteinfallwinkel. Um den genauen Einfallwinkel zu bestimmen, benötigt man ein zweites Profil, dass das erste orthogonal schneidet.
Aufbau:
Um die oberflächennahen Schichten besonders genau aufzulösen, ist es erforderlich die Abstände zwischen den Geophonen in der Nähe der Schusspunkte besonders klein zu halten. Der Geophonabstand wird schrittweise von 0,5m auf 1m und 2m erhöht. Es wird pro Messungjeweils fünf mal angeregt, wobei das verwendete Terralok MK6 die Ergebnisse automatisch stapelt. Das heißt, dass die Intensitäten addiert werden. Dadurch wird das Signal verstärkt und der Noise mittelt sich raus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Laufzeitkurven:
Schuss:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gegenschuss:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Quote paper
- Rodrigo Garcia (Author), 2012, Seismische Explorationsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196782