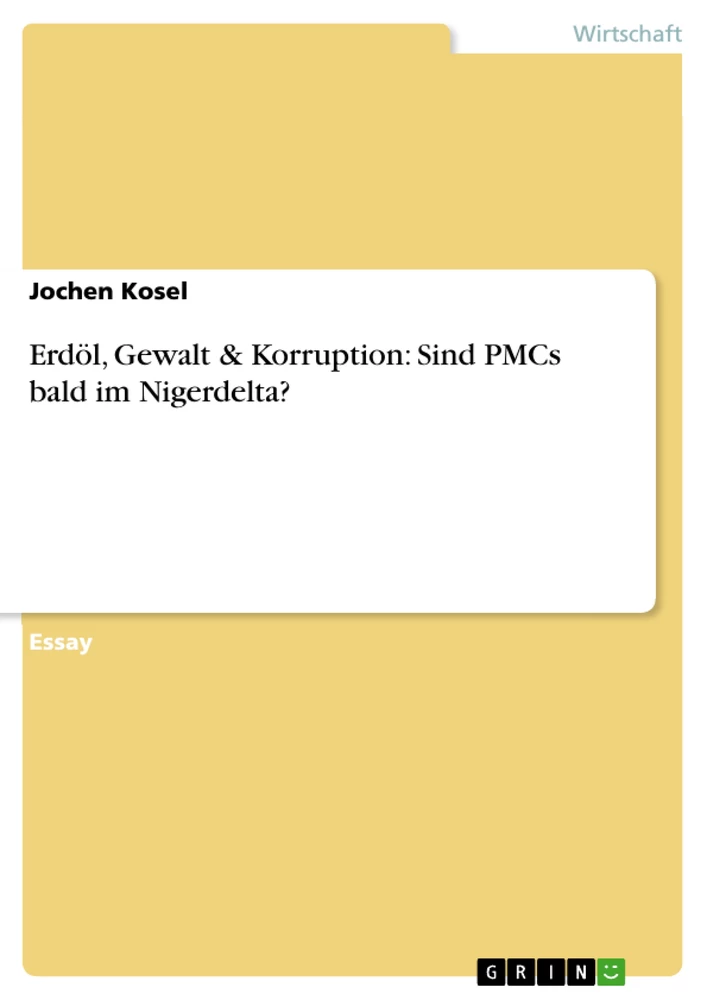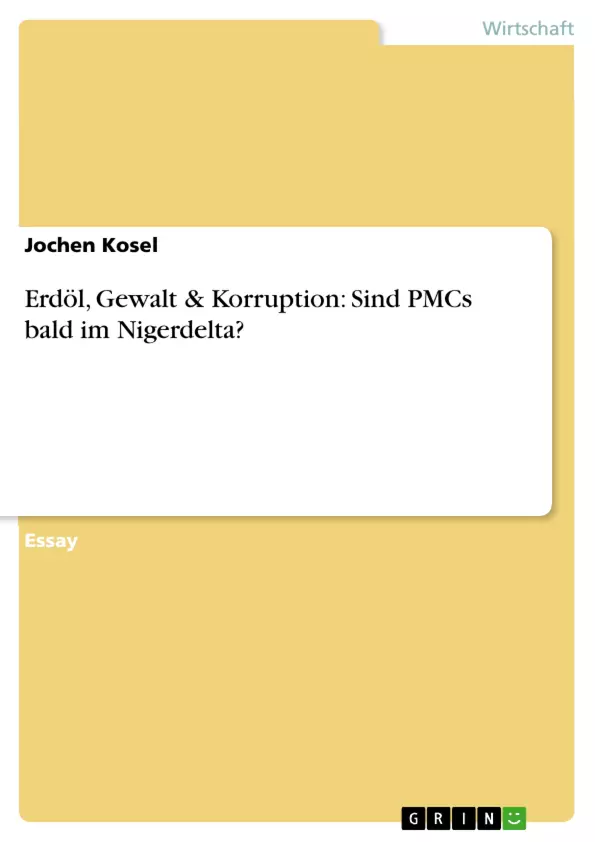Nigeria ist der bevölkerungsreichste Staat Afrikas und zugleich der größte Rohölexporteur des Kontinents. Im weltweiten Vergleich liegt das OPEC-Mitglied an achter Stelle laut der Ener-gy Information Administration (vgl. EIA 2008). Seit dem Ölboom in den 1970er Jahren ist Erdöl das Hauptexportgut Nigerias, das dem Staat 95% seiner Einkünfte aus Devisengeschäf-ten (vgl. CIA World Factbook 2008) und etwa 80% der Staatseinnahmen beschert.
Doch von diesen 60 Milliarden US-Dollar sieht die Bevölkerung des Nigerdeltas, der Haupt-förderregion nigerianischen Erdöls, so gut wie nichts. Stattdessen wurde den Bewohnern durch die massive Umweltzerstörung, die durch die jahrzehntelange Erdölförderung entstan-den ist, ihre Lebensgrundlage entzogen. (vgl. Heiduk, Kramer 2005: 341). Auf der Rangliste des Human Development Index rangiert Nigeria auf Platz 159 von 177 Staaten (vgl. Saam 2008: 13). Nach amtlichen Angaben lebt mindestens die Hälfte der Bevölkerung Nigerias von weniger als einem Dollar pro Tag (vgl. ebd.), andere Schätzungen gehen von etwa zwei Drittel aus (vgl. Pomrehm 2006).
Im Jahresbericht 2005 von Amnesty International heißt es: “Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der Bewohner des Nigerdeltas […] wurden weithin nicht respektiert, sodass es zunehmend zu Spannungen […] kam” (Amnesty International 2005). Diese Span-nungen entladen sich einerseits in Anschlägen auf Pipelines und Förderanlagen, andererseits in Entführungen von Mitarbeitern von Ölfirmen. Laut Matthias Basedau vom Institut für Afrika-Kunde in Hamburg gibt es “eine Mixtur von Gründen für diesen Konflikt” (Trost 2006).
Im Folgenden werde ich die wichtigsten Gründe darlegen und aufzeigen, warum ein Einsatz von PMCs im Nigerdelta für die Ölkonzerne eine Option darstellt.
Einleitung
Nigeria ist der bevölkerungsreichste Staat Afrikas und zugleich der größte Rohölexporteur des Kontinents. Im weltweiten Vergleich liegt das OPEC-Mitglied an achter Stelle laut der Energy Information Administration (vgl. EIA 2008). Seit dem Ölboom in den 1970er Jahren ist Erdöl das Hauptexportgut Nigerias, das dem Staat 95% seiner Einkünfte aus Devisengeschäften (vgl. CIA World Factbook 2008) und etwa 80% der Staatseinnahmen beschert.
Doch von diesen 60 Milliarden US-Dollar sieht die Bevölkerung des Nigerdeltas, der Hauptförderregion nigerianischen Erdöls, so gut wie nichts. Stattdessen wurde den Bewohnern durch die massive Umweltzerstörung, die durch die jahrzehntelange Erdölförderung entstanden ist, ihre Lebensgrundlage entzogen. (vgl. Heiduk, Kramer 2005: 341). Auf der Rangliste des Human Development Index rangiert Nigeria auf Platz 159 von 177 Staaten (vgl. Saam 2008: 13). Nach amtlichen Angaben lebt mindestens die Hälfte der Bevölkerung Nigerias von weniger als einem Dollar pro Tag (vgl. ebd.), andere Schätzungen gehen von etwa zwei Drittel aus (vgl. Pomrehm 2006).
Im Jahresbericht 2005 von Amnesty International heißt es: “Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der Bewohner des Nigerdeltas […] wurden weithin nicht respektiert, sodass es zunehmend zu Spannungen […] kam” (Amnesty International 2005). Diese Spannungen entladen sich einerseits in Anschlägen auf Pipelines und Förderanlagen, andererseits in Entführungen von Mitarbeitern von Ölfirmen. Laut Matthias Basedau vom Institut für Afrika-Kunde in Hamburg gibt es “eine Mixtur von Gründen für diesen Konflikt” (Trost 2006).
Im Folgenden werde ich die wichtigsten Gründe darlegen und aufzeigen, warum ein Einsatz von PMCs im Nigerdelta für die Ölkonzerne eine Option darstellt.
Gründe für den Konflikt
Bedingt durch die Tatsache, dass die “Staatskasse […] heute zu ca. 80% von den Petroleum-Dollars [abhängt]” (Saam 2008:13f.), sinkt die Relevanz der Steuereinnahmen für den Staat. Dies bedeutet allerdings auch, dass der Staat den Bürgern keine Rechenschaft ablegen muss, denn wer “von den Bürgern nichts verlangen muss, dem entstehen auch keine Pflichten” (Glüsing et al 2006). So prangerte der Schriftsteller Ken Saro-Wiwa, der 1995 hingerichtet wurde, die Lebensumstände des im Nigerdelta lebenden Ogoni-Volkes an:“80 Prozent Analphabeten, ein Arzt für 70000 Menschen, 85 Prozent Arbeitslose, eine Lebenserwartung von 51 Jahren. Keine Straßen. Kein Leitungswasser. Keine Elektrizität” (Herrmann 1998).
Diese Missachtung der Lebensumstände des Ogoni-Volkes, dass stellvertretend für die gesamte Bevölkerung des Nigerdeltas steht, ist erst durch das Petroleum Decree von 1969 und das Land Use Decree von 1978 möglich geworden. Das Petroleum Decree enthielt eine Neuregelung des Zuteilungssystems aus Erdölerlösen. Wurden die Erlöse bis dahin jeweils zur Hälfte zwischen Staat und Bundesländern aufgeteilt, kontrollierte ab nun der Staat allein die Erlösverteilung. Aufgrund dieses Dekrets fließen mittlerweile nur noch ungefähr zehn Prozent der staatlichen Öleinnahmen zurück in das Nigerdelta (vgl. Klug 2006). Im Land Use Decree von 1978 ist sämtliches Land einschließlich der darunter liegenden Rohstoffe zu staatlichem Eigentum erklärt worden, auf dessen Grundlage die Gewinne der Erdölförderung direkt an die Eliten und in die Hauptstadt Ajuba fließen, ohne dass die Bewohner des Nigerdeltas daran beteiligt werden.
Stattdessen leidet die Bevölkerung des Nigerdeltas vor allem unter der enormen Umweltverschmutzung durch die Erdölförderung und dem Gas Flaring, dem Abfackeln von Gas, das in Kuppelproduktion mit dem Öl anfällt. Neben dem wirtschaftlichen Schaden, den die Weltbank auf ungefähr 2,5 Milliarden US-Dollar schätzt (vgl. Olukoya 2008), entsteht durch Gas Flaring auch ein immenser Schaden für Mensch und Klima. Durch das Abfackeln entstehen Dioxine und Karzinogene, die die Menschen täglich einatmen und die als saurer Regen in das Ökosystem geraten (vgl. ebd.).
Ähnlich katastrophal ist die Bilanz der Ölkonzerne in Bezug auf die Umweltverschmutzung, die mit der Ölförderung einhergeht. Die Pipelines sind verrostet und undicht. Zwischen 1976 und 2001 haben die offiziellen Stellen in Nigeria 6817 Ölaustritte registriert. Die Dunkelziffer übersteigt diesen Wert nach Schätzungen von Umweltorganisationen sogar um ein Zehnfaches (vgl. Thielke 2007).
Begünstigt wird dieses Verhalten der Erdölkonzerne durch die Korruption der nigerianischen Beamten, die “das Land als Selbstbedienungsladen [betrachten und] sich die Taschen [vollstopfen]” (Thielke 2007), wodurch einerseits unnötige Kosten und andererseits gewaltige Einnahmeverluste verursacht werden. Laut Transparency International belegt Nigeria Platz 152 von 159 Ländern in der Korruptionsrangliste (vgl Glüsing et al 2006).
Der Widerstand und seine Folgen
Das Verhalten der Regierung und der Ölkonzerne bestärkt Gruppen wie die “Movement for the Emancipation of the Niger Delta” (Mend), die im Januar 2006 erstmals in Erscheinung getreten ist und “sich durch Sabotage, Entführungen und tödliche Bomben [hervortut]” (Thielke 2007). Das Ziel der Mend ist, “auf das Unrecht aufmerksam [zu] machen, das den Einwohnern der ölreichen Region widerfahre” (ebd.), während andere Gruppen “die Öl-Multis ganz aus Nigeria weghaben [wollen]” (3sat.online 2006). Durch Entführungen von westlichen Mitarbeitern der Ölkonzerne versuchen diese Gruppen, ihre politischen Forderungen in den Westen zu tragen, um dadurch den Druck auf die eigene Regierung zu erhöhen (vgl. ebd.).
Den Schaden, den Gruppen wie Mend durch Anschläge auf Förderanlagen und Pipelines anrichten, kann man bereits deutlich ablesen. Statt der möglichen 2,6 Millionen Barrel pro Tag können die Ölkonzerne nur zwei Millionen Barrel täglich produzieren, was bei einem Preis von ungefähr 130 Dollar pro Barrel (abzüglich der Gestehungskosten von 2 Dollar pro Barrel an Land und fünf bis sieben Dollar auf See) eine tägliche Einbuße von 78 Millionen Dollar bedeutet (vgl. ebd.).
Rolle der USA
An einer weiteren Drosselung der Produktion haben neben Nigeria und den Ölkonzernen auch die USA kein Interesse, da Nigeria der fünftgrößte Lieferant der USA ist und von den USA als “Treibstoff-Reservetank” (ebd.) betrachtet wird. Um die Sicherheit im Nigerdelta wiederherzustellen, setzt die nigerianische Regierung auch Streitkräfte des Militärs ein, die allerdings nach der jahrzehntelangen Militärdiktatur einen sehr schlechten Ruf genießen und in einem maroden Zustand gewesen sind. Einer Studie der US-amerikanischen PMC Military Professional Resources Incorporated (MPRI) aus dem Jahr 2000 zufolge, die jeweils zur Hälfte von Nigeria und den USA finanziert wurde, war 75% der militärischen Ausrüstung der nigerianischen Armee entweder defekt oder nicht einsatzfähig (vgl. Singer 2006: 103). Nachdem MPRI Empfehlungen zur “Reprofessionalisierung” der Streitkräfte vorgelegt hatte, erhielt das Unternehmen anschließend auch den Auftrag in Höhe von 7 Millionen Dollar, diese Empfehlungen umzusetzen. Innerhalb des US-amerikanischen Programms Africa Contingency Operations Training Assistance (Acota), in dem afrikanische Soldaten unter US-Anleitung ausgebildet werden, gilt die Zusammenarbeit mit den militärischen Ausbildungszentren des Joint Combined Arms Training System (JCATS) als unverzichtbar (vgl. Abramovici 2004). Das erste JCATS-Zentrum ist im November 2003 in Abuja in Betrieb genommen worden und wird, wie alle weiteren auch, von MPRI geleitet (vgl. ebd.).
Damit haben es die Amerikaner geschafft, eine PMC in einem Land zu “installieren”, in dem es Konzernen verboten ist, private bewaffnete Sicherheitskräfte einzustellen (vgl. Heiduk 2005: 341). Damit sind allerdings noch nicht die Probleme behoben, denen die Ölkonzerne tagtäglich ausgesetzt sind. Im Jahr 2007 sind allein 47 Shell-Mitarbeiter im Nigerdelta entführt worden. Zwei Shell-Angestellte sind bei einem Rebellen-Angriff getötet worden und ein weiterer kam bei einem Feuer ums Leben, das durch Öldiebstahl entstanden war (vgl. Shell 2008). Nach Angaben von Shell sei es schwierig für das Unternehmen, mit der nigerianischen Joint Task Force, die aus Armee, Navy und Polizei zusammengestellt ist, in Kontakt zu treten, “as they operate solely under the command and control of the Nigerian government or security headquarters” (ebd.).
[...]
- Quote paper
- M.A. Jochen Kosel (Author), 2008, Erdöl, Gewalt & Korruption: Sind PMCs bald im Nigerdelta?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196796