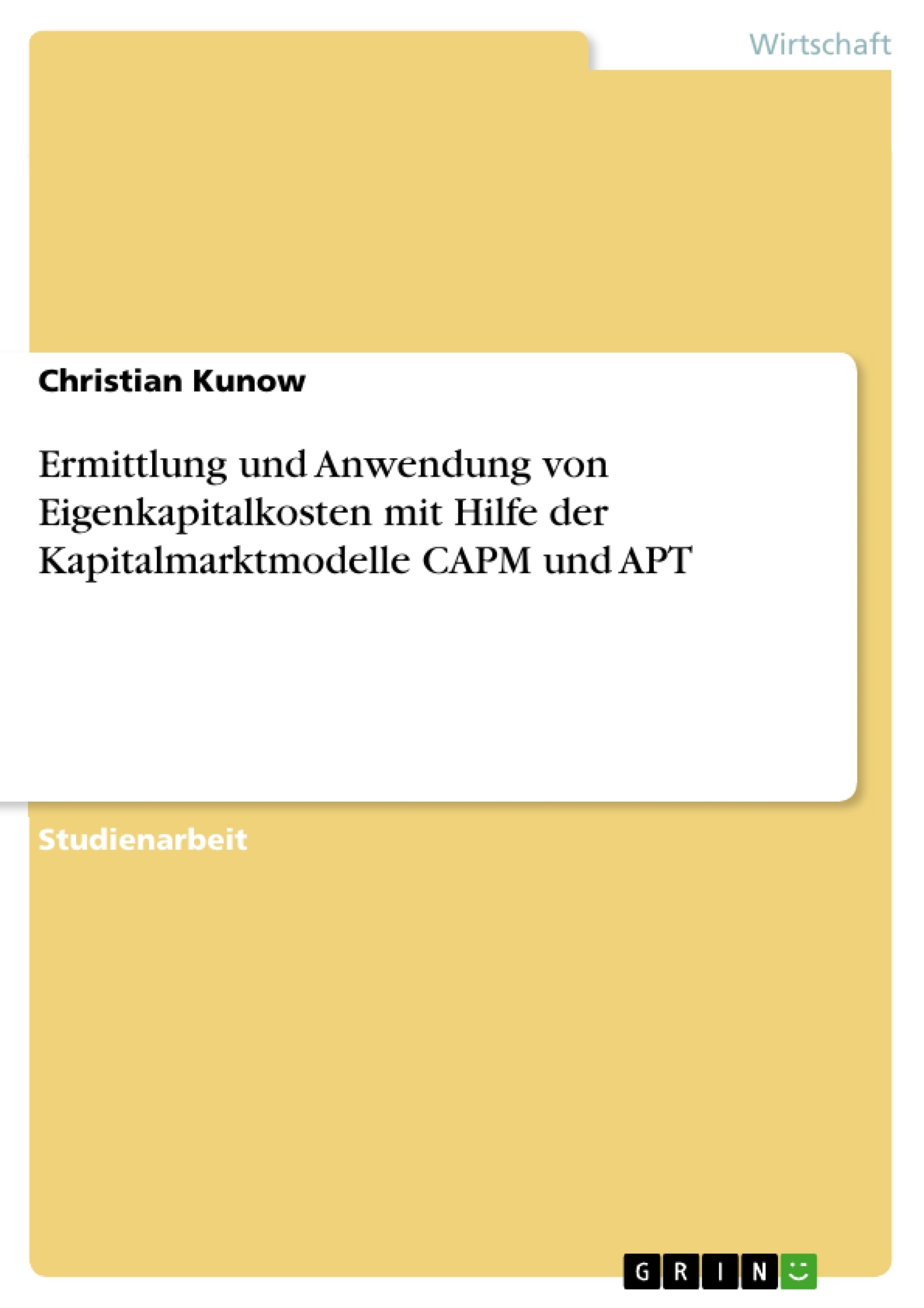Bei der Finanzierung müssen sich sowohl diejenigen, die Kapital zur Verfügung stellen als auch die, die Kapital in Anspruch nehmen, die Frage stellen: wie können die finanziellen Mittel optimal eingesetzt werden? Die Kapitalgeber beanspruchen für die Überlassung ihrer Finanzmittel eine vereinbarte Zinszahlung (bei Fremdkapitalgeber) bzw. eine dem Risiko angemessene Rendite (bei Eigenkapitalgeber). Die Kapitalnehmer verfolgen aber das Ziel, zum einen das überlassene Kapital im Unternehmen effizient einzusetzen. Zum anderen versuchen sie bei der Erfüllung der von den Kapitalgebern gestellten Forderung die vom Kapital verursachten Kosten gering zu halten. Beide Seiten sind dabei auf eine Berechnung von möglichst aussagekräftigen Renditen bzw. Kapitalkosten angewiesen. Im Unterschied zu den Fremdkapitalkosten, die relativ unproblematisch anhand von Kreditverträgen und der darin festgelegten Zins- und Til-gungszahlungen ermittelt werden können, ist die Bestimmung der Kosten des Eigenkapitals mit Problemen behaftet. Damit repräsentative Renditen bzw. Eigenkapitalkosten ermittelt werden können, werden kapitalmarkttheoretische Modelle eingesetzt. Die vorliegende Arbeit versucht mittels theoretischer Vorarbeiten (Abschnitt 2), der Vorstellung und des Vergleichs zweier Modelle und Beispielrechnungen (Abschnitt 3) eine Antwort auf die Eignung der Modelle für die Ermittlung von Renditen bzw. Eigenkapitalkosten (Abschnitt 4) zu finden.
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Finanzierungstheoretische Grundlagen
2.1 Kapitalkosten und Eigenkapitalkosten
2.2 Finanzierungstheorie
2.3 Portfoliotheorie
3. Kapitalmarktmodelle zur Ermittlung von Eigenkapitalkosten
3.1 Vorstellung zweier Modelle
3.1.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.1.2 Arbitrage Pricing Theory (APT)
3.2 Vergleich zwischen CAPM und APT
3.3 Anwendung des CAPM und der APT mittels Beispielrechnungen
4. Eignung des CAPM und der APT zur Ermittlung von Eigenkapitalkosten
4.1 Schwächen und Validität der Modelle
4.2 Modifikation und Varianten der Modelle
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Capital Asset Pricing Model (CAPM)?
Ein Gleichgewichtsmodell, das die erwartete Rendite eines Wertpapiers als lineares Verhältnis zum systematischen Risiko (Beta) beschreibt.
Wie unterscheidet sich die Arbitrage Pricing Theory (APT) vom CAPM?
Während das CAPM nur einen Risikofaktor (Marktrisiko) nutzt, geht die APT davon aus, dass mehrere makroökonomische Faktoren die Rendite beeinflussen.
Warum ist die Ermittlung von Eigenkapitalkosten schwierig?
Im Gegensatz zu Fremdkapitalzinsen sind Eigenkapitalkosten nicht vertraglich fixiert, sondern müssen als Renditeerwartung der Investoren geschätzt werden.
Was ist das "Beta" im CAPM?
Beta misst das systematische Risiko einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt; ein Beta von 1 bedeutet, dass die Aktie exakt so schwankt wie der Markt.
Welches Modell ist in der Praxis besser geeignet?
Die Arbeit vergleicht beide Modelle hinsichtlich ihrer Validität und Schwächen; das CAPM ist aufgrund seiner Einfachheit verbreiteter, die APT theoretisch fundierter.
- Quote paper
- B.Sc. Christian Kunow (Author), 2012, Ermittlung und Anwendung von Eigenkapitalkosten mit Hilfe der Kapitalmarktmodelle CAPM und APT, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196994