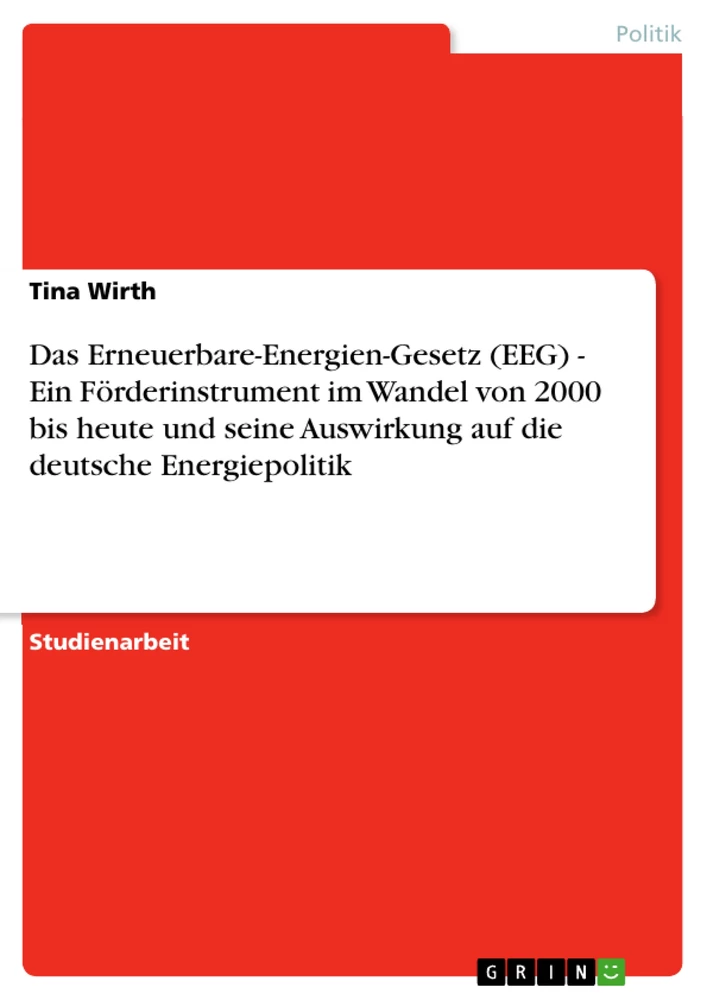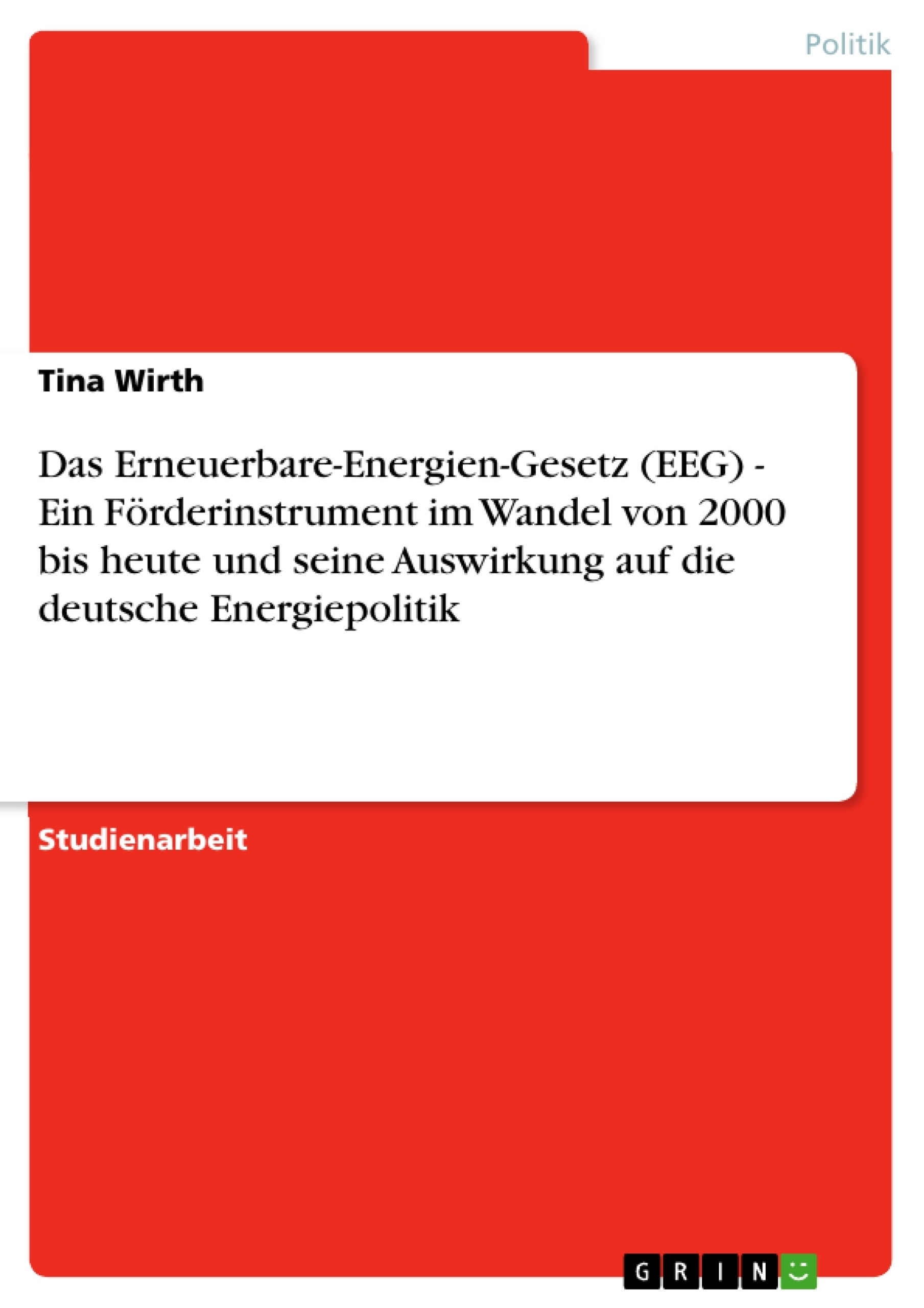Das Erneuerbare Energiengesetz (EEG) ist eine Erfolgsgeschichte. Als Förder- und Steuerinstrument, schaffte es den deutschen Energiemarkt so weit zu verändern, dass heute bereits rund 16% des produzierten Stroms und rund 10% der Energie in Deutschland auf regenerative Weise erzeugt wird. Damit ist Deutschland Weltmeister und konnte in zahlreichen Bereichen eine Vorreiterrolle einnehmen. Doch das EEG ist in seiner Anwendung und Zielsetzung alles andere als Unumstritten. Bereits die Grundlage, das Stromeinspeisungsgesetz, war in seiner Entstehung von Diskussionen geprägt und drohte aus parteipolitischen Gründen zu scheitern. Die Diskussion wurde in den folgenden Jahren fortgeführt und ging von der grundsätzlichen Frage einer Energiesubvention über die Höhe der eigentlichen Subvention und letztendlich bis hin zu der Frage, ob sich bei regenerativen Energien wenige Personen auf Kosten von vielen Anderen bereichern. Angeheizt wurde die Diskussion von Lobbyverbänden der einzelnen Industrien und schaffte stets die grundsätzliche Frage, ob die Atomenergie oder regenerative Energien der bessere Klimaschutz seien.
Inhalt
1. Einleitung
2. Das Erneuerbare Energiengesetz
2.1 Gesetzliche Vorläufer
2.2 Das EEG 2000
2.3 Die Novellierung zum EEG 2004
2.4 Das EEG 2009 und Ausblick auf künftige Veränderungen
3. Die Deutsche Energiepolitik
3.1 Die Rot-Grünen Jahre
3.2 Die große Koalition
3.3 Die Schwarz-Gelben Jahre- Ein Ausblick
4. Fazit
5. Literaturangabe
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)?
Das EEG ist das zentrale Förder- und Steuerungsinstrument für den Ausbau regenerativer Energien im deutschen Strommarkt.
Wann trat das erste EEG in Kraft?
Das ursprüngliche EEG trat im Jahr 2000 in Kraft und löste das Stromeinspeisungsgesetz ab.
Welchen Erfolg hatte das EEG bisher?
Es führte dazu, dass der Anteil regenerativer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland massiv anstieg (auf ca. 16% zum Zeitpunkt der Arbeit).
Warum ist das EEG umstritten?
Kritikpunkte sind die Höhe der Subventionen, die Kostenverteilung auf die Verbraucher und der Einfluss von Lobbyverbänden.
Was wurde in der Novellierung 2004 und 2009 geändert?
Die Novellierungen passten die Vergütungssätze an und setzten neue Ziele für den Ausbau der verschiedenen Energiequellen wie Wind, Sonne und Biomasse.
Wie beeinflusste die Politik das EEG?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze der Rot-Grünen Regierung, der Großen Koalition und der Schwarz-Gelben Jahre zur Energiepolitik.
- Quote paper
- Tina Wirth (Author), 2010, Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) - Ein Förderinstrument im Wandel von 2000 bis heute und seine Auswirkung auf die deutsche Energiepolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197846