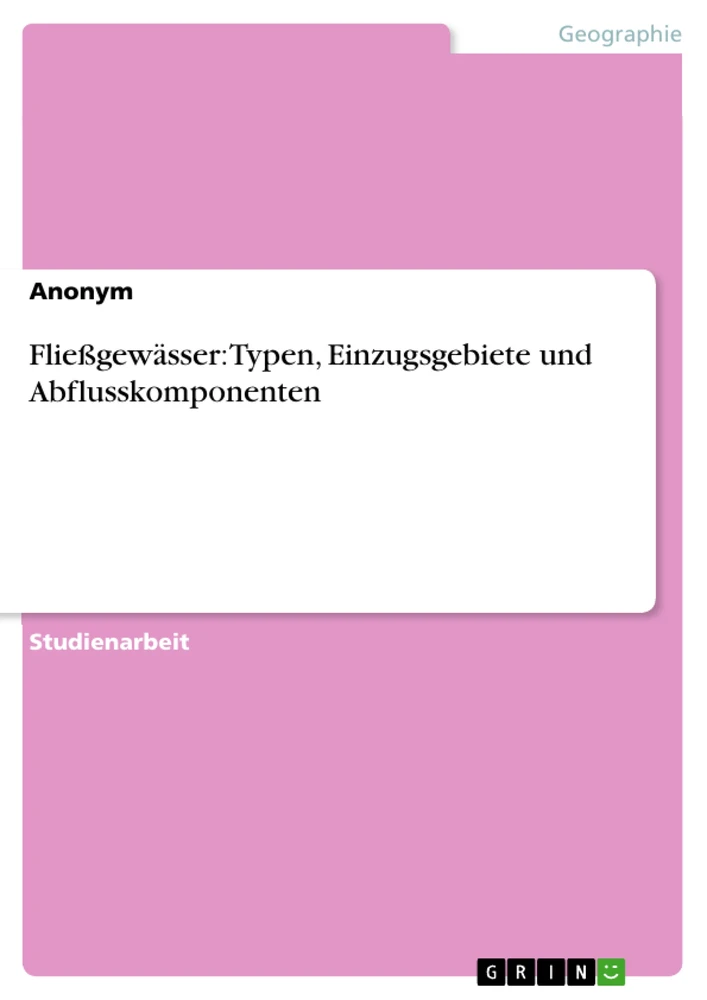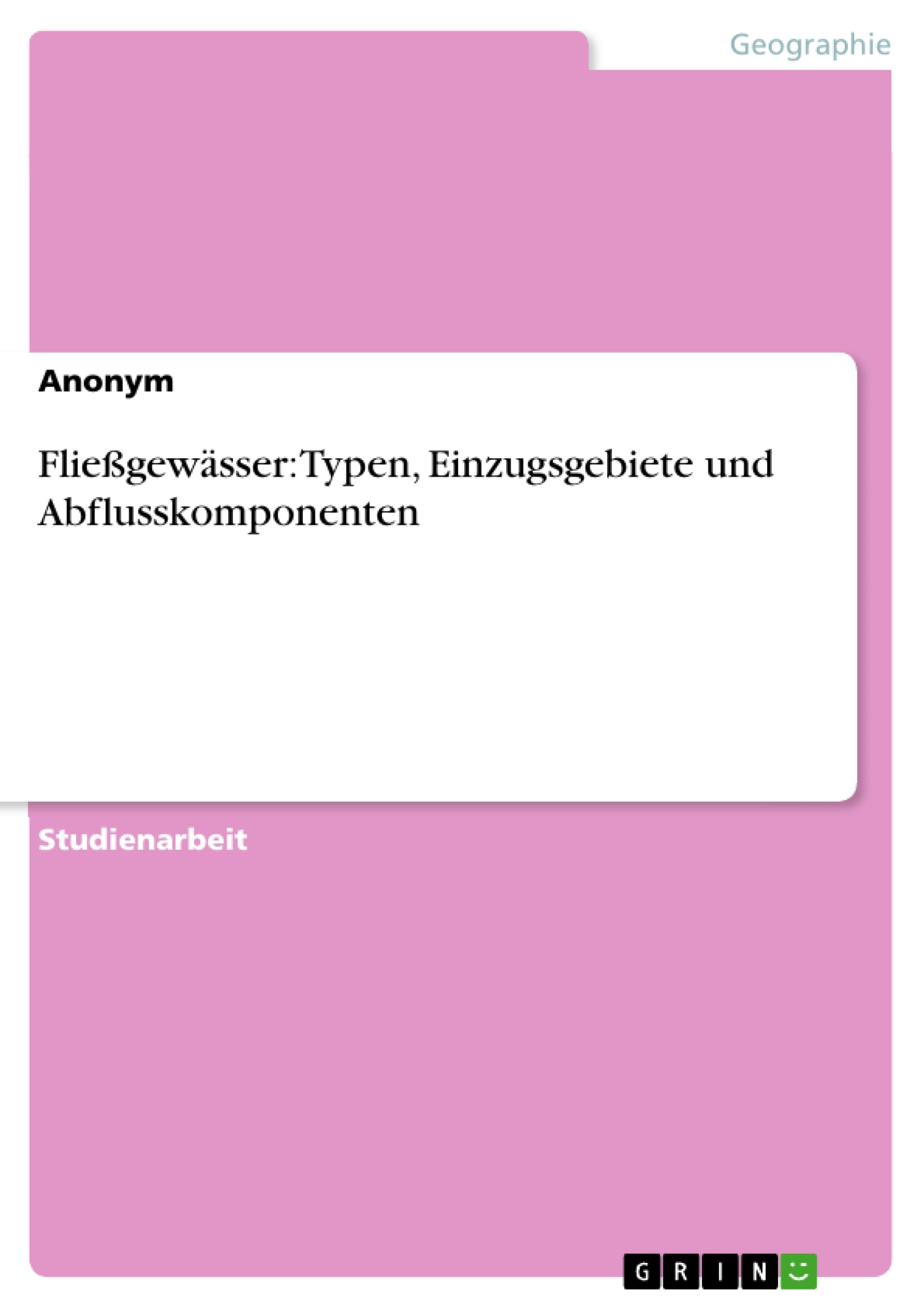In der vorliegenden Arbeit sollen die wichtigsten Typen, Einzugsgebiete und Abflusskomponenten von Fließgewässern dargestellt werden.
Aufgrund der Vielfalt der einzelnen Faktoren können hier nur die wichtigsten Aspekte aufgegriffen werden.
Nach einer Einführung in den Sachverhalt wird ein Überblick über verschiedene Ansätze von Fließgewässertypen erfolgen, mit deren Hilfe Fließgewässer strukturiert werden können. Um die theoretische Abhandlung des Themas in die Praxis umzusetzen, wird anknüpfend dazu das Beispiel einer Forschung über regionale Fließgewässertypen beschrieben werden.
Daran anschließend soll das Augenmerk auf die Bedeutung und den Einfluss der Einzugsgebiete für die Fließgewässer, sowie die Abflusskomponenten untersucht werden.
Auch wenn der Anteil des Wassers, welches sich in den Flüssen befindet, nur 0.0001% (Marcinek/Rosenkranz S. 30) des gesamten sich auf der Welt befindlichen Wasservorkommens darstellt, bestimmen Fließgewässer trotzdem weite Teile von Landschaftszonen und entwässern die Binnenregionen der Erde.
Doch was sind die besonderen Faktoren, die Fließgewässer charakterisieren? Inwieweit sind Fließgewässertypen hilfreich, verschiedenen Fließgewässerarten miteinander zu vergleichen?
Welchen Einfluss haben Einzugsgebiete auf die Fließgewässer und wie werden die genau bestimmt? In welchem Zusammenhang stehen diese Einzugsgebiete mit den Abflusskomponenten und wie werden diese Abflusskomponenten ermittelt?
Diese Fragen soll die vorliegende Arbeit herausstellen, um schließlich in der Zusammenfassung eine Antwort zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. FLIEBGEWÄSSER
- 2.1 FLIEBGEWÄSSERTYPEN
- 2.1.1 Allgemeine Fließgewässertypen
- 2.1.2 Regionale Fließgewässertypen: Angewandte Forschung
- 2.2 EINZUGSGEBIETE
- 2.3 ABFLUSSKOMPONENTEN
- 3 ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Typen, Einzugsgebieten und Abflusskomponenten von Fließgewässern. Sie soll einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Typisierung von Fließgewässern bieten und diese mit einem Beispiel aus der angewandten Forschung in Verbindung setzen. Darüber hinaus werden die Bedeutung und der Einfluss der Einzugsgebiete auf die Fließgewässer sowie die Ermittlung der Abflusskomponenten untersucht.
- Typisierung von Fließgewässern
- Regionale Fließgewässertypen in der Forschung
- Bedeutung und Einfluss von Einzugsgebieten
- Abflusskomponenten und deren Ermittlung
- Charakterisierung und Bedeutung von Fließgewässern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Wichtigkeit von Fließgewässern. Sie führt die wichtigsten Fragen auf, die in der Arbeit behandelt werden sollen.
2. Fließgewässer
Dieses Kapitel definiert Fließgewässer als das primäre Entwässerungssystem des Festlandes und erläutert die Voraussetzungen für ihre Entstehung. Es werden die verschiedenen Kategorien von Fließgewässern (rennierend, periodisch, episodisch) sowie deren Einteilung nach der mittleren Durchflussmenge (Bäche, kleine Flüsse, große Flüsse, Ströme) vorgestellt.
2.1 Fließgewässertypen
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Typisierung von Fließgewässern anhand verschiedener Vergleichsaspekte. Es werden allgemeine Fließgewässertypen und die Unterteilung nach topographischen, morphologischen, klimatischen und hydrologischen Merkmalen beschrieben.
2.1.1 Allgemeine Fließgewässertypen
Dieser Abschnitt erläutert verschiedene Ansätze zur Typisierung von Fließgewässern nach Keller (1961), wobei die Aspekte Topographie/ Morphographie, Klima und Hydrologie (Abflussregime) berücksichtigt werden. Die topographisch-morphologischen Flusstypen werden anhand einer Tabelle vorgestellt.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Fließgewässer nach ihrer Wasserführung eingeteilt?
Man unterscheidet zwischen rennierenden (ständig fließend), periodischen (regelmäßig versiegend) und episodischen (nur nach starken Niederschlägen fließend) Gewässern.
Welchen Einfluss hat das Einzugsgebiet auf einen Fluss?
Das Einzugsgebiet bestimmt die Menge und Qualität des Wassers, das einem Fluss zufließt, sowie dessen Abflussregime basierend auf Topographie, Klima und Bodenbeschaffenheit.
Was sind die wichtigsten Abflusskomponenten?
Zu den Komponenten gehören der Oberflächenabfluss, der Zwischenabfluss (Interflow) und der Grundwasserabfluss.
Wie werden Fließgewässertypen kategorisiert?
Die Typisierung erfolgt nach verschiedenen Kriterien wie Morphologie (Bach, Fluss, Strom), Klima, Hydrologie und regionalen Besonderheiten.
Warum machen Fließgewässer nur einen winzigen Teil des weltweiten Wassers aus?
Obwohl sie Landschaften prägen, enthalten Flüsse nur ca. 0,0001 % des globalen Wasservorkommens, da der Großteil in Ozeanen, Gletschern und im Grundwasser gespeichert ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Fließgewässer: Typen, Einzugsgebiete und Abflusskomponenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198187