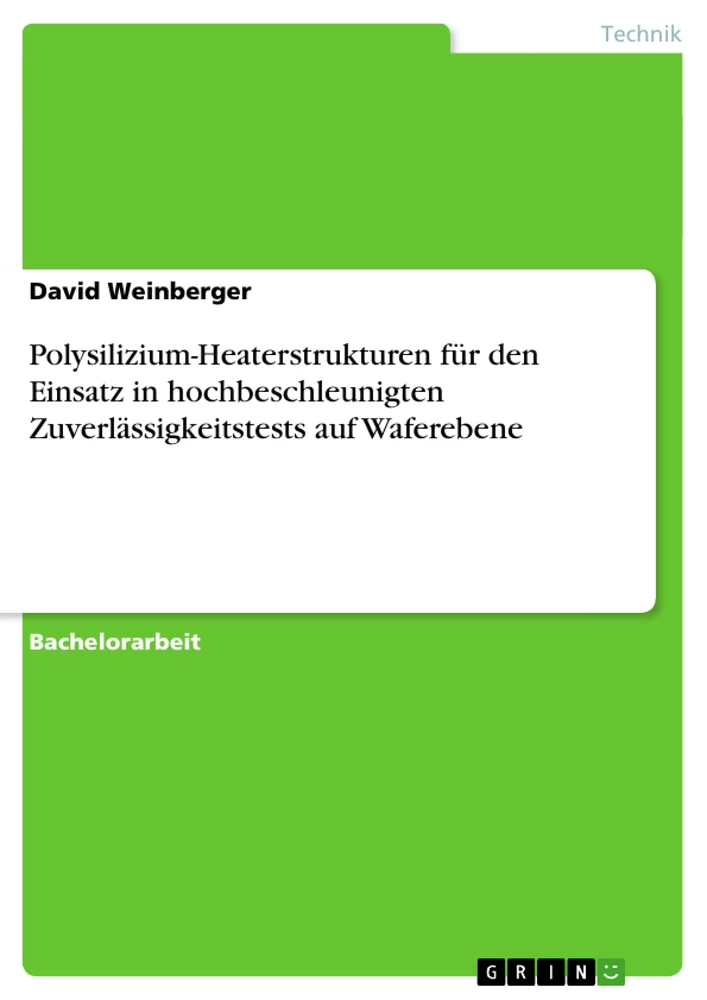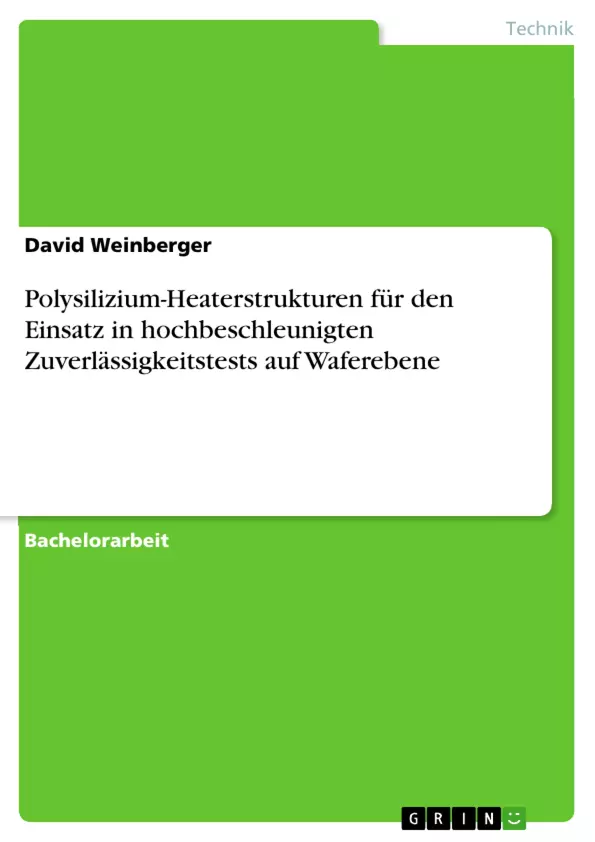Diese Bachelorarbeit soll die Grundlage für hochbeschleunigte Zuverlässigkeitstests auf Waferebene unter Verwendung von In-Situ-Heizelementen aus polykristallinem Silizium bilden. Nach einer Einführung in die Zuverlässigkeitstheorie wird eine Auswahl an Zuverlässigkeitstest vorgestellt. Diese sind momentan, durch den Einsatz von Hot-Chuck's, noch recht zeitaufwändig und verlangen daher nach einer alternativen Wärmequelle. Der in dieser Arbeit vorgestellte Ausweg beschreibt einen Polysilizium-Widerstand direkt in der zu beheizenden Struktur. Weiterhin wird die Wärmeausbreitung durch thermische Simulationen dargestellt. Am Ende dieser Arbeit wird noch die mögliche Temperaturmessung an solchen Teststrukturen vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung
- Kapitel 2: Hauptteil 1
- Abschnitt 2.1
- Abschnitt 2.2
- Kapitel 3: Hauptteil 2
- Abschnitt 3.1
- Abschnitt 3.2
- Abschnitt 3.3
- Unterabschnitt 3.3.1
- Unterabschnitt 3.3.2
- Kapitel 4: Hauptteil 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine umfassende Analyse [des Themas, das die Arbeit behandelt]. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte und bietet einen detaillierten Einblick in [den Gegenstand der Untersuchung].
- Thema 1: [Kurze Beschreibung des Themas]
- Thema 2: [Kurze Beschreibung des Themas]
- Thema 3: [Kurze Beschreibung des Themas]
- Thema 4: [Kurze Beschreibung des Themas]
- Thema 5: [Kurze Beschreibung des Themas]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Arbeit. Es wird eine kurze Übersicht über den zu behandelnden Stoff gegeben und die Forschungsfrage formuliert. Die Relevanz der Fragestellung wird im Kontext des aktuellen Forschungsstandes erläutert, und die Struktur der Arbeit wird skizziert.
Kapitel 2: Hauptteil 1: Kapitel 2 befasst sich mit [Thema von Kapitel 2]. Es werden [wichtige Konzepte/Argumente] detailliert erläutert und anhand von [Beispielen/Studien] veranschaulicht. Der Fokus liegt auf [einem bestimmten Aspekt des Themas]. Die in den Unterkapiteln präsentierten Analysen tragen zur umfassenden Darstellung des Gesamtbildes bei. Es wird [eine Brücke zu den folgenden Kapiteln geschlagen].
Kapitel 3: Hauptteil 2: Kapitel 3 vertieft die Analyse aus Kapitel 2, indem es [Thema von Kapitel 3] in den Mittelpunkt stellt. Es werden [verschiedene Perspektiven/Methoden] vorgestellt und kritisch bewertet. Besonderes Augenmerk wird auf [einen konkreten Aspekt] gelegt. Der Bezug zu den vorherigen Kapiteln wird deutlich herausgearbeitet, um ein kohärentes Verständnis des Gesamtbildes zu ermöglichen. Die Komplexität des Themas wird durch [detaillierte Erläuterungen/Beispiele] veranschaulicht.
Kapitel 4: Hauptteil 3: In Kapitel 4 wird [Thema von Kapitel 4] behandelt. Hier wird [eine neue Methode/Perspektive] vorgestellt, die [zu einem neuen Verständnis des Themas beiträgt]. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieses Kapitels werden [im Kontext der Gesamtarbeit eingeordnet].
Schlüsselwörter
Hier sollten die Schlüsselwörter eingefügt werden, die den Inhalt der Arbeit am besten beschreiben. Beispiele: [Schlüsselwort 1], [Schlüsselwort 2], [Schlüsselwort 3], [Schlüsselwort 4], [Schlüsselwort 5].
Häufig gestellte Fragen zum Dokumentenüberblick
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Überblick dient dazu, den Inhalt der Arbeit strukturiert und prägnant darzustellen.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument gliedert sich in vier Hauptteile: Zuerst findet sich ein Inhaltsverzeichnis mit bis zu drei Ebenen (Kapitel, Abschnitte, Unterabschnitte). Es folgt ein Abschnitt zur Zielsetzung und den Themenschwerpunkten der Arbeit. Anschließend werden die einzelnen Kapitel kurz zusammengefasst. Abschließend wird eine Liste mit Schlüsselwörtern präsentiert, die den Inhalt der Arbeit beschreiben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Hauptteil 1), Kapitel 3 (Hauptteil 2) und Kapitel 4 (Hauptteil 3). Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des übergeordneten Themas.
Worüber handelt Kapitel 1?
Kapitel 1 dient als Einleitung. Es bietet eine Übersicht über das Thema, formuliert die Forschungsfrage, erläutert die Relevanz und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Worüber handelt Kapitel 2?
Kapitel 2 befasst sich mit einem bestimmten Thema (im Überblick nicht spezifiziert) und erläutert wichtige Konzepte und Argumente anhand von Beispielen und Studien. Der Fokus liegt auf einem bestimmten Aspekt des Themas, der im Überblick nicht detailliert genannt wird.
Worüber handelt Kapitel 3?
Kapitel 3 vertieft die Analyse aus Kapitel 2, indem es einen weiteren Aspekt des Themas untersucht. Es präsentiert und bewertet verschiedene Perspektiven und Methoden und legt besonderes Augenmerk auf einen konkreten Aspekt, der im Überblick nicht spezifiziert wird.
Worüber handelt Kapitel 4?
Kapitel 4 behandelt ein weiteres Thema (im Überblick nicht spezifiziert) und stellt eine neue Methode oder Perspektive vor, die zu einem neuen Verständnis des Themas beitragen soll. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden im Kontext der Gesamtarbeit eingeordnet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind im Überblick nur platzhalterhaft aufgeführt und müssen aus dem vollständigen Text der Arbeit entnommen werden. Es werden fünf Themen genannt, die jeweils mit einer kurzen, platzhalterhaften Beschreibung versehen sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die Schlüsselwörter sind Platzhalter und müssen aus dem vollständigen Text der Arbeit entnommen werden. Der Überblick listet fünf Platzhalter auf.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem Dokument enthalten. Dieser Überblick dient lediglich als Zusammenfassung.
- Quote paper
- David Weinberger (Author), 2011, Polysilizium-Heaterstrukturen für den Einsatz in hochbeschleunigten Zuverlässigkeitstests auf Waferebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200353