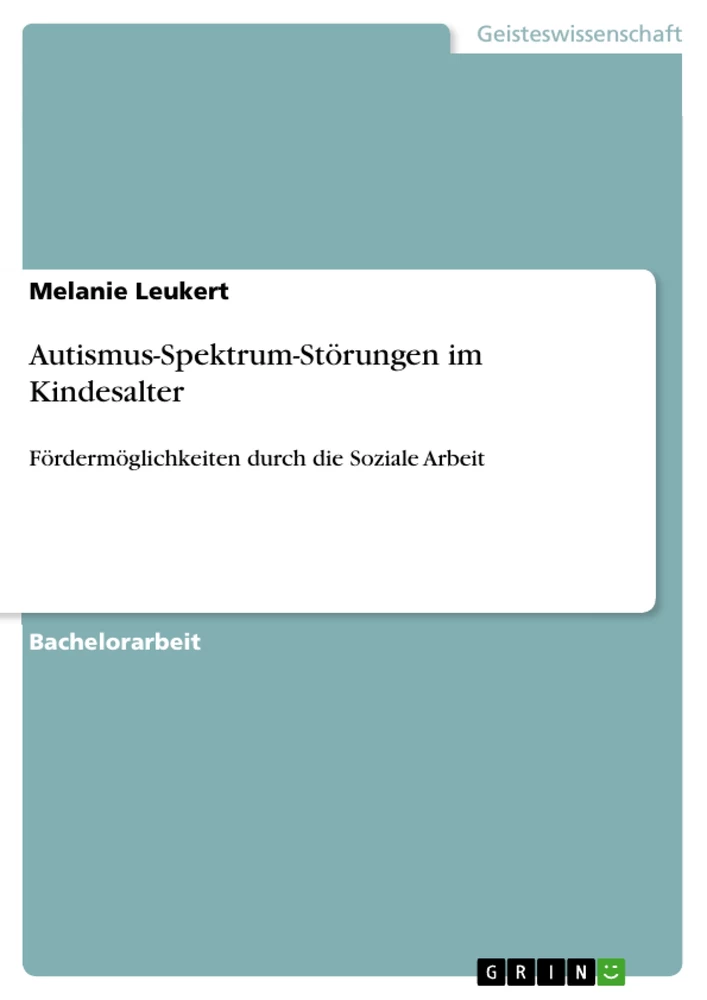Im Mittelpunkt der vorliegenden Bachelorarbeit steht die Gegenüberstellung und der damit einhergehende Vergleich des frühkindlichen Autismus mit dem Asperger-Syndrom. Ich arbeite sukzessiv heraus, wie sich diese Störungsbilder unterscheiden und wie SozialarbeiterInnen durch methodische Vorgehensweisen und Programme professionell agieren können. Auch wenn die Ursachen der Autismus-Spektrum-Störungen noch nicht eindeutig definiert sind, können die Symptome durch gezielte Förderung kompensiert werden. Die Studien konzentrieren sich auf die Behandlung dieser Störungsbilder.
Daher wird in der Bachelorarbeit herausgearbeitet, wie SozialarbeiterInnen unterstützend und begleitend dazu beitragen können, die Symptome von Autismus-SpektrumStörungen im Kindesalter zu kompensieren. Die zentrale Aufgabe ist die frühzeitige Erkennung des entsprechenden Störungsbildes, um gezielt intervenieren zu können. Dies kann durch Vorsorgeuntersuchungen im Kleinkindalter erfolgen, allerdings wird die Diagnose frühkindlicher Autismus in Deutschland oft erst ab dem vierten Lebensjahr gestellt. Die des AspergerSyndroms ergibt sich mitunter verzögerter, da sich die Kinder in den ersten Lebensmonaten und -jahren regulär entwickeln. Daraus ergaben sich folgende Fragestellungen, die nachfolgend erörtert werden: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich des frühkindlichen Autismus sowie des Asperger-Syndroms sind signifikant und wie äußern sich diese? Welche Fördermöglichkeit zum Aufbau sozialer und kommunikativer Kompetenzen kann autistisches Verhalten kompensieren und wie können SozialarbeiterInnen intervenieren?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen und geschichtlicher Wandel des Autismusbegriffes
- 3 Autismus-Spektrum-Störungen
- 3.1 Frühkindlicher Autismus
- 3.1.1 Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV
- 3.1.2 Epidemiologie
- 3.1.3 Symptomatik
- 3.1.4 Diagnostik
- 3.1.5 Verlauf und Prognose
- 3.2 Asperger-Syndrom
- 3.2.1 Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV
- 3.2.2 Epidemiologie
- 3.2.3 Symptomatik
- 3.2.4 Diagnostik
- 3.2.5 Verlauf und Prognose
- 3.1 Frühkindlicher Autismus
- 4 Entwicklungsstörungen autistischer Kinder und daraus entstehende soziale Probleme
- 4.1 Besonderheiten der verbalen und nonverbalen Kommunikation
- 4.2 Auffälligkeiten im Sozialverhalten
- 4.3 Stereotypes und repetitives Verhalten
- 4.4 Kognitive Entwicklung, Spezialinteressen und Begabungen
- 5 Ätiologie
- 5.1 Genetische Faktoren
- 5.2 Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen
- 5.3 Biochemische Besonderheiten
- 5.4 Ungewöhnliche Gewichtsregulation
- 5.5 Schädigungen durch Impfungen
- 6 Förderung autistischer Kinder durch die Soziale Arbeit
- 6.1 Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen
- 6.2 Der TEACCH-Ansatz
- 6.3 Grundlagen und Zielsetzungen des TEACCH-Ansatzes
- 6.4 Grundsätze des TEACCH-Ansatzes
- 6.5 Anwendung in der Sozialen Arbeit
- 6.6 Kritik
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Vergleich von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom und untersucht die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen zu fördern. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Störungsbilder herauszuarbeiten und professionelle Interventionsansätze für SozialarbeiterInnen aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kompensation der Symptome durch gezielte Förderung und die Bedeutung der frühzeitigen Diagnose.
- Vergleich von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom
- Untersuchung der Symptomatik und Diagnostik beider Störungsbilder
- Analyse der Entwicklungsstörungen und daraus resultierenden sozialen Probleme
- Präsentation von Fördermöglichkeiten durch die Soziale Arbeit
- Erläuterung des TEACCH-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Autismus-Spektrum-Störungen ein und betont die Bedeutung frühzeitiger Intervention. Sie skizziert den Problemaufriss, die Zielsetzung der Arbeit (Vergleich von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom sowie die Darstellung der Rolle der Sozialen Arbeit) und die Forschungsfragen. Die Einleitung hebt die gesellschaftliche Relevanz des Themas hervor und stellt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Autismus-Spektrum-Störungen heraus, die über gängige medial vermittelte Stereotypen hinausgeht.
2 Definitionen und geschichtlicher Wandel des Autismusbegriffes: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Autismusbegriffes und seiner Definitionen im Laufe der Zeit. Es beleuchtet den Wandel von früheren, oft stigmatisierenden Vorstellungen bis hin zum heutigen Verständnis von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die historische Perspektive zeigt den Fortschritt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Autismus und der damit verbundenen Veränderung in der Wahrnehmung und Behandlung von Menschen mit ASS. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses der Störung von initialen Fehlinterpretationen bis zu den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
3 Autismus-Spektrum-Störungen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des autistischen Spektrums, wobei frühkindlicher Autismus und das Asperger-Syndrom im Detail betrachtet werden. Es werden Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV vorgestellt, epidemiologische Daten präsentiert und die Symptomatik, Diagnostik sowie der Verlauf und die Prognose beider Störungsbilder erläutert. Die unterschiedlichen Kriterien und deren Anwendung werden verglichen und die Herausforderungen bei der Diagnosestellung hervorgehoben. Der Vergleich verdeutlicht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den beiden Störungsbildern innerhalb des autistischen Spektrums.
4 Entwicklungsstörungen autistischer Kinder und daraus entstehende soziale Probleme: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Entwicklungsstörungen autistischer Kinder und ihre Auswirkungen auf das soziale Umfeld. Es untersucht Besonderheiten in der verbalen und nonverbalen Kommunikation, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, stereotypes und repetitives Verhalten und die kognitive Entwicklung, inklusive Spezialinteressen und Begabungen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Schwierigkeiten im sozialen Miteinander und wie diese die Entwicklung und Teilhabe der betroffenen Kinder beeinflussen. Die verschiedenen Facetten der Entwicklungsstörungen werden miteinander verknüpft und ihr Einfluss auf die soziale Integration der Kinder beleuchtet.
5 Ätiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen. Es beleuchtet verschiedene Theorien und Forschungsergebnisse zu genetischen Faktoren, Hirnschädigungen und -funktionsstörungen, biochemischen Besonderheiten, sowie der Rolle ungewöhnlicher Gewichtsregulation und möglichen Impfschäden. Die Darstellung der verschiedenen Faktoren verdeutlicht die Komplexität der Ätiologie von ASS und die Notwendigkeit weiterer Forschung. Der aktuelle Forschungsstand wird präsentiert und die verschiedenen Hypothesen werden kritisch gewürdigt.
6 Förderung autistischer Kinder durch die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel widmet sich den Fördermöglichkeiten für autistische Kinder im Kontext der Sozialen Arbeit. Es beschreibt den TEACCH-Ansatz und dessen Grundlagen, Zielsetzungen und Grundsätze im Detail. Die Anwendung des Ansatzes in der Sozialen Arbeit wird erläutert, und kritische Aspekte werden diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung praktischer Ansätze der Unterstützung und der Bedeutung von individuellen Fördermaßnahmen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Methoden und Strategien zur Verbesserung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen autistischer Kinder.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störungen, frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Soziale Arbeit, Förderung, TEACCH-Ansatz, Kommunikation, Sozialverhalten, Entwicklungsstörungen, Diagnostik, Intervention, Ätiologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Autismus-Spektrum-Störungen: Vergleich von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom und Fördermöglichkeiten durch die Soziale Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit vergleicht frühkindlichen Autismus und das Asperger-Syndrom und untersucht, wie die Soziale Arbeit Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) fördern kann. Sie beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Störungsbilder und zeigt professionelle Interventionsansätze für Sozialarbeiter auf. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kompensation von Symptomen durch gezielte Förderung und der Bedeutung frühzeitiger Diagnostik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definitionen und den geschichtlichen Wandel des Autismusbegriffes, detaillierte Beschreibungen von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom (inklusive Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV, Epidemiologie, Symptomatik, Diagnostik, Verlauf und Prognose), Entwicklungsstörungen autistischer Kinder und daraus resultierende soziale Probleme (Kommunikation, Sozialverhalten, stereotypes Verhalten, kognitive Entwicklung), die Ätiologie von ASS (genetische Faktoren, Hirnschädigungen, biochemische Besonderheiten etc.), und die Förderung autistischer Kinder durch die Soziale Arbeit, insbesondere den TEACCH-Ansatz.
Welche Störungsbilder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht im Detail frühkindlichen Autismus und das Asperger-Syndrom. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Diagnosekriterien, der Symptomatik, der Diagnostik, dem Verlauf und der Prognose beider Störungsbilder herausgearbeitet.
Was ist der TEACCH-Ansatz?
Der TEACCH-Ansatz ist ein Förderansatz für Kinder mit ASS, der ausführlich in der Arbeit beschrieben wird. Es werden die Grundlagen, Zielsetzungen, Grundsätze und die Anwendung in der Sozialen Arbeit erläutert, inklusive kritischer Betrachtung.
Welche Fördermöglichkeiten werden durch die Soziale Arbeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten durch die Soziale Arbeit, mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung sozialer und kommunikativer Kompetenzen. Der TEACCH-Ansatz dient dabei als Beispiel für einen strukturierten und evidenzbasierten Ansatz.
Welche Aspekte der Ätiologie von Autismus werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Theorien und Forschungsergebnisse zur Entstehung von ASS, darunter genetische Faktoren, Hirnschädigungen und -funktionsstörungen, biochemische Besonderheiten, ungewöhnliche Gewichtsregulation und die kontrovers diskutierte Rolle von Impfungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definitionen und geschichtlicher Wandel des Autismusbegriffes, Autismus-Spektrum-Störungen (mit Unterkapiteln zu frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom), Entwicklungsstörungen und soziale Probleme, Ätiologie, Förderung durch die Soziale Arbeit (mit Schwerpunkt auf TEACCH), und Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Pädagogik und Psychologie, sowie für Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen mit ASS arbeiten. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik und kann als Grundlage für die professionelle Praxis dienen.
Wo finde ich Schlüsselwörter?
Schlüsselwörter zur Arbeit sind: Autismus-Spektrum-Störungen, frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, Soziale Arbeit, Förderung, TEACCH-Ansatz, Kommunikation, Sozialverhalten, Entwicklungsstörungen, Diagnostik, Intervention, Ätiologie.
- Arbeit zitieren
- Melanie Leukert (Autor:in), 2012, Autismus-Spektrum-Störungen im Kindesalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200797