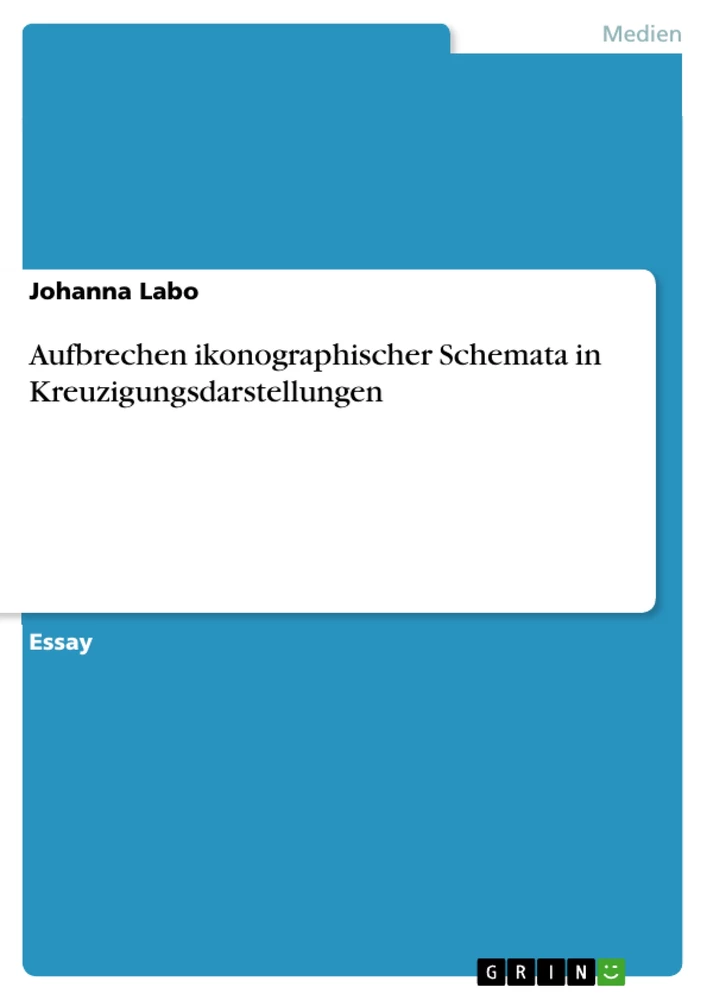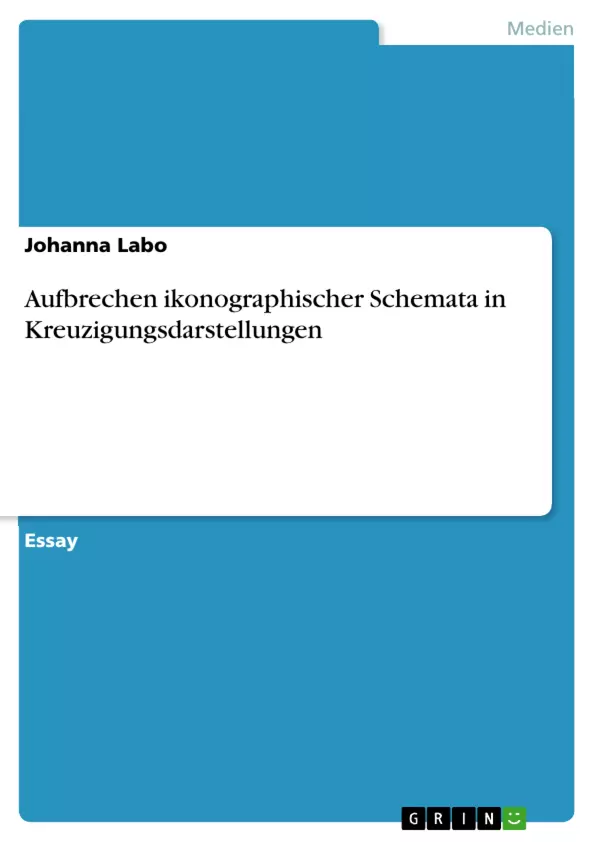Im Mittelalter vollzieht sich innerhalb der Kreuzigungsdarstellungen ein Aufbrechen der ikonographischen Schemata. Verschiedenen Einflüsse und Auswirkungen dieser Veränderungen sollen in dieser Arbeit, anhand einiger ausgewählter Werke, chronologisch knapp dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. 1450: Die Meister von St. Leonard – Kreuzigung
3. 1505: Lukas Cranach der Ältere – Kreuzigung (München)
4. 1509 – 1516: Albrecht Altdorfer, Sebastiansaltar
5. 1510: Kopie nach Grünewald - Magdalenenklage
6. 1951: Salvador Dalí – Christus des heiligen Johannes
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einführung
Im Mittelalter vollzieht sich innerhalb der Kreuzigungsdarstellungen ein Aufbrechen der ikonographischen Schemata. Verschiedenen Einflüsse und Auswirkungen dieser Veränderungen sollen in dieser Arbeit, anhand einiger ausgewählter Werke, chronologisch knapp dargestellt werden.
2. 1450: Die Meister von St. Leonard – Kreuzigung
Bei dem Gemälde der Meister von St. Leonard handelt es sich noch um eine klassische Kreuzigungsdarstellung. Christus ist dem Betrachter frontal gegenüber gestellt, ebenso wie die beiden Schächer. Auch die anderen Figuren verteilen sich rechts und links von Christus, merkwürdig flach anmutend und ohne räumliche Tiefe. Dies liegt vermutlich auch an dem goldfarbenen Hintergrund.
Vor allem aber liegt es wohl an der derzeit üblichen Bedeutungsperspektive. Dabei wurden Größenverhältnisse nicht naturalistisch oder realistisch korrekt dargestellt, sondern entsprechend ihrer Bedeutung verändert. Personen, die für das Werk wichtig oder positiv besetzt waren, wurden größer oder herausragender dargestellt als unwichtigere oder negative Personen. So wurden z. B. Heilige, Märtyrer und Adelige, größer und zentraler im Bild positioniert als dagegen Stifter, Sünder oder Bedienstete. Daher ist Christus größer dargestellt als die beiden Schächer, auch sind die Kreuze der Schächer unterhalb des Kreuzes von Christus positioniert.
Auch folgt hier eine klassische Aufteilung in eine „gute“ und eine „böse“ Hälfte. Der gute Schächer, Maria, Johannes und zwei weitere Figuren (eine davon ist vermutlich Maria Magdalena) befinden sich auf der rechten1 Seite Christi2. Auf der linken Seite befinden sich der schlechte Schächer (der Christus nicht in die Augen schauen kann, weil er ihn geschmäht hat), Longinus mit der Lanze und verschiedene Andere.
3. 1505: Lukas Cranach der Ältere – Kreuzigung (München)
An diesem Werk zeigen sich bei Cranach Einflüsse der Donauschule, die ihm durch seine Wanderjahre v. A. während seines Wien-Aufenthaltes begegnet sein dürften. Die Darstellung der Natur ist symbolhaft aufgeladen, es ziehen dunkle Sturmwolken auf und starke Böen lassen den Lendenschurz Christi aufbauschen.
Das Auffälligste an dem Gemälde ist jedoch das Aufbrechen der üblichen Kreuzesdarstellung hinsichtlich des Blickwinkels auf das Kreuz. Hier ist die Ansicht nicht mehr frontal auf das Kreuz und den Corpus Christi gerichtet. Stattdessen wurde eine Komposition gewählt, bei der die drei Kreuze (die der beiden Schächer und das von Christus) in einer Dreiecks-Formation stehen. Die Kreuze scheinen die beiden zentralen Figuren, nämlich Maria und Johannes, zu umrahmen. Zusammen mit der „Abseits-Stellung“ Christi wird deutlich, dass nicht Christi selbst das zentrale Motiv darstellt, sondern Johannes und Maria, insbesondere Marias Leid. Es geht also bei Cranachs Altarbild nicht um die Andacht an Jesus, sondern um die Compassio, das Mitleid. Dies wird auch daran deutlich, dass dem Betrachter das abgewandte Christus' Gesicht einen direkten Blickkontakt verweigert. Stattdessen ist das schmerzerfüllte Gesicht Marias erkennbar.
Auch ist die Bedeutungsperspektive hier aufgehoben: Christus hebt sich nicht mehr durch seine Größe oder die seines Kreuzes von den Schächern ab. Die Kreuze scheinen gleich hoch zu sein. Die Schächer sind immer noch links und rechts von ihm (und durch das zu- bzw. abgewandte Gesicht auch als Dismas und Gismas zu erkennen) positioniert, jedoch befinden sie sich auf der linken Bildhälfte und sind Christus entgegengestellt. So wird eine kontrastive Unterscheidung zu den Verbrechern wiederhergestellt, jedoch nicht mit der Bedeutungsperspektive sondern mit einem neuen Betrachterblickwinkel.
Dieser könnte durch mittelalterliche Passionsspiele inspiriert sein, dafür sprechen das angeschnittene Bild und die bühnenartige Gestaltung. Auch das Thema selbst, die Marienklage, kommt in den Passionsspielen als eigenständiges Thema vor. So könnte sie zu diesem Werk beigesteuert haben.
4. 1509 – 1516: Albrecht Altdorfer, Sebastiansaltar
Altdorfers Altarbild zeigt die Kreuzigungsdarstellung in typischer Manier der Donauschule, als dessen Hauptvertreter man Altdorfer bezeichnen kann. Dramatisch verfinstert sich hier der Himmel, die Lendentücher aller drei Gekreuzigten flattern im Wind und deuten auf den biblischen Sturm hin, der nach dem Tod von Jesus ausbricht.
Neu ist hierbei die Verlegung der gesamten Kreuzigungsdarstellung in die für Altdorfer zeitgenössische Zeit. Dies ist unübersehbar an dem aufgestellten Rad im Hintergrund zu erkennen, das noch eine aufgeflochtene Person trägt. Diese Hinrichtungsart wurde erst ab dem Mittelalter praktiziert.
Auch die Anordnung der Kreuze ist bemerkenswert. So überrascht eine Abweichung vom frontalen Schema uns nach Cranach nicht mehr so sehr, jedoch ist eine solche Darstellung vor 1505 nicht geläufig. Die Schächer sind einer gedachten Linie rechts und links von Jesus aufgestellt. Doch ihre Kreuze sind mit der Vorderseite nach Christus ausgerichtet, die Toten scheinen sich vor ihm zu verneigen. Das Kreuz Christi ist durch einen kleinen Sockel nur wenig erhöht. Doch die Tafel mit dem I.N.R.I. erzeugt eine weitere kleine Erhöhung, die zusammen mit der Beugung der toten Schächer eine symbolische Erhöhung Christi' erzeugt.
Die gesamte Szenerie erzeugt durch den angeschnittenen Blickwinkel des Betrachters auch hier den Eindruck einer Bühne. Auch entsteht wieder die Assoziation der Passionsspiele, vor allem durch die hohe Anzahl an Personen und Farben, die ein wirres Durcheinander hervorrufen. Die Gekreuzigten sind bereits verstorben, dennoch ist das Bild erfüllt von Dynamik und Handlung. Maria und Johannes trauern, Longinus betrachtet eine Figur; womöglich den Stifter Probst Peter3, der vor Christus ehrfurchtsvoll oder klagend die Hände erhebt. Im Hintergrund wird um die Kleidung geschächert, ein Handlanger trägt Holz (und war mit seinem Beil wohl für die crura fracta, das Brechen der Beine, zuständig). Es herrscht also keine melancholisch ruhige Stimmung, sondern einen für uns vermutlich realistischeren Eindruck des Prozederes nach einer Hinrichtung.
[...]
1 „Rechts“ war im Mittelalter, und ist es teilweise heute noch, die ehrenvollere Seite als die Linke. Vgl. Die etymologische Verwandschaft von „Rechts → Recht → Richtig“ und das Beispiel für die negative Belegung des Begriffs in „ein linker Hund“ oder „linkisch“.
2 Aus dem Bild heraus (von Christus aus) gesehen. Nicht von der Betrachterperspektive ausgehend.
3 Vgl. Linninger, Franz: Der Sebastiansaltar von Albrecht Altdorfer in St. Florian. Seine Entstehung und Geschichte. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. Linz: Oberösterreichischer Musealverein 1964 (Bd.110). S.242.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich die Kreuzigungsdarstellung im Mittelalter?
Es vollzog sich ein Wandel von starren, frontalen Schemata hin zu dynamischeren, emotionalen und perspektivisch komplexeren Darstellungen.
Was versteht man unter der „Bedeutungsperspektive“?
Hierbei wurden Figuren nicht nach ihrer realen Größe, sondern nach ihrer religiösen oder sozialen Wichtigkeit dargestellt (z. B. Christus größer als die Schächer).
Was ist das Besondere an Lukas Cranachs Kreuzigung von 1505?
Cranach brach das frontale Schema auf, indem er die Kreuze in einer Dreiecksformation anordnete und den Fokus auf das Mitleid (Compassio) legte.
Welchen Einfluss hatte die Donauschule auf die Kunst?
Die Donauschule (z. B. Altdorfer) integrierte dramatische Naturdarstellungen und zeitgenössische Elemente in biblische Szenen, um die emotionale Wirkung zu steigern.
Wie stellte Salvador Dalí die Kreuzigung dar?
In seinem Werk von 1951 wählte Dalí eine extreme Aufsichtsperspektive, die das traditionelle ikonographische Schema radikal aufbrach.
- Arbeit zitieren
- Johanna Labo (Autor:in), 2012, Aufbrechen ikonographischer Schemata in Kreuzigungsdarstellungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201728