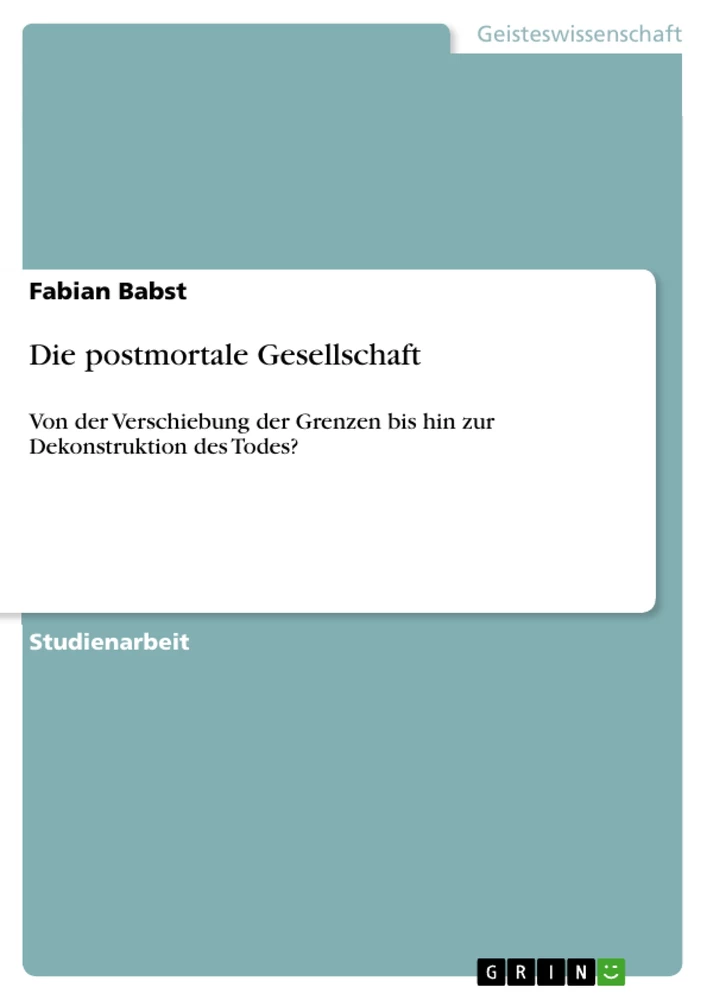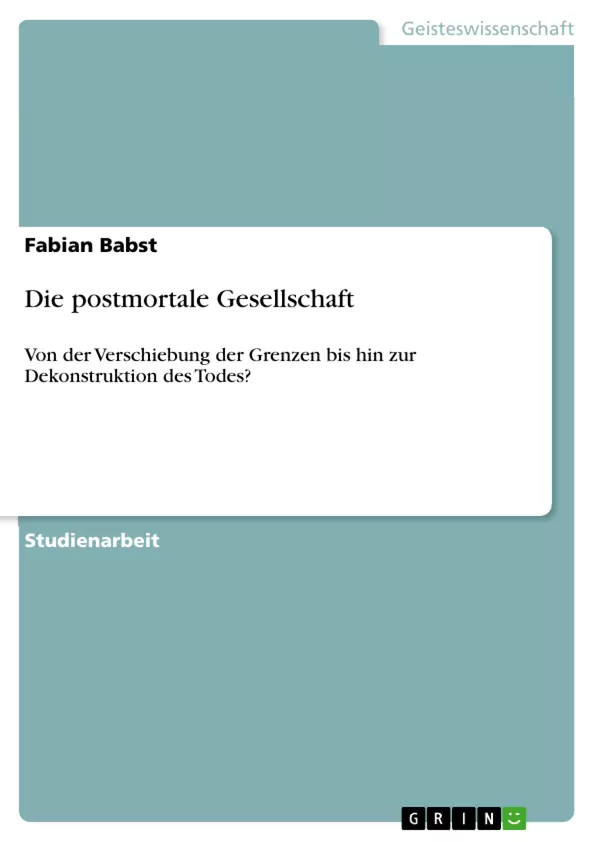Im Laufe der Zeit ist die einst als unerschütterlich geltende Grenze zwischen Leben und Tod zunehmend verschwommen und sogar das Gedankenexperiment der völligen Dekonstruktion des Todes rückt zunehmend in den Fokus der thanatosoziologischen Debatte. Dies ist zum einen dem technisch-medizinischen Fortschritt geschuldet. Zum anderen reagiert die wissenschaftliche Disziplin immer auf gesellschaftliche Problemlagen und versucht den Menschen Lösungen für spezifische, aus der Entwicklung resultierende, Probleme zu präsentieren.
Bevor zunächst das Motiv der akribischen Forschung, die gesellschaftliche Problemlage, auf die die Forschung reagiert, untersucht wird, sollen im Folgenden die neuen Grenzen des Todes beschrieben und ein Ausblick auf eine mögliche Zuspitzung der Entwicklung, nämlich eine Dekonstruktion des Todes, und deren Folgen für die Gesellschaft gewagt werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Angst vor dem Tod
2 Die neuen Grenzen des Todes
2.1 Vom Tod als Zeitpunkt zum Tod als Prozess: Der Herztod und der Hirntod
2.2 Die neue Todesdefinition. Fluch oder Segen?
3 Die Dekonstruktion des Todes?
4 Ein Leben ohne Tod
5 Zusammenfassung und Fazit
6 Quellen
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „postmortale Gesellschaft“?
Er beschreibt eine Gesellschaft, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod durch medizinischen Fortschritt verschwimmen und der Tod zunehmend dekonstruiert wird.
Wie hat sich die Definition des Todes verändert?
Der Tod wird nicht mehr nur als punktueller Zeitpunkt (Herztod), sondern zunehmend als biologischer Prozess (Hirntod) verstanden.
Was ist Thanatosoziologie?
Dies ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der soziologischen Untersuchung des Sterbens, des Todes und des Umgangs der Gesellschaft damit befasst.
Ist die Dekonstruktion des Todes ein Fluch oder Segen?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch: Während der Fortschritt Leben verlängert, wirft die technische Beherrschung des Todes ethische Fragen und Ängste auf.
Was wären die Folgen eines Lebens ohne Tod?
Ein solches Szenario würde die sozialen Strukturen, die Generationenfolge und das menschliche Selbstverständnis radikal verändern.
- Arbeit zitieren
- Fabian Babst (Autor:in), 2012, Die postmortale Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202466