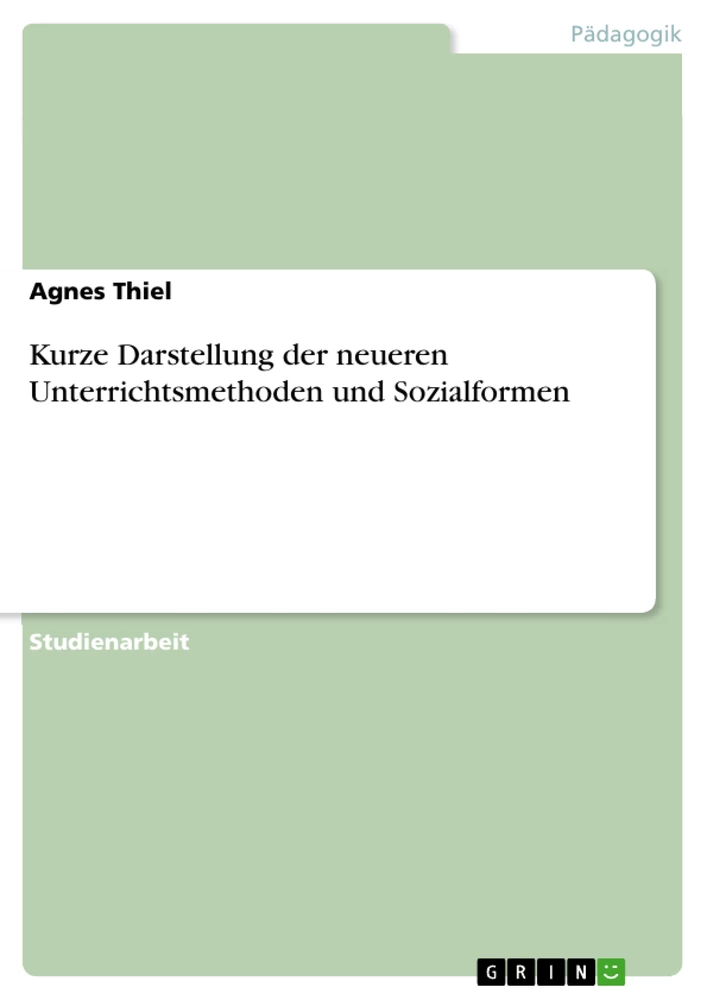Die Arbeit gibt einen Überblick über die neuen Sozialformen im Unterricht. Da der Frontalunterricht sowohl in den Klassenzimmern als auch in der Forchung überholt sind, versucht diese Arbeit die neueren Entwicklungen der Unterrichtsgestaltung wissenschaftlich einzufangen.
Inhalt
Einleitung
1. Methoden als Lehr- und Lernformen
1.1 Methode und Methodenvielfalt
1.2 Funktionen von Methoden
2. Sozialformen
2.1 Die einzelnen Sozialformen
2.2 Inszenierungsformen
Schlußbemerkungen
Literatur
Excerpt out of 15 pages
- scroll top
- Quote paper
- Agnes Thiel (Author), 2009, Kurze Darstellung der neueren Unterrichtsmethoden und Sozialformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202524
Look inside the ebook