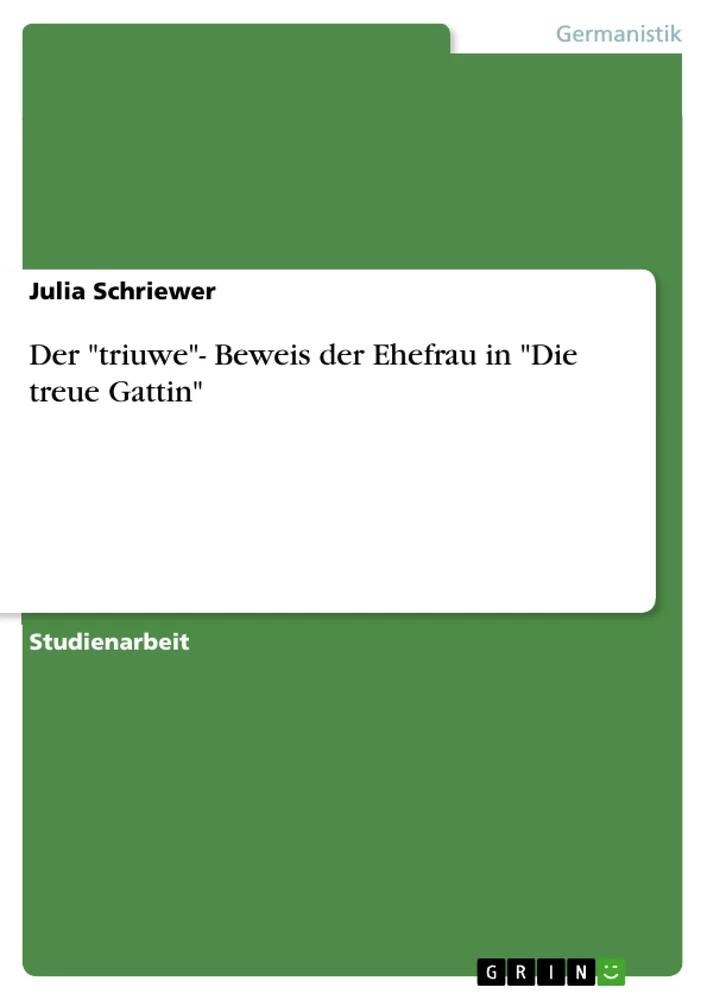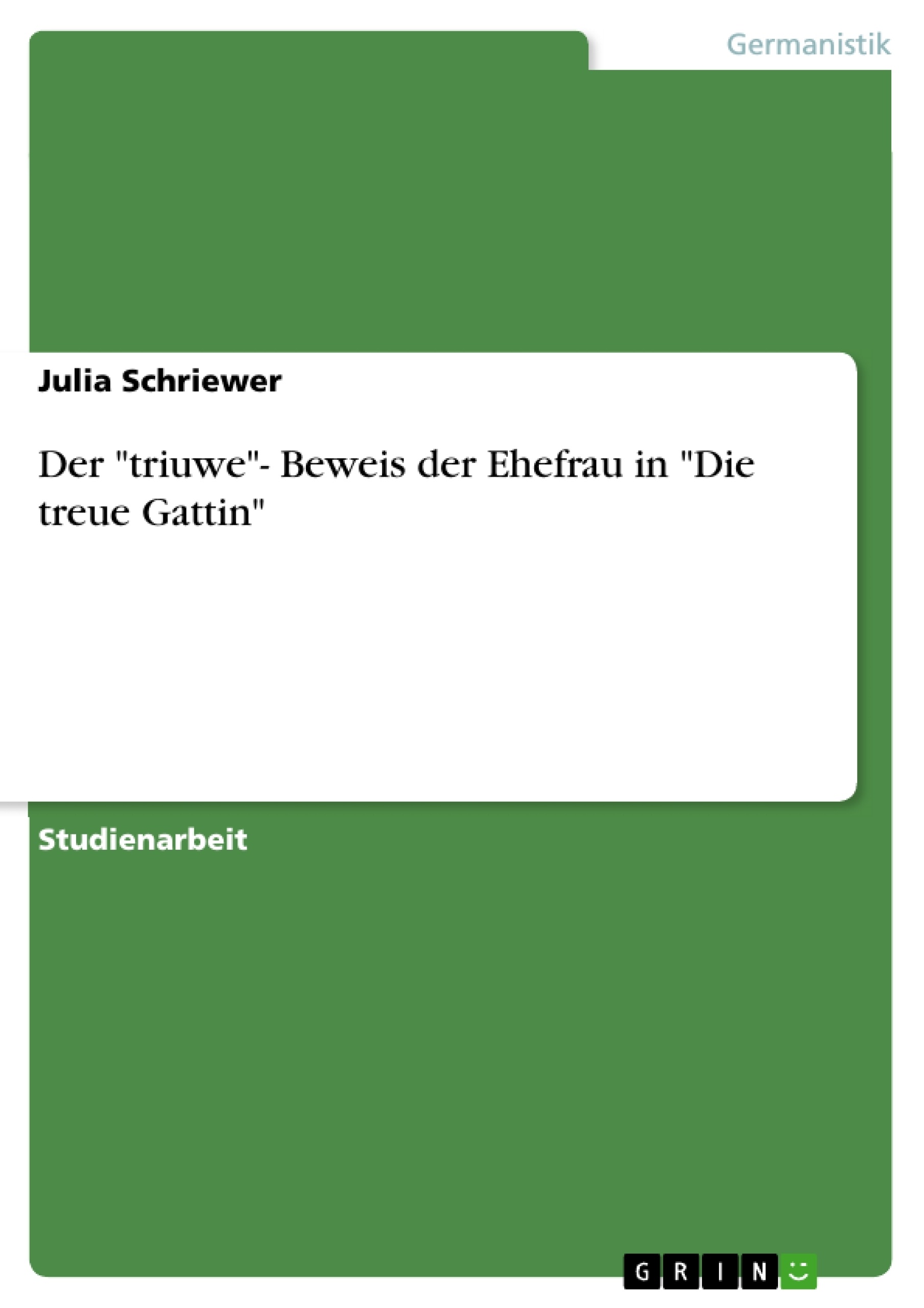In dem Märe von Herrand von Wildonie „Die treue Gattin“ steht der Aspekt der Schönheit im Vordergrund. Bei beiden Hauptcharakteren dieses Märes geht es um Schönheit: Die Frau: Unendlich schön und vollkommen, der Mann, ihr Gegenteil: Runzelig und klein, viel älter aussehend als er eigentlich war.
Doch was hatte es mit der Schönheit der Frau zur Zeit der Entstehung dieses Märes eigentlich auf sich?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Schönheit der Frau in der Minnedichtung
„Die treue Gattin“
Zum triuwe- Beweis
Literaturverzeichnis
Einleitung
Meine Arbeit möchte ich mit einem kurzen Überblick über den Aufbau der Arbeit beginnen. Das Thema der Arbeit ist der triuwe- Beweis der Ehefrau in Herrands von Wildonie „Die treue Gattin“[1]. Bei diesem Märe spielen äußere Schönheit und innere Vollkommenheit die tragende Rolle.
Daher erscheint es mir wichtig, ganz zu Anfang auf die äußere Schönheit einzugehen, zu erläutern, welche Schönheitsideale es im Mittelalter und besonders im Bereich der Minnedichtung gab.
In diesem Teil beziehe ich mich auf das Schönheitsideal, wie es Joachim Bumke in seinem Buch „Höfische Kultur- Literatur und Gesellschaft im Mittelalter“[2] beschreibt.
Im Anschluss an diese Erläuterungen möchte ich zunächst genau auf das Märe selbst eingehen, damit man die Geschichte und somit die Bedeutung des triuwe - Beweises verstehen kann. Meine Erläuterungen beziehen sich hier immer auf den mittelhochdeutschen Wortlaut.
Danach setze ich mich mit einer Arbeit von Hedda Ragotzky und Christa Ortmann[3] auseinander, in der sich die beiden Autorinnen mit dem
triuwe -Beweis in „Die treue Gattin“, „Das Herzmäre“ und die „Frauentreue“ beschäftigen, wobei für meine Arbeit nur der Teil über „Die treue Gattin“ von Bedeutung war.
Die Schönheit der Frau in der Minnedichtung
In dem Märe von Herrand von Wildonie „Die treue Gattin“ steht der Aspekt der Schönheit im Vordergrund. Bei beiden Hauptcharakteren dieses Märes geht es um Schönheit: Die Frau: Unendlich schön und vollkommen, der Mann, ihr Gegenteil: Runzelig und klein, viel älter aussehend als er eigentlich war.
Doch was hatte es mit der Schönheit der Frau zur Zeit der Entstehung dieses Märes eigentlich auf sich?
Zunächst muss man festhalten, dass Minnesänger Minnelieder erschaffen haben, in denen der Preis der Schönheit der Minnedame ein wichtiger Bestandteil des Preises ihrer ethischen Vollkommenheit ist. Zu diesem Schönheitsideal gehörte nicht nur die äußere Vollkommenheit der Frau, viel mehr ging es auch um die innere Vollkommenheit, die Tugendhaftigkeit. Diese Betrachtung mag den heutigen Leser von diesen Minnegedichten etwas seltsam erscheinen. In zahlreichen Mären aus dieser Zeit begegnet ihm die Frau als minderwertig. Sie ist für die Hausarbeit zuständig, muss sich stets um Haus und Hof kümmern, während ihr Mann arbeitet oder gar in den Krieg ziehen muss. Diese Abwesenheit, so lernt man in vielen Mären, wird oft durch die Schlechtigkeit der Frau ausgenutzt, indem sie sich auf ein Verhältnis mit einem anderen Mann einlässt.
Ganz anders aber bei den Minnesängern: Die Frauen verkörpern ein allgemein gültiges Schönheitsideal. Von den blonden, lockigen Haaren bis hin zu den weißen Händen und kleinen Füßen gab es in der Dichtung der Minnesänger einen festen Katalog der Schönheitsmerkmale der Frauen. Zusammen mit dem guten Charakter, der Tugendhaftigkeit, bildete sich so ein höfisches Frauenbild.
Allerdings gehen die Minnesänger noch weiter und erzeugen so ein perfektes Gegenteil zu dem Frauenbild, das zu diesem Zeitpunkt in der Gesellschaft überall vertreten war: Sie gingen davon aus, dass die Frauen, tugendhaft und schön, ihre guten Eigenschaften auf die Männer übertrugen, ihnen so ein angesehenes Leben verschafften, für die lange Reise in den Krieg stärkten und ihm dadurch das vollkommende Glück schenkten.
Nur durch die Frau wird der Mann zu dem Wesen, das er repräsentiert.
Mit dieser Umwandlung der Geschlechterrollen verließen die Minnesänger die reale Welt.
Dieses Hintergrundwissen über die Schönheit der Frau in der Minnedichtung ist notwendig, will man das Märe von „Der treuen Gattin“ richtig verstehen.
[...]
[1] Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hrsg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller. Frankfurt a.M.1996 (Bibliothek des Mittelalters Bd. 23)
[2] Joachim Bumke : Höfische Kultur Band 2. 2. Auflage. München: Dt. Taschenbuch-Verlag 1986
[3] Christa Ortmann u. Hedda Ragotzky: Zur Funktion exemplarischer "triuwe"-Beweise in Minne-Mären: "Die treue Gattin" Herrands von Wildonie, "Das Herzmäre" Konrads von Würzburg und die "Frauentreue". In: Kleinere Erzählformen im Mittelalter. Paderborner Colloquium 1987. Hg. v. K. Grubmüller, L.P. Johnson u. H.-H. Steinhoff. Paderborn 1988. S. 89-109
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "triuwe"-Beweis in Herrands von Wildonie Märe?
Es ist der Beweis der Treue und ethischen Vollkommenheit der Ehefrau gegenüber ihrem körperlich unansehnlichen Mann.
Welches Schönheitsideal herrschte in der Minnedichtung?
Äußere Schönheit (blondes Haar, weiße Hände) galt als Spiegel innerer Tugendhaftigkeit; beide zusammen bildeten das höfische Frauenbild.
Wie unterscheidet sich das Frauenbild der Minnesänger von der Realität?
Während Frauen real oft als minderwertig galten, stilisierten Minnesänger sie zu vollkommenen Wesen, die den Mann durch ihre Tugend erst veredeln.
Welche Rolle spielt die körperliche Erscheinung des Mannes im Märe?
Der Mann wird als runzelig und klein beschrieben, was einen starken Kontrast zur unendlich schönen Gattin bildet und die Bedeutung der inneren Werte (Treue) hervorhebt.
Warum ist der "triuwe"-Begriff für das Mittelalter so zentral?
Triuwe (Treue) war eine fundamentale Tugend des höfischen Lebens, die soziale Bindungen und religiöse Integrität sicherstellte.
- Citation du texte
- Julia Schriewer (Auteur), 2004, Der "triuwe"- Beweis der Ehefrau in "Die treue Gattin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205851