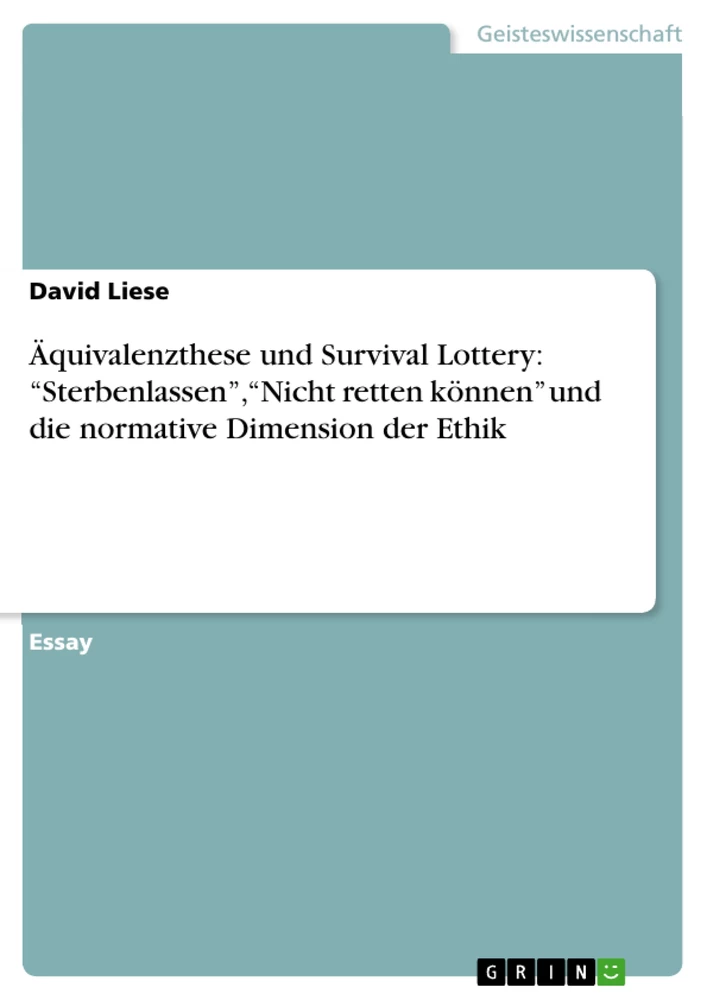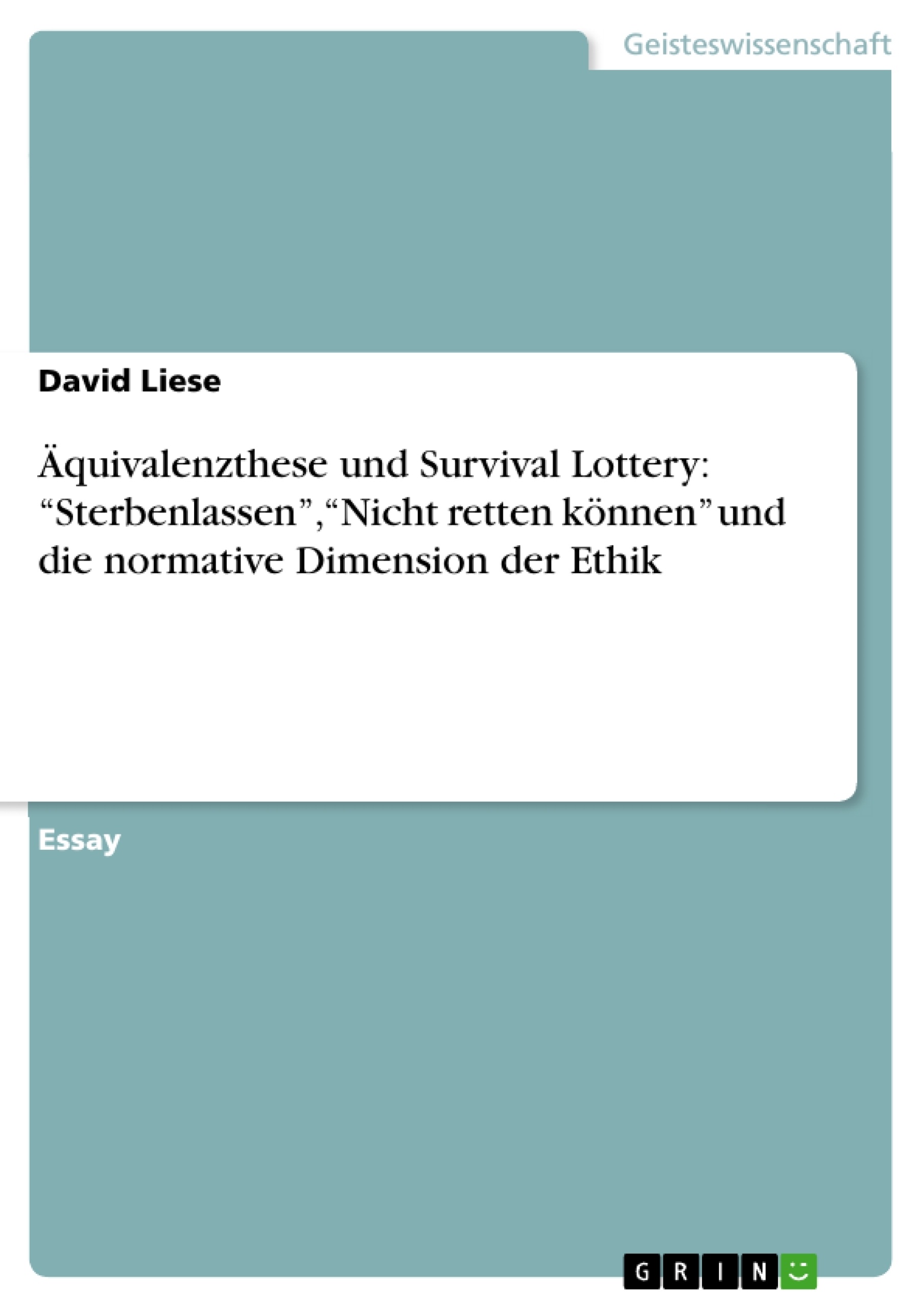Was ist Ethik? Folgt man Immanuel Kant, so lässt sie sich als diejenige philosophische Disziplin definieren, die sich mit der Beantwortung der Frage „Was soll ich tun?“auseinandersetzt. Mit Hinblick darauf ließe sie sich auch als „Reflexionstheorie der Moral“, also der gesellschaftlich geteilten Vorstellung von gutem Handeln, bezeichnen. Diese begriffliche Differenzierung von Ethik und Moral, so trivial sie im ersten Moment auch erscheinen mag, ist für den nachfolgenden Gedankengang von großer Bedeutung. Er behandelt ein äußerst sensibles Thema, das insbesondere im Bereich der angewandten Ethik immer wieder für heftige Auseinandersetzungen sorgt, nämlich die These der moralischen Äquivalenz von Töten und Sterbenlassen. Ausgehend von einer knappen Illustration der Konfliktlinie zwischen Für- und Widersprechern dieser These soll anhand des – ebenfalls vielbeachteten – Gedankenexperimentes der „Survival Lottery“ deutlich gemacht werden, warum es für die praktische Philosophie lohnenswert sein kann, den Unterschied zwischen oben genannten Begrifflichkeiten genau im Blickfeld zu behalten.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Ethik?
- Töten und Sterbenlassen
- Die Äquivalenzthese
- Die Survival Lottery
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Äquivalenzthese, die besagt, dass Töten und Sterbenlassen moralisch gleichwertig sind. Er analysiert die Argumente von Für- und Widersprechern dieser These und beleuchtet die normative Dimension der Ethik anhand des Gedankenexperiments der „Survival Lottery“. Der Essay zielt darauf ab, die Komplexität der Unterscheidung zwischen Töten und Sterbenlassen aufzuzeigen und die Relevanz dieser Unterscheidung für die praktische Philosophie zu diskutieren.
- Moralische Äquivalenz von Töten und Sterbenlassen
- Positive und negative Pflichten
- Das Gedankenexperiment der „Survival Lottery“
- Utilitaristische und deontologische Perspektiven
- Handlungsmotivationen und deren ethische Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist Ethik?: Der Essay beginnt mit einer Klärung des Begriffs „Ethik“ im Kontext der praktischen Philosophie. Er differenziert zwischen Ethik als Reflexionstheorie der Moral und Moral als gesellschaftlich geteilter Vorstellung von gutem Handeln. Diese Unterscheidung ist zentral für die Auseinandersetzung mit der Äquivalenzthese von Töten und Sterbenlassen, einem sensiblen Thema der angewandten Ethik, das im weiteren Verlauf des Essays im Mittelpunkt steht. Die begriffliche Grundlage wird gelegt, um die folgenden Argumentationen zu verstehen und zu kontextualisieren. Die Unterscheidung zwischen Ethik und Moral dient als methodisches Fundament für die folgende Analyse ethischer Dilemmata.
Töten und Sterbenlassen: Dieses Kapitel beschreibt den Disput um die moralische Relevanz der Unterscheidung zwischen Töten und Sterbenlassen, vor allem zwischen Konsequentialisten und Non-Konsequentialisten (Deontologen). Es werden die Argumente von Richard Trammell vorgestellt, der für intrinsisch moralische Werte und den Unterschied zwischen positiven und negativen Pflichten plädiert. Trammell argumentiert, dass negative Pflichten (z.B. nicht töten) leichter erfüllbar sind als positive Pflichten (z.B. jemanden retten) und dass die Verantwortlichkeit des Handelnden unterschiedlich ist. Die Arbeiten von Judith Thomson werden ebenfalls einbezogen, welche die Komplexität und den kontextabhängigen Charakter der moralischen Beurteilung von Töten und Sterbenlassen hervorheben. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Diskussion um die Äquivalenzthese.
Die Äquivalenzthese: Dieses Kapitel behandelt die Position von James Rachels, einem prominenten Verteidiger der Äquivalenzthese. Rachels widerlegt Trammells Argumente, indem er zeigt, dass die unterschiedliche Erfüllbarkeit positiver und negativer Pflichten nicht die Äquivalenzthese widerlegt, sondern lediglich den Kreis der potentiell zu rettenden Personen einschränkt. Er kritisiert die Annahme, dass Sterbenlassen weniger aktiv sei als Töten, und argumentiert, dass der Unterschied in der Handlungsaktivität nicht automatisch eine moralische Differenz impliziert. Rachels differenziert zwischen Sterbenlassen und „nicht retten können“, ein Punkt, der im weiteren Verlauf des Essays an Bedeutung gewinnt.
Die Survival Lottery: Dieses Kapitel analysiert John Harris' Gedankenexperiment der „Survival Lottery“, in dem ein Lotteriesystem zur Organentnahme für Transplantationen vorgeschlagen wird. Das Experiment dient als Illustration für ein utilitaristisches Ethikideal, in dem die moralische Richtigkeit einer Handlung allein an ihrem Ergebnis gemessen wird. Intuitiv erscheint die „Survival Lottery“ moralisch verwerflich. Der Essay diskutiert, ob die Ablehnung der „Survival Lottery“ die Äquivalenzthese widerlegt. Es wird argumentiert, dass die „Survival Lottery“ eher die moralische Gleichheit von Töten und „nicht retten können“ voraussetzt, nicht aber die von Töten und Sterbenlassen. Die unterschiedlichen semantischen Implikationen von „Sterbenlassen“ und „nicht retten können“ werden betont.
Schlüsselwörter
Äquivalenzthese, Töten, Sterbenlassen, positive Pflichten, negative Pflichten, Konsequentialismus, Deontologie, Utilitarismus, Survival Lottery, Handlungsoption, Verantwortlichkeit, moralische Bewertung, Handlungsmotivation.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Töten und Sterbenlassen – Eine ethische Analyse
Was ist der zentrale Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht die umstrittene Äquivalenzthese, die besagt, dass Töten und Sterbenlassen moralisch gleichwertig sind. Er analysiert diese These anhand verschiedener philosophischer Perspektiven und ethischer Argumente, unter Einbezug relevanter Gedankenexperimente.
Welche ethischen Theorien werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt den Konsequentialismus und die Deontologie. Der Konsequentialismus, insbesondere der Utilitarismus, wird anhand des Gedankenexperiments der „Survival Lottery“ illustriert. Die Deontologie wird durch die Auseinandersetzung mit der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Pflichten repräsentiert.
Welche Autoren und deren Argumente werden im Essay diskutiert?
Der Essay bezieht sich auf die Arbeiten von James Rachels (Verteidiger der Äquivalenzthese), Richard Trammell (mit Argumenten gegen die Äquivalenzthese, basierend auf der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Pflichten) und Judith Thomson (zur Komplexität der moralischen Beurteilung von Töten und Sterbenlassen). John Harris' „Survival Lottery“ dient als zentrales Gedankenexperiment.
Was ist die „Survival Lottery“ und welche Rolle spielt sie im Essay?
Die „Survival Lottery“ ist ein Gedankenexperiment von John Harris, das ein Lotteriesystem zur Organentnahme für Transplantationen vorschlägt. Sie dient als Beispiel für einen utilitaristischen Ansatz und wird im Essay dazu verwendet, die Implikationen der Äquivalenzthese zu diskutieren und die Grenzen utilitaristischer Ethik aufzuzeigen. Der Essay untersucht, ob die intuitive Ablehnung der „Survival Lottery“ die Äquivalenzthese widerlegt.
Wie wird die Unterscheidung zwischen Töten und Sterbenlassen im Essay behandelt?
Der Essay beleuchtet die verschiedenen Aspekte dieser Unterscheidung, einschließlich der Debatte zwischen Konsequentialisten und Deontologen. Er diskutiert die Argumente, die die moralische Relevanz dieser Unterscheidung betonen (z.B. Trammells Fokus auf positive und negative Pflichten) und die Argumente, die diese Unterscheidung in Frage stellen (z.B. Rachels' Kritik an der Unterscheidung zwischen aktivem Töten und passivem Sterbenlassen).
Welche Kapitel umfasst der Essay und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Essay gliedert sich in Kapitel zu: „Was ist Ethik?“, „Töten und Sterbenlassen“, „Die Äquivalenzthese“ und „Die Survival Lottery“. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit der Klärung des Begriffs „Ethik“ und der Einführung der zentralen Problematik, über die Darstellung gegensätzlicher Positionen bis hin zur Analyse des Gedankenexperiments der „Survival Lottery“ als illustratives Beispiel.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Äquivalenzthese, Töten, Sterbenlassen, positive Pflichten, negative Pflichten, Konsequentialismus, Deontologie, Utilitarismus, Survival Lottery, Handlungsoption, Verantwortlichkeit, moralische Bewertung und Handlungsmotivation.
Für wen ist dieser Essay gedacht?
Der Essay richtet sich an Leser mit Interesse an angewandter Ethik und philosophischen Fragen der Moral. Vorkenntnisse in Ethik sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Welche Schlussfolgerung zieht der Essay?
Der Essay zielt nicht auf eine definitive Schlussfolgerung ab, sondern beleuchtet die Komplexität des Themas und die verschiedenen Argumentationslinien. Er fördert ein differenziertes Verständnis der Äquivalenzthese und ihrer Implikationen.
- Quote paper
- B.A. David Liese (Author), 2012, Äquivalenzthese und Survival Lottery: “Sterbenlassen”, “Nicht retten können” und die normative Dimension der Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206181