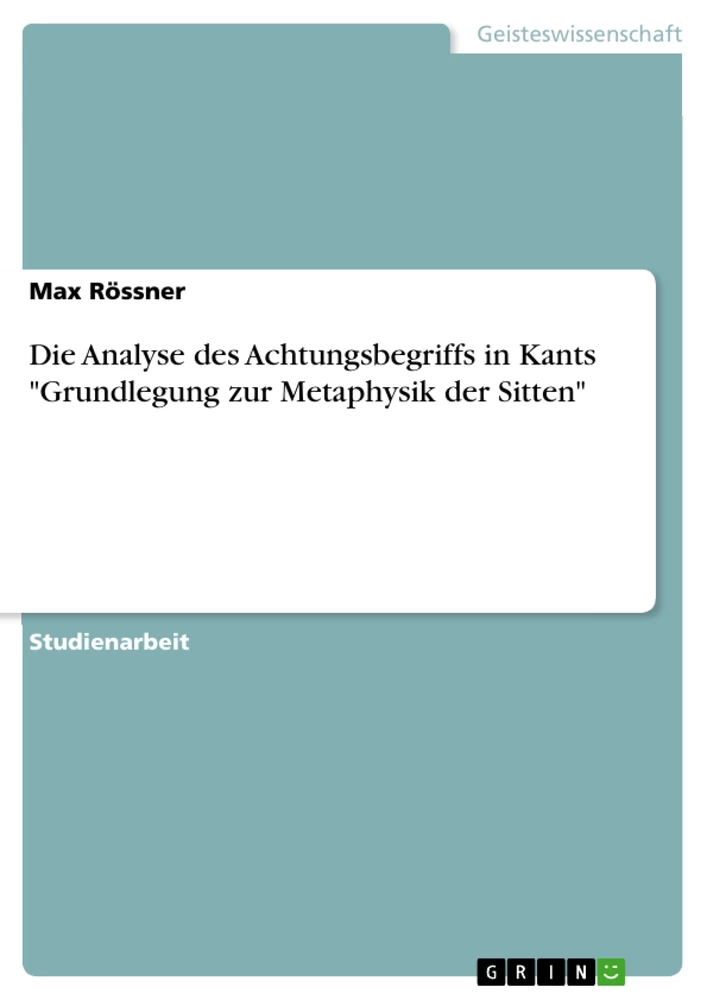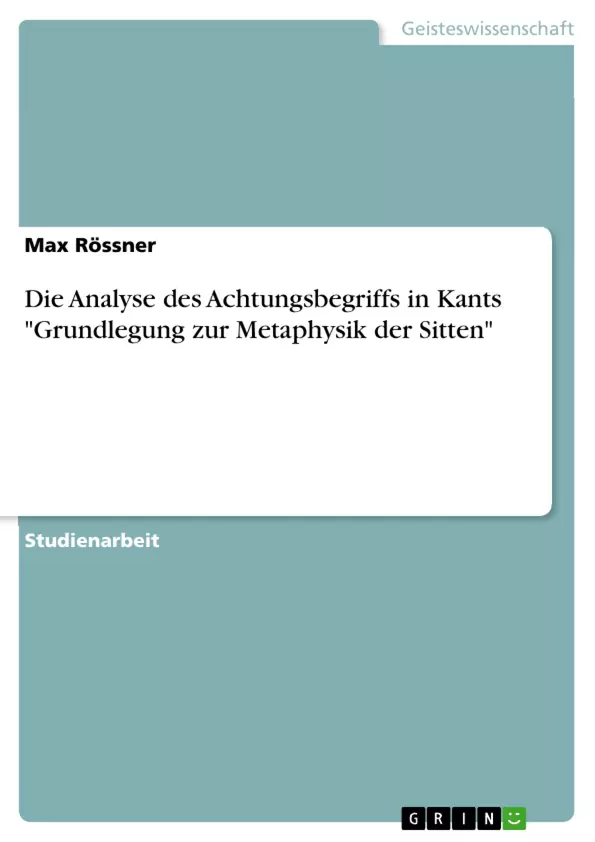Wie fest auch immer die Werke Immanuel Kants im Lehrplan fast aller philosophischen Fakultäten der Welt verankert sein mögen- der Achtungsbegriff hat neben Begeisterung und vielfältiger Interpretationen auch vehemente Kritik, ja Ablehnung erfahren müssen. Es erscheint beinahe skurril, dass ein einzelnes Motiv wie das der Achtung, zu dem Kant in seiner 1785 erschienenen „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ kaum mehr als die groben Konturen liefert, zu solch widersprüchlichen Rezensionen geführt hat; aber es ist wohl gerade diese Knappheit der Kantischen Formulierungen –wenn auch in der typischen messerscharfen Präzession-, die die Jahrhunderte währenden kontrovers geführten Diskurse bedingt. Fest steht jedenfalls, dass der Achtung in seiner Ethik eine Schlüsselrolle zukommt, denn „[…] sollte der Kantische Begriff der Achtung als Triebfeder moralischer Handlungen nicht hinreichend bestimmt sein, so bliebe auch der Begriff der Moralität ungeklärt […]“ . Und somit ist es nicht abwegig, das bekannte Bild vom gefügten Turm herbei zu zitieren- zieht man ein Steinchen heraus, weil es zum sonstigen Bau inkohärent steht, fällt das Gebäude wohl als Ganzes, verliert im mindesten einiges an Stabilität. Doch es steht nicht schlecht um die Rettung bzw. Plausibilisierung der Achtung, denn dem Ruf des Ethiklehrers aus Königsberg folgt noch heute eine reiche und kompetente Schar an Apologeten, die sich die Lösung dieses hochkomplexen Themas auf die Fahne geschrieben haben. In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, den Argumentationen eines Teils von Ihnen- allein die Fülle zwingt zur Selektion- kritisch prüfend nachzugehen. Lässt sich die fast einschlägige Titulierung von Kants Ethik als einer reinen Pflichtenethik ohne emotionale Affirmation halten?
Gliederung
1. Kants Weg zwischen empirischer moral-sense-Theorie und ethischem Intellektualismus-Ausgangslagen
1.1 Systematische Stellung der Achtung
1.1.1 Die drei Sätze zur Pflicht- in welchem taucht die Achtung zunächst auf?
1.1.2 Sind Handlungen aus Pflicht und Handlungen aus Achtung dasselbe?
1.2 Affektives Wesen und Objekt der Achtung
1.2.1 Akutes Gefühl oder Disposition?
1.2.2 Selbstbezüglichkeit des Moralprinzip
1.3 Funktionen der Achtung
1.3.1 Die konstitutive Lücke zwischen moralischer Einsicht und moralischem Handeln - der Wille
1.3.2 Die Achtung als principium executionis
2. Kritik und Apologie zur Realisierbarkeit: Gegenentwürfe
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Begriff "Achtung" in Kants Ethik?
Die Achtung ist die zentrale Triebfeder moralischen Handelns. Sie ist das Gefühl, das durch das Bewusstsein des moralischen Gesetzes in uns selbst hervorgerufen wird.
Ist Kants Ethik rein gefühlskalt?
Obwohl sie oft als reine Pflichtenethik bezeichnet wird, zeigt die Analyse des Achtungsbegriffs, dass eine emotionale Affirmation des Gesetzes für das menschliche Handeln notwendig ist.
Was ist das Objekt der Achtung?
Für Kant gilt die Achtung allein dem Gesetz (dem kategorischen Imperativ) und Personen nur insofern, als sie dieses Gesetz in ihrem Charakter verkörpern.
Was versteht Kant unter "principium executionis"?
Es beschreibt die Achtung als das Prinzip der Ausführung, das die Lücke zwischen der rein vernünftigen Einsicht und dem tatsächlichen Willen zur Handlung schließt.
Warum ist die Definition der Achtung so umstritten?
Kants knappe Formulierungen lassen Spielraum für Interpretationen, ob Achtung ein bloßes Begleitgefühl oder eine notwendige Voraussetzung für die Moralität einer Handlung ist.
- Quote paper
- Max Rössner (Author), 2010, Die Analyse des Achtungsbegriffs in Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206184