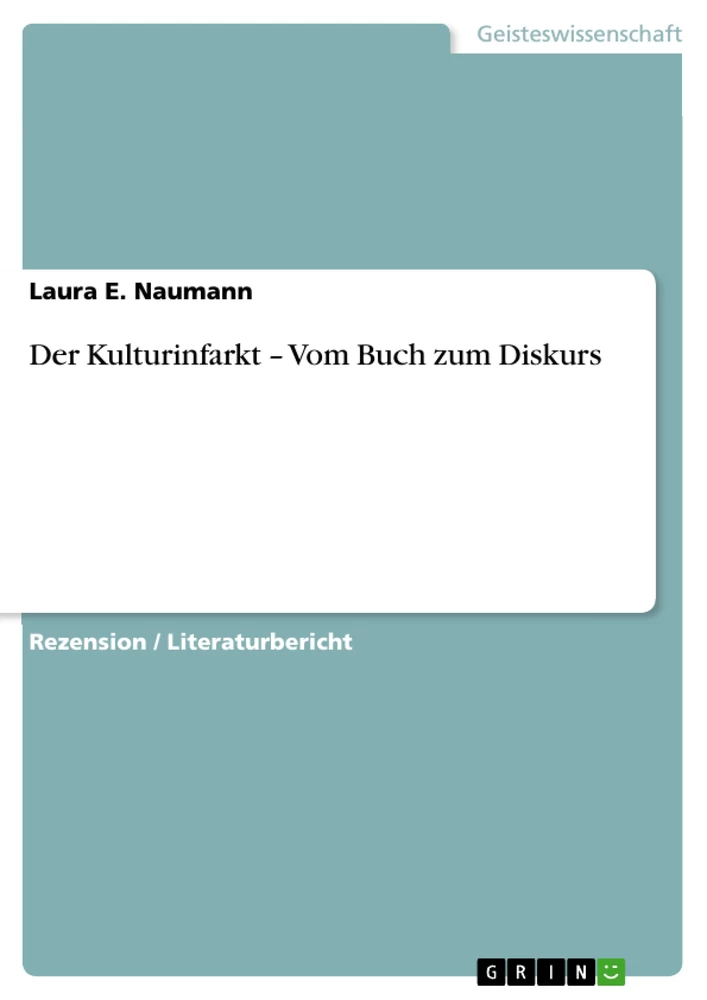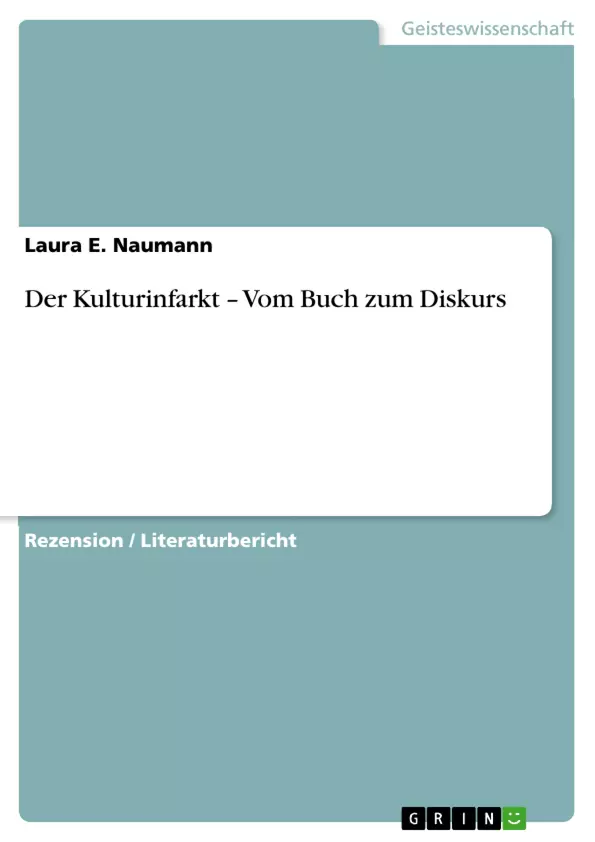Die vorliegende Hausarbeit entstand im Rahmen des Seminars Musik und ihre Vermittlung. Sie dient als Verschriftlichung meines Referats vom 10. Juli 2012. Thema des Referats war das diesjährig erschienene Buch Kulturinfarkt – Von Allem zu viel und überall das Gleiche, herausgegeben von den Autoren Dieter Haselbach, Armin Klein, Stephan Opitz und Pius Knüsel.
Ich dieser Hausarbeit werde ich zusätzlich in den Kapiteln 1 - 4 das Thema Kulturinfarkt näher erläutern und auf einzelne, ausgewählte Aspekte genauer eingehen, um sie exemplarisch hervorzuheben. Kapitel eins beschreibt, wie es dazu kam, dass sich die Kultur zu einer Selbstdefinition des Staates formte und welche Aufgaben für die Kultur damit verbunden sind. Das zweite Kapitel beinhaltet einige Gedanken zur Nachfrageorientierung und der damit verbundenen Probleme, bevor im dritten Kapitel die 'Probleme der Kultur', wie sie im Buch Kulturinfarkt aufkommen, erklärt werden. Anschließend folgen in Kapitel vier Lösungsvorschläge der Kulturinfarkt-Autoren. Auf einige werde ich eingehen, andere außer Acht lassen, da sie sonst den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen werden. Im fünften Kapitel erläutere ich kurz die Biografien der Autoren und im sechsten Kapitel folgt ein Überblick auf Rezensionen und Kritiken, die nach Erscheinen des Buchs Kulturinfarkt in den Medien entstanden sind. In Kapitel sieben komme ich zu
meinem persönlichen Fazit.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Die Kultur-Entwicklung in Deutschland
2. Der Status Quo der Kulturpolitik
3. Das Probleme der Kultur
4. Ein Lösungsvorschlag der Autoren
5. Über die Autoren
6. Der Diskurs zum Buch
7. Meine persönliche Einschätzung und Fazit
Literaturangaben
Quellennachweise
Vorwort
Die vorliegende Hausarbeit entstand im Rahmen des Seminars Musik und ihre Vermittlung. Sie dient als Verschriftlichung meines Referats vom 10. Juli 2012. Thema des Referats war das diesjährig erschienene Buch Kulturinfarkt – Von Allem zu viel und überall das Gleiche, herausgegeben von den Autoren Dieter Haselbach, Armin Klein, Stephan Opitz und Pius Knüsel.
Ich dieser Hausarbeit werde ich zusätzlich in den Kapiteln 1 - 4 das Thema Kulturinfarkt näher erläutern und auf einzelne, ausgewählte Aspekte genauer eingehen, um sie exemplarisch hervorzuheben. Kapitel eins beschreibt, wie es dazu kam, dass sich die Kultur zu einer Selbstdefinition des Staates formte und welche Aufgaben für die Kultur damit verbunden sind. Das zweite Kapitel beinhaltet einige Gedanken zur Nachfrageorientierung und der damit verbundenen Probleme, bevor im dritten Kapitel die 'Probleme der Kultur', wie sie im Buch Kulturinfarkt aufkommen, erklärt werden. Anschließend folgen in Kapitel vier Lösungsvorschläge der Kulturinfarkt- Autoren. Auf einige werde ich eingehen, andere außer Acht lassen, da sie sonst den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen werden. Im fünften Kapitel erläutere ich kurz die Biografien der Autoren und im sechsten Kapitel folgt ein Überblick auf Rezensionen und Kritiken, die nach Erscheinen des Buchs Kulturinfarkt in den Medien entstanden sind. In Kapitel sieben komme ich zu meinem persönlichen Fazit.
1. Die Kultur-Entwicklung in Deutschland
In Deutschland entwickelte sich die Kulturpolitik als Teil der eigenen staatlichen Identität. Im Gegensatz zu anderen Nationen, wie Frankreich, das sich über ihre selbst ernannte République definiert, oder wie England, das häufig als Empire oder Commonwealth bezeichnet wird. Deutschland ist daneben der „Kulturstaat“[1]. Aus einer Selbstdefinitionsnot heraus ergaben sich damit verschiedene Aufgaben, die dieser Kulturstaat mit der Förderung der Kultur, zu erfüllen versucht. Darunter fallen folgende Schlagworte, die sich die Kultur zur Aufgabe gemacht hat: Vergangenheitsbewältigung, Einigung, Integration, Moralisierung,
Der Kulturinfarkt – Vom Buch zum Diskurs 2
„die Demokratisierung befördern, die Fremden integrieren, die Wirtlichkeit der Städte steigern, die geistige Einheit der Nation herstellen, die Neonazis vertreiben, den Frieden sichern, wirtschaftliches Wachstum generieren, sozialen Ausgleich schaffen“[2].
Der Staat sieht alles, was er selbst nicht kontrollieren kann, alles was er vielleicht kaputt gemacht hat, als die Aufgabe der Kultur:
„Kultur (…)würde dem sozialen Zusammenhalt dienen, der Versöhnung, der Integration von Immigranten, der Entwicklungshilfe, sei hilfreich für nationale Anliegen im internationalen wirtschaftlichen Konkurrenzkampf, für die nationale Selbstdarstellung im Ausland, und sie leiste, so die jüngste Erkenntnis, einen substanziellen Beitrag zum Bruttosozialprodukt“[3].
Eine Entwicklung, die sich heute in fast jedem Kulturinstitut findet, ist die kulturelle Bildung. Sie wird in Workshops gefördert und in etlichen Angeboten rund um die Kunst und die Musik vermittelt. Volkshochschulkurse und Studiengänge mit dem Zusatz Vermittlung sind in den letzten Jahren zahlreich angeboten worden und entstanden „Sofort wurden neue Berufsfelder geboren“[4]. Die hohe Nachfrage zeigt, wie wertvoll oder nötig eine kulturelle Förderung ist.
Auch ist das im Sinne des Staates, der sich nur weiterhin als Kulturstaat behaupten kann, wenn er seine Bürger ästhetisch erzieht[5].
Deutschland tut bislang, und tat viel zur Förderung der Kultur und zur Bestätigung der Selbstbeschreibung als Kulturstaat. Der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann sprach dieses Thema schon in seinem 1984 erschienen Buch Kultur für alle[6] an und kritisierte damit zugleich. Mit Kultur für alle war ein Ausdruck geschaffen, der die Kulturpolitik noch bis heute präge. Er symbolisiert dabei auch den Hauptkritikpunkt der vier Kulturinfarkt-Autoren.
Die kulturelle Grundversorgung durch den Staat wurde nach dem zweiten Weltkrieg nach und nach erfüllt. Nach 1977 gab es einen massiven Ausbau (sozio-)kultureller Einrichtungen. Seitdem gibt es sechsmal mehr Volkshochschulen, siebenmal mehr öffentliche Bibliotheken und die Anzahl der Musikschulen hat sich um den Faktor Acht erhöht[7].
Durch diese enorme Förderung ergab sich eine stetige Präsenz von Kultur im Lebensalltag der Menschen. Heute ist die „Kunst […] den Ruf des verstaubten Lustkillers los. Sie steht allen zur
Der Kulturinfarkt – Vom Buch zum Diskurs 3
Verfügung, zu anständigem Preis und in erreichbarer Nähe“[8].
Ein Erreichen aller Menschen einer Gesellschaft wurde vor allem durch die Entwicklung der Medien zu Massenmedien und durch die Massenproduktion zuerst im Buchdruck, dann im Radio, später im Fernsehen und seit den letzten Jahrzehnten im Internet, erreicht.
2. Der Status Quo der Kulturpolitik
Eine staatliche „Förderung befreit die Kunst, der Markt versklavt sie“[9]. Das hat Adorno schon festgestellt und danach scheint sich die Kulturpolitik zu richten. Denn die Wirtschaft gilt allgemein „als System von Zwängen, das den Kreativen keine Freiheit lässt“[10]. Eine Förderung schafft Unabhängigkeit und kann die Kultur dann auch vor den Zwängen einer profitorientierten Wirtschaft beschützen.
„Nur staatlich geförderte Kunst ist wirklich frei, sich kritisch zu äußern. Deshalb hat der Staat die Freiheit der Kunst in der Verfassung verankert.[11] “
Dadurch genießt die Kultur mehr Freiheiten, als etwas, dass nicht gefördert, nicht geschützt wird. Die Autoren des Kulturinfarkts setzten diese Freiheit der Kultur gleich mit einer „Freiheit von der Nachfrage“[12]. Doch ohne Nachfrage scheint es keinen Bedarf zu geben. Und was dann aber dennoch gefördert und angeboten wird, hat schlechte Karten.
Eine Nachfrage ist erfahrungsgemäß dort, wo es etwas Interessantes, Außergewöhnliches zu sehen und zu erleben gibt.
„Wo alle hingehen, so die Regel der postmodernen Erlebnisgesellschaft, muss das Erlebnis nah sein. […] Die angesammelte Energie von Hunderttausenden erzeugt eine Aura, von der man hofft, sie springe auf einen selbst über“[13].
Dabei fordern die Zuschauer immer stärkere Reize. Was auch ein Grund ist, warum die Themen Gewalt, Sex, Pornografie und Verstörung in den Medien als wichtige Träger von Informationen dienen. „Deshalb privilegiert die Kulturförderung das Exzentrische, das Originelle, das dezidiert Individuelle“[14]. Auch in der Kultur kann so Aufregen und Empörung erzeugt werden, was für die Rezeption des Inhaltes eines Theaterstücks, Kunstwerks oder Konzerts förderlich sein kann.
Der Kulturinfarkt – Vom Buch zum Diskurs 4
3. Die Probleme der Kultur
Im Folgenden werden die verschiedenen Probleme der Kultur und der Kulturpolitik in Form von Thesen aus dem Buch Kulturinfarkt aufgezählt und erläutert.
1. „Im Jahr 2012 verfügen die öffentlichen Museen Deutschlands praktisch über keine Anschaffungsetats mehr. Auch die Personalkosten sind kaum gesichert“[15] . Die geringen Einnahmen verschiedener Kulturinstitute resultieren, so die Autoren, aus einem Überangebot an Kultur. Die Nachfrage ist gedeckt und alle weiteren Angebote finden keine Rezipienten, was wiederum keine Einnahmen bedeutet
2. Trotz einer ausgeprägten Kulturlandschaft wird 'Deutsche Kultur' nicht international rezipiert. Dies bezieht sich hauptsächlich auf Film- und Fernsehproduktionen. Internationale Produktionen, an denen Deutschland auch beteiligt ist, müssen auch ausgenommen werden. Im Bereich Musik und Kunst trifft diese These nicht zu. Womöglich sind aber die Informationen, wo und wann rezipiert wird, nur einem fachkundigen Interessenten bekannt. Die Massenmedien verbreiten die Erfolge deutscher Interpreten und Produktionen nicht
3. Die Kultur sollte eigentlich schichtübergreifend sein. Jedoch wird sie vom sogenannten Bildungsbürgertum bestimmt. „Menschen mit höherem Abschluss stellen zwei Drittel bis drei Viertel der Kulturbesucher“[16]. Diese Behauptung wird im Buch nicht statistisch belegt. Zudem ist hier stark zu differenzieren: Eine Aufführung im Opernhaus wird von einem anderen Publikum bestimmt, als ein Rockkonzert in der Stadthalle. Beides zählt gleichermaßen zum Kulturinhalt
4. Die Kunst- und Kultureinrichtungen/-stiftungen sind zu staatsabhängig. Sie richten ihre Produktion nicht nach der Nachfrage. Gefördert wird die Institution nicht direkt die Produktion von Kunst. Dadurch entsteht ein Paradox: Die öffentliche Nachfrage geht zurück, da das Angebot zu groß ist, oder da die Produktion schlichtweg kein Publikum findet. Dabei steigen aber aufgrund der schlechten Wirtschaft die Produktionskosten. Daraus resultieren schlechte Löhne für freie Schauspieler, Sänger, Tänzer (da sie oft je nach Produktion angeworben werden) – deutlich bessere Tarife und Löhne aber für Musiker, Choristen und Bühnenarbeiter (da sie oft direkt bei der Einrichtung angestellt sind und so auch indirekt staatliche Fördergelder erhalten)
5. Es gibt keine „transparente, systematische Personalentwicklung“[17] in der Kultur-politik. Nicht zu durchschauen ist die Besetzung von Kulturämtern auf Bundes- und Landesebene
[...]
[1] Haselbach, Dieter / Klein, Armin / Opitz, Stephan / Pius, Knüsel: Der Kulturinfarkt. Von Allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention. München 2012. S. 89.
[2] Kulturinfarkt. S. 11.
[3] Ebenda. S. 118.
[4] Ebenda. S. 111.
[5] Ebenda. S. 25.
[6] Hoffmann, Hilmar: Kultur für alle – Perspektiven und Modelle. Frankfurt 1984.
[7] Vgl. Kulturinfarkt. S. 16.
[8] Kulturinfarkt. S. 108.
[9] Ebenda. S. 135.
[10] Ebenda. S. 136.
[11] Ebenda. S. 69.
[12] Ebenda. S. 136.
[13] Ebenda. S. 72.
[14] Ebenda. S. 34.
[15] Kulturinfarkt. S. 19.
[16] Ebenda. S. 82.
[17] Ebenda. S. 50.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage des Buches "Kulturinfarkt"?
Die Autoren behaupten, es gäbe in Deutschland ein Überangebot an staatlich geförderter Kultur ("von Allem zu viel"), das an der tatsächlichen Nachfrage vorbeigeht.
Warum wird Deutschland oft als "Kulturstaat" bezeichnet?
Da sich Deutschland historisch über seine Kultur definiert (im Gegensatz zu anderen Nationen), sieht der Staat die Kulturförderung als essenzielle Aufgabe zur Identitätsstiftung.
Welche Kritik üben die Autoren an der staatlichen Förderung?
Sie argumentieren, dass die Förderung die Kunst zwar befreit, aber auch zu einer "Freiheit von der Nachfrage" führt, was Museen und Theater oft leer lässt.
Wer besucht laut den Autoren hauptsächlich Kultureinrichtungen?
Die Autoren stellen die These auf, dass Kulturangebote primär vom Bildungsbürgertum genutzt werden und somit nicht die gesamte Breite der Gesellschaft erreichen.
Was fordern die Autoren als Lösung?
Das Buch schlägt radikale Reformen vor, darunter eine stärkere Orientierung an der Nachfrage und eine Reduzierung der institutionellen Förderung.
- Quote paper
- Laura E. Naumann (Author), 2012, Der Kulturinfarkt – Vom Buch zum Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206257