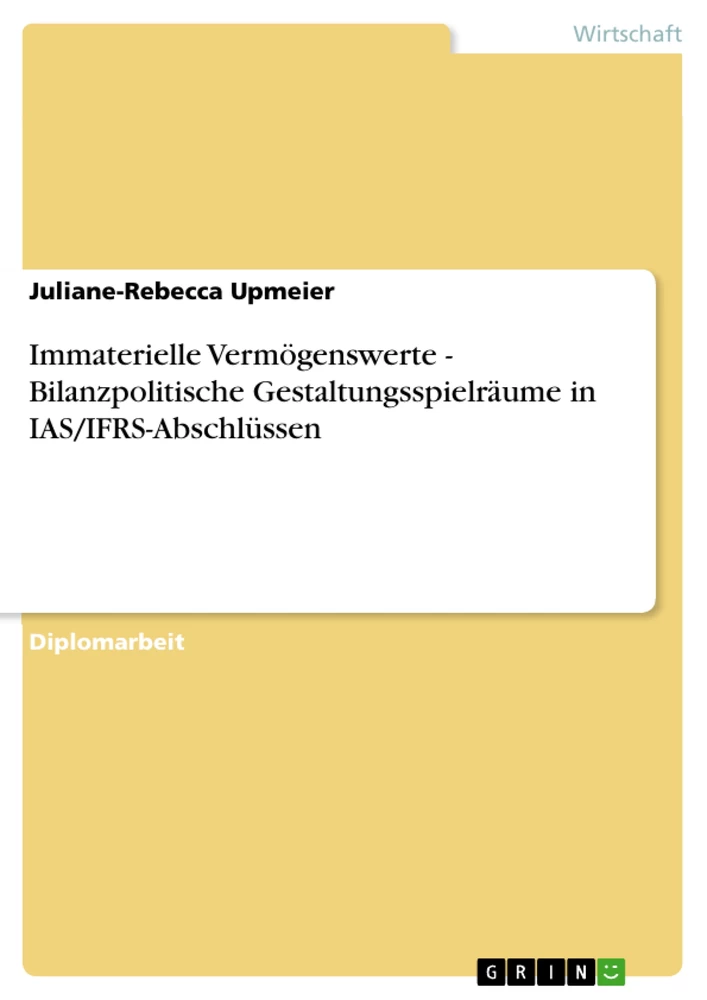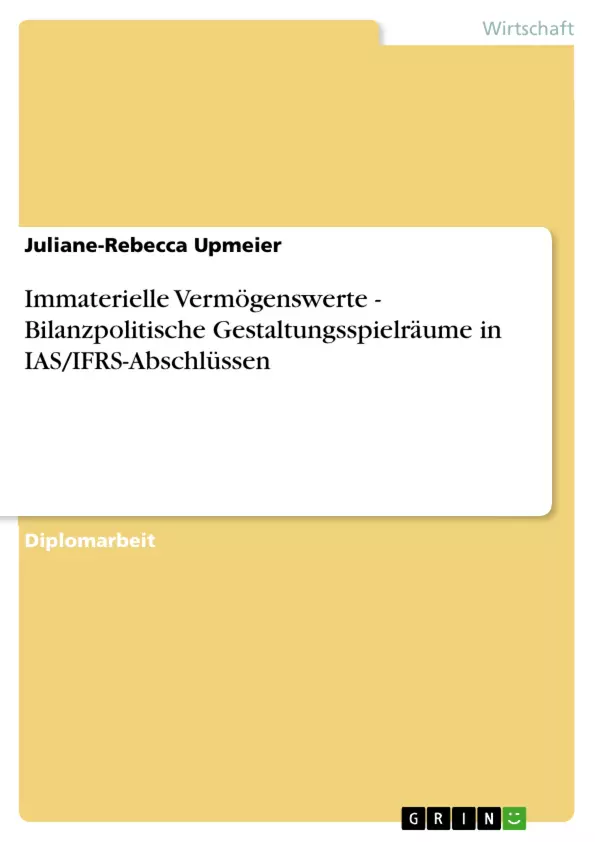Die erste Dekade des neuen Jahrtausends zeichnete sich aus globaler Sicht insbesondere durch ein rasantes Wachstum jener Branchen aus, welche dem Informations-, Dienstleistungs- und Technologiesektor
hinzuzurechnen sind. Ein typisches Charakteristikum solcher Branchen ist dessen,
gemessen an der Bilanzsumme, hoher Anteil an gehaltenem immateriellen Vermögen in der Unternehmensbilanz.
Unlängst kommt immateriellem Vermögen aber auch branchenübergreifend
häufig eine Schlüsselstellung, als erfolgsentscheidender Faktor, zu. Die zunehmende Verschiebung
der Bedeutung klassischer Substanzwerte, relativ zu immateriellen Werten, stellt auch neue
Herausforderungen an die Rechnungslegung dar. Die diese Werte typisierende Eigenschaft der
Immaterialität begründet jedoch auch die oftmals bestehenden Objektivierungsschwierigkeiten
solcher Werte, welche Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume eröffnen können. So betitelte Moxter bereits früh immaterielle Werte als die ”ewigen Sorgenkinder des Bilanzrechts“. Den
aktivierten immateriellen Werten stehen in der Regel keine zeitlich unmittelbar korrespondierenden
Erträge gegenüber, welches diese häufig als ”unsichere Werte“ erscheinen lässt. Bleiben die
aus diesen Werten erhofften Erträge hingegen gänzlich aus, bergen sich potentielle Gefahren aus
einem solchen, rein ”virtuellen Vermögen“.[...]
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis für Zeitschriften und Zeitungen
Beispielverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführende Worte zur Thematik
1.2 Problemstellung
1.3 Gang der Untersuchung
2 Immaterielle Vermögenswerte nach IAS/IFRS
2.1 Begriffsbestimmung
2.1.1 Vermögenswert
2.1.2 Immaterieller Vermögenswert im Sinne des IAS 38
2.2 Abgrenzungen
3 Ansatz- und Zugangsbewertungsvorschriften
3.1 Ansatzkonzeption (IAS/IFRS-Rechnungslegung)
3.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit (IAS/IFRS)
3.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit (IAS/IFRS)
3.1.3 Gesondert angeschaffte immaterielle Vermögenswerte
3.1.4 Unternehmensintern erstellte immaterielle Vermögenswerte
3.1.5 Immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschluss und derivativer Geschäfts- oder Firmenwert gemäß IFRS 3
3.2 Zugangsbewertung
3.2.1 Gesondert angeschaffte immaterielle Vermögenswerte
3.2.2 Unternehmensintern erstellte immaterielle Vermögenswerte
3.2.3 Immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschluss und derivativer Geschäfts- oder Firmenwert gemäß IFRS 3
4 Folgebewertung
4.1 Anschaffungskosten- und Neubewertungsmodell
4.1.1 Grundsätzliche Vorgehensweise
4.1.2 Einschränkungen des Bewertungsmethodenwahlrechtes
4.2 Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen
4.2.1 Bestimmung der Nutzungsdauer
4.2.2 Planmäßige Abschreibung
4.2.3 Wertminderungsaufwendungen (Impairment-Test)
5 Impairment-Test im Sinne des IAS 36
5.1 Grundsätzliche Vorgehensweise
5.2 Obligatorischer und ereignisbezogener Impairment-Test
5.3 Anhaltspunkte für eine Wertminderung
5.4 Ermittlung des erzielbaren Betrages im Sinnes des IAS 36
5.5 Zahlungsmittelgenerierende Einheiten
5.5.1 Das Prinzip der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten
5.5.2 Zuordnung des derivativen Geschäfts- oder Firmenwertes (Goodwill)
5.6 Zuschreibung (Wertaufholung)
6 Abschlussbetrachtung
A Anhang
A.1 Partial Goodwill-Methode und Full Goodwill-Methode Überbewertungnicht-beherrschenderAnteile - aktiver Markt (1)
A.2 Partial Goodwill-Methode und Full Goodwill-Methode Überbewertungnicht-beherrschenderAnteile - aktiver Markt (2)
A.3 Entstehungsgeschichte der IAS/IFRS-Rechnungslegung
B Literaturverzeichnis
C Gesetzesverzeichnis
D Verzeichnis der Rechtsquellen der EG/EU
Häufig gestellte Fragen
Was sind immaterielle Vermögenswerte nach IAS 38?
Immaterielle Vermögenswerte sind identifizierbare, nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz, wie Lizenzen, Patente oder Software.
Welche bilanzpolitischen Spielräume gibt es bei IFRS?
Spielräume entstehen vor allem bei der Bewertung, der Schätzung der Nutzungsdauer und der Durchführung von Impairment-Tests, was Unternehmen Möglichkeiten zur Gestaltung des Jahresabschlusses bietet.
Was ist ein Impairment-Test nach IAS 36?
Ein Impairment-Test ist eine Prüfung auf Wertminderung. Dabei wird geprüft, ob der Buchwert eines Vermögenswerts höher ist als sein erzielbarer Betrag.
Wie wird der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) behandelt?
Der Goodwill wird nicht planmäßig abgeschrieben, sondern muss mindestens einmal jährlich einem Impairment-Test unterzogen werden, um außerplanmäßige Wertminderungen zu erfassen.
Warum gelten immaterielle Werte als „Sorgenkinder des Bilanzrechts“?
Aufgrund der fehlenden physischen Substanz ist ihre Bewertung oft unsicher und schwer objektivierbar, was die Gefahr von „virtuellem Vermögen“ in der Bilanz birgt.
- Quote paper
- Dipl.-Vw. Juliane-Rebecca Upmeier (Author), 2012, Immaterielle Vermögenswerte - Bilanzpolitische Gestaltungsspielräume in IAS/IFRS-Abschlüssen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206682