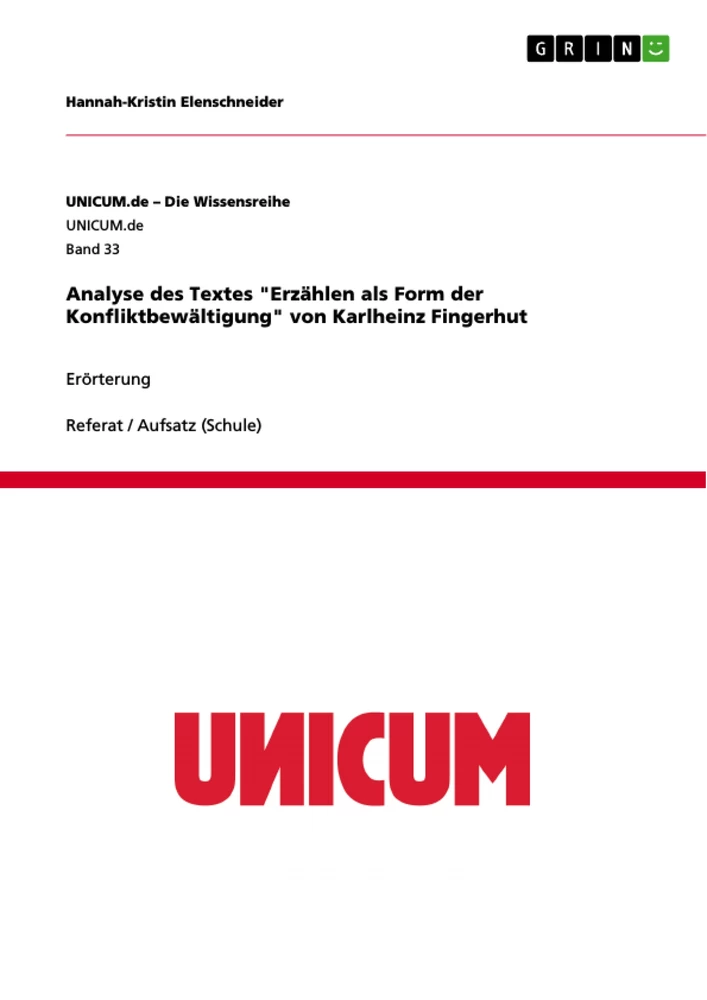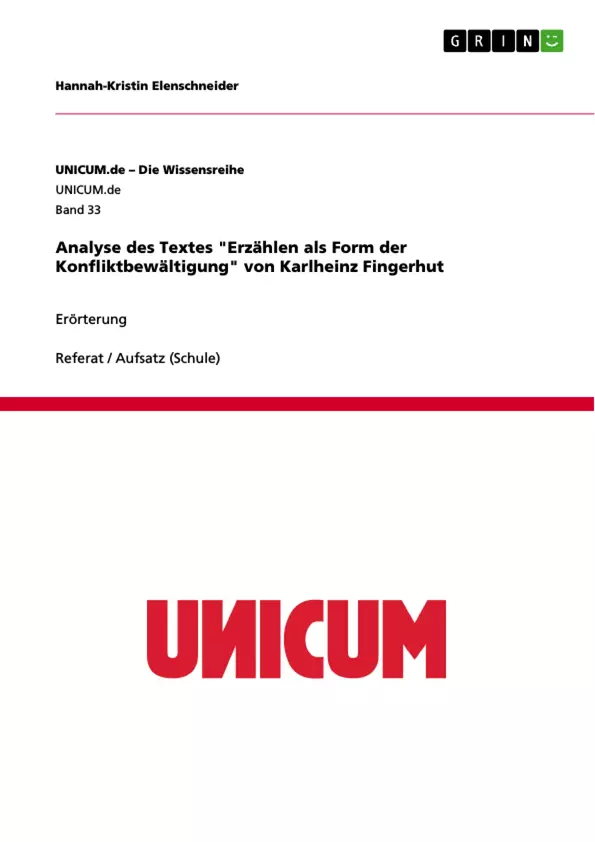A. Allgemeine Informationen zum vorliegenden Text
B. Analyse des Textes: "Erzählen als Form der Konfliktbewältigung" von Karlheinz Fingerhut
I. Beschreibung von Inhalt und Aufbau
1. Einleitungsgedanken und Hinführung zum Thema des Textes
2. Gegenüberstellen zweier Thesen über die Bedeutung des Schreibens bei Kafka
3. Thesen zu den Merkmalen der Erzählkomposition bei Kafka
4. Einschränkung der Thesen und Schlussgedanken
II. Persönliche Stellungnahme zu den Aussagen des Autors
1. Möglichkeit der Selbstreflexion
2. Schreiben als schwer kontrollierbare Inspiration
3. Bedeutung der Erzählmodelle
4. Repräsentation des Autors durch Perspektivfigur des Textes
5. Merkmale der Erzählkompositionen bei Kafka
III. Erörterung
1. Allgemeiner literarischer Wert seiner Texte
2. Vielfältige Interpretationsmöglichkeiten
3. Besondere Gestaltung seiner Texte
C. Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
- I. Erzählen als Form der Konfliktbewältigung
- 1. Einleitend stellt der Autor die Behauptung der neueren Forschung, Kafkas Schreiben sei vor allem „in der Phase des Durchbruchs [...] extrem autobiographisch\" (Z. 1) als bewiesen dar, um im Folgenden davon ausgehend die in der Forschung unterschiedlich behandelte Frage, „,welche Schlussfolgerungen für die Interpretation und die literarische Wertung”(Z. 3) von Kafkas Texten aus dieser Behauptung zu ziehen seien, als Thema zu formulieren. Dabei verweist Karlheinz Fingerhut auf einen aktuellen Gesichtspunkt der Kafka-Forschung: deren Auffassung, dass die „Egozentrik des autobiographischen Schreibens eine Form der Kommunikation darstellt, in der es dem Autor darum geht, andere an der Lösung seiner Probleme zu beteiligen\"\n(Z. 5f), leitet zum Hauptteil über.
- 2. Im ersten Sinnabschnitt beginnt er seine Argumentation mit einer Gegenüberstellung zweier Thesen, die er ausgehend von der Feststellung, dass Kafka selbst sich zu dieser Auffassung der Forschung nicht eindeutig geäußert hat, formuliert. Die eine These lautet, dass das Schreiben für Kafka eine Art ,,Möglichkeit der Selbstreflexion, des Durchspielens biographischer Konfliktsituationen\" (Z. 8) darstellt und somit „eine Art ästhetisch verfremdete[s] Probehandeln❞ (Z. 8f) ist. Dem gegenüber stellt der Autor die zweite These, dass Kafka das Schreiben „seit der Erfahrung bei der Niederschrift des Urteils [... als] schwer kontrollierbare Inspiration\" (Z. 9f) empfindet, „dessen Sinn nur andeutungsweise im nachfolgenden Leseprozess erfasst werden kann\" (Z. 11f). Als Beleg für diese Behauptung dienen ihm Zitate aus Kafkas Tagebüchern und Briefe. Der Autor zieht daraus die Schlussfolgerung, dass „die Begriffe Selbstreflexion, existenzerhellendes Figurenspiel, Probehandeln oder Erzählmodell keineswegs auf die Ästhetik des rationalen Experimentierens mit Erzählelementen reduziert werden\" (Z. 12ff.) dürfen. Seiner Meinung nach müssen sie „eine starke irrational-intuitive Komponente aufnehmen\" (Z. 14), da, so behauptet er, die Erzählmodelle „weder von der im Text auftretenden Perspektivfigur noch von dem wie in einem dunklen Tunnel schreibenden Autor (FK 349) im Einzelnen begriffen\" (Z. 14ff.) werden. Karlheinz Fingerhut ist der Auffassung, dass die verfremdeten Situationen lediglich defensive Reflexion, Verdrängungsmechanismen und Abwehrüberlegungen auslösen. Abschließend äußert er die Vermutung, dass hierin „einer der Gründe liegt, warum so viele Texte Kafkas nicht zu Ende erzählt sind und gerade die Schlussteile den Autor nicht zufrieden stellen\" (Z. 17f).
- 3. Ein darauffolgendes Zitat dient als Einschub zwischen dem ersten und zweiten inhaltlichen wie gedanklichen Abschnitt. Der Autor bedient sich einer Aussage aus Kafkas Tagebüchern, die er „kurz nach dem Beginn der im Sommer 1914 einsetzenden zweiten kreativen Phase\" (Z.19) in sein Tagebuch notiert hatte. Karlheinz Fingerhut greift die Aussage Kafkas, das Schreiben sei ein „Zwiegespräch\" (Z. 24) mit ihm selbst auf, und erörtert, ausgehend von diesem Zitat, drei Thesen. Zunächst sieht er dieses Zitat als Erklärung für die „weitgehende Kongruenz der Perspektivfiguren mit dem Bild, das der Autor [Kafka] sich von sich selbst macht\" (Z. 24f), an. Diese Kongruenz, so Karlheinz Fingerhut weiter, wurde von der Forschung bis in die Namensgebung hinein verfolgt. 2Zugleich werden seiner Meinung nach dadurch auch einige „Merkmale der Erzählkomposition\" (Z. 26) verständlich, wobei der Autor hier zwei Möglichkeiten unterscheidet und anhand verschiedener Texte Kafkas belegt: „entweder enthält bereits das Eingangsbild des Textes die zu verhandelnde Konfliktkonstellation [...], oder das Eingangsbild zeigt den Helden gesichert in seiner von ihm beherrschten Welt, während der Erzählverlauf dann schrittweise mit der Problemkonstellation auch seine wachsende Unsicherheit und Hinfälligkeit bloßlegt.\" (Z. 27-30). Karlheinz Fingerhut sieht diesen Erzähltyp vor allem in den meisten Fragmenten von Kafka, wie Das Urteil, verwirklicht. Letztendlich dient ihm diese These, die das „Schreiben als vorbewusst ablaufende[n], autoagressive[n] Rechtfertigungsmonolog [ansieht, als Erklärung für] die Affinität mancher Erzählzüge zur Traumarbeit\" (Z. 31f). Als Beispiel, und um diese These zu belegen, führt der Autor hier die „Personalisierung von Beziehungen in Erzählfiguren\" (Z. 32f) an.
- 4. Im letzen Teil übt der Autor nun Kritik an den Thesen, indem er einige weiterführende Fragestellungen äußert und Beispiele aus Kafkas Werk nennt, die durch diese Einteilungen in dieses „genetisch-explikative Deutungsschema\" (Z. 34) nicht beantwortet werden können. Karlheinz Fingerhut selbst gibt keine Antwort darauf, sondern wendet sich mehr an den Leser und regt diesen zum kritischen Nachdenken über diese Problemfragen an. Der Autor warnt lediglich davor,,,solche quer liegenden Einzelbeobachtungen durch Abstraktionen in den einmal gewählten Deutungsansatz zu integrieren\" (Z. 37f). Davon ausgehend stellt er allgemein am Schluß seines Sachtextes die Frage, „warum Kafka denn überhaupt sich selbst in der Verfremdung seiner Erzählungen ständig seine eigene Geschichte erzählt\" (Z. 39f). Karlheinz Fingerhut formuliert hier nun selbst mögliche Antworten in Form weitere Fragen. Seiner Meinung nach lassen sich all diese Funktionsbestimmungen zwar mit Hilfe von Tagebuch - und Briefstellen oder Aphorismen belegen, dennoch, so sein Einwand, bleiben sie „alle in ihrem sachlichen Fundament unsicher, [und] enthalten in ihrer Beweisführung spekulative Züge\" (Z. 43f). Karlheinz Fingerhut schließt seinen Text, der einen zum Nachdenken anregenden Schluss hat, mit einem weiteren Zitat aus Kafkas Tagebüchern, der bezüglich derartiger Explikationen, wenn er sie selbst durchführte, sehr skeptisch war und sie lediglich als „Konstruktionen\" (Z. 45) bezeichnete.
- II. Die Argumentationsstruktur von Karlheinz Fingerhut und seine Aussagen sind insgesamt logisch aufgebaut und anhand der genannten Beispiele und Zitate nachvollziehbar. Die meisten seiner Aussagen können durch einige, teils von ihm bereits genannten, Texte Kafkas belegt werden. Jedoch lassen sich auch, wie Karlheinz Fingerhut am Ende seines Textes selbst bemerkt, ebenso gut genügend Gegenbeispiele unter Kafkas Texten finden, die sein Deutungsschema in Frage stellen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Erzählen als Form der Konfliktbewältigung“ von Karlheinz Fingerhut untersucht die Rolle des autobiographischen Schreibens in Kafkas Werk und die daraus entstehenden Interpretationsprobleme. Der Autor beleuchtet, wie Kafkas Schreibprozess mit seinen persönlichen Konflikten und Erfahrungen verbunden war und wie diese autobiographischen Elemente die Deutung seiner Werke beeinflussen.
- Die Beziehung zwischen Kafkas Schreibprozess und seinen persönlichen Konflikten.
- Die Ambivalenz der Interpretation von Kafkas Texten im Hinblick auf das Autobiographische.
- Die Analyse von Kafkas Erzählmodellen und deren Verbindung zur Selbstreflexion.
- Die Rolle der Traumarbeit und der „irrational-intuitiven Komponente“ im Schreibprozess Kafkas.
- Die Frage nach der Übertragbarkeit autobiographischer Elemente auf die Deutung der literarischen Werke Kafkas.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die aktuelle Kafka-Forschung und stellt die These auf, dass Kafkas Schreiben stark von seinen persönlichen Erfahrungen geprägt war. Im ersten Hauptteil werden zwei gegensätzliche Ansätze zur Interpretation von Kafkas Texten vorgestellt: Einerseits die Sichtweise des Schreibens als Form der Selbstreflexion und Konfliktbewältigung, andererseits die Sichtweise des Schreibens als schwer kontrollierbare Inspiration.
Im zweiten Teil des Textes wird Kafkas Aussage, dass Schreiben ein „Zwiegespräch“ mit sich selbst sei, als Erklärung für die Kongruenz zwischen den Perspektivfiguren und Kafkas Selbstbild analysiert. Diese Kongruenz äußert sich auch in der Namensgebung der Figuren, die oft Parallelen zu Kafkas eigenem Namen aufweisen.
Im dritten Teil des Textes stellt der Autor einige kritische Fragen zur Gültigkeit seiner eigenen Deutungsschema und regt den Leser zum Nachdenken über die komplexen Aspekte des Schreibens und der Interpretation von Kafkas Werk an.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Aspekten des Werkes von Franz Kafka, insbesondere mit der Frage nach der Verbindung zwischen autobiographischem Schreiben und literarischer Gestaltung. Hierbei stehen die Begriffe Selbstreflexion, Konfliktbewältigung, Traumarbeit, Interpretation, Erzählmodelle und die Rolle der „irrational-intuitiven Komponente“ im Fokus. Darüber hinaus werden wichtige Werke wie „Das Urteil“ und „Die Verwandlung“ herangezogen, um die theoretischen Ausführungen zu exemplifizieren.
Häufig gestellte Fragen
Ist Kafkas Werk rein autobiographisch zu verstehen?
Die Analyse untersucht Karlheinz Fingerhuts These, dass Kafkas Schreiben besonders in der Durchbruchsphase extrem autobiographisch war und als Form der Kommunikation eigener Probleme diente.
Was bedeutet "Erzählen als Form der Konfliktbewältigung"?
Schreiben wird hier als "ästhetisch verfremdetes Probehandeln" gesehen, bei dem Kafka biographische Konflikte literarisch durchspielt, um sie zu reflektieren oder zu bewältigen.
Wie hängen Traum und Schreiben bei Kafka zusammen?
Die Arbeit beleuchtet die Affinität von Kafkas Erzählzügen zur "Traumarbeit" und die Rolle irrationaler, intuitiver Inspiration während des Schreibprozesses.
Was kritisiert Fingerhut an rein rationalen Deutungen?
Er warnt davor, Begriffe wie "Selbstreflexion" oder "Erzählmodell" nur als rationales Experimentieren zu sehen, da sie bei Kafka eine starke unbewusste und autoaggressive Komponente haben.
Warum sind viele Texte von Kafka Fragmente geblieben?
Ein Grund könnte laut Fingerhut darin liegen, dass die verfremdeten Situationen im Schreibprozess Abwehrreflexe auslösten, die den Autor unzufrieden mit den Schlussteilen zurückließen.
- Quote paper
- Hannah-Kristin Elenschneider (Author), 2003, Analyse des Textes "Erzählen als Form der Konfliktbewältigung" von Karlheinz Fingerhut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208661