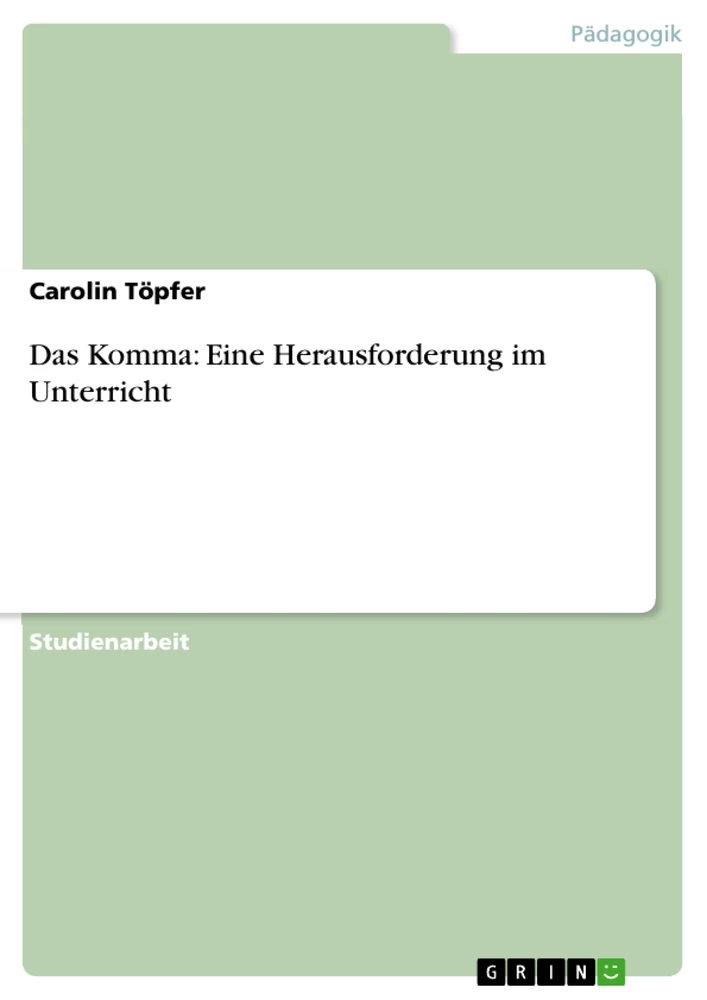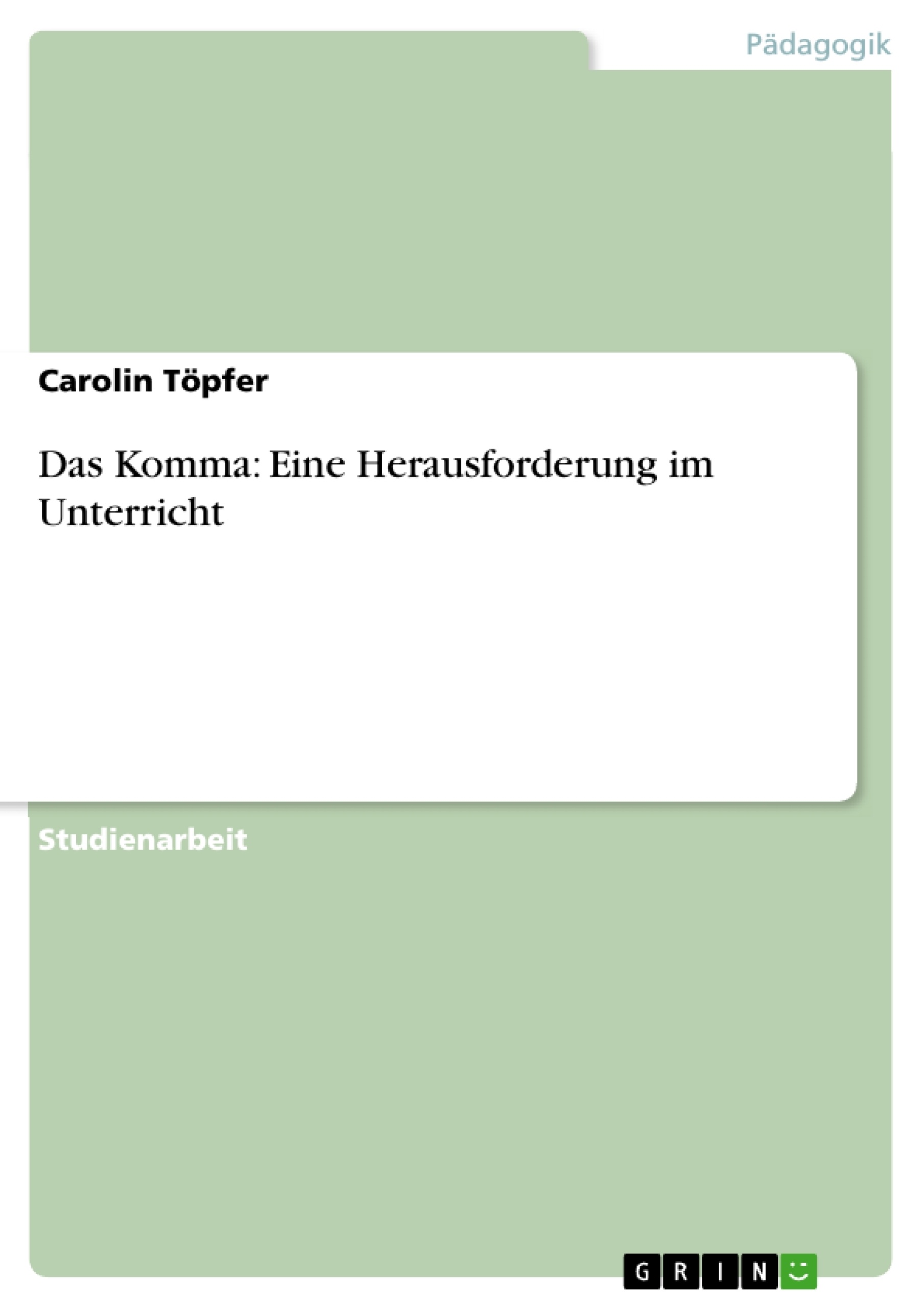„Kommas setze ich nach Gefühl.“ – so oder so ähnlich könnte die Einschätzung eines Schülers bezüglich der Wichtigkeit der Kommas im Unterricht lauten. Und genau an diesem Punkt manifestiert sich die Herausforderung der Kommasetzung im schulischen Rahmen.
Es handelt sich hierbei um eine Problematik, die von mindestens drei Standpunkten aus betrachtet und erörtert werden kann. Zum einen muss auf den sprachwissenschaftlichen Hintergrund verwiesen werden. Zwar erscheinen die einzelnen Regeln in den entsprechenden Paragraphen des Amtlichen Regelwerks eindeutig formuliert, doch lassen sich hier auf den zweiten und auch dritten Blick einige Besonderheiten ausmachen, die vom Schreiber höchste Aufmerksamkeit verlangen. Nachvollziehbar ist es also, wenn ein noch lernender Schreiber, mit den einzelnen Kommaregeln seine Schwierigkeiten hat. Die Perspektive der Lernenden ist dementsprechend die zweite zu betrachtende. Für eine angemessene und realitätsorientierte Argumentation muss der Gedanke des „gefühlten Kommas“ miteinbezogen werden. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht lohnt es sich in diesem Zusammenhang einen Vergleich zwischen inneren und tatsächlichen orthografischen Kommaregeln zu wagen und sich in einem zweiten Schritt der Theorie der unbewussten Informationsverarbeitung zu widmen. In einem didaktischen Rahmen wie diesem bildet die Lehrperson naturgemäß den dritten zu erörternden Standpunkt. Sie ist es schließlich, die dabei hilft, mögliche innere Regeln der Schüler zu strukturieren, zu erweiterten und zu verfeinern, ohne dabei Verwirrung und Verunsicherung zu stiften. Da Lehrbücher häufig ein Fundament bilden, auf welchem ein Lehrer seine Unterrichtsideen entstehen lässt, ist es hilfreich, diese kritisch zu bewerten. In diesem Zusammenhang wird sich ein Für und Wider aufzeigen lassen, über das aber letztlich nur die entsprechende Lehrperson selbst entscheiden kann.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Komplexität der Kommasetzung im Allgemeinen aufzuzeigen und im Speziellen den didaktischen Blick für dieses Thema zu schärfen, um im Unterricht fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Die sprachwissenschaftliche Seite des Kommas
3) Eine Herausforderung im Unterricht
3.1) Kognitive Herausforderung für Lernende
3.1.1) Ein Algorithmus für die Kommasetzung
3.1.2) Wie man Kommas unbewusst setzt
3.1.3) Zwischenfazit
3.2) Didaktische Herausforderung für Lehrende
3.2.1) Das Für und Wider der Lehrbücher
3.3) Zwischenfazit
4) Fazit
Literaturverzeichnis
1) Einleitung
„Kommas setze ich nach Gefühl.“ – so oder so ähnlich könnte die Einschätzung eines Schülers bezüglich der Wichtigkeit der Kommas im Unterricht lauten. Und genau an diesem Punkt manifestiert sich die Herausforderung der Kommasetzung im schulischen Rahmen.
Es handelt sich hierbei um eine Problematik, die von mindestens drei Standpunkten aus betrachtet und erörtert werden kann. Zum einen muss auf den sprachwissenschaftlichen Hintergrund verwiesen werden. Zwar erscheinen die einzelnen Regeln in den entsprechenden Paragraphen des Amtlichen Regelwerks eindeutig formuliert, doch lassen sich hier auf den zweiten und auch dritten Blick einige Besonderheiten ausmachen, die vom Schreiber höchste Aufmerksamkeit verlangen. Nachvollziehbar ist es also, wenn ein noch lernender Schreiber, mit den einzelnen Kommaregeln seine Schwierigkeiten hat. Die Perspektive der Lernenden ist dementsprechend die zweite zu betrachtende. Für eine angemessene und realitätsorientierte Argumentation muss der Gedanke des „gefühlten Kommas“ miteinbezogen werden. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht lohnt es sich in diesem Zusammenhang einen Vergleich zwischen inneren und tatsächlichen orthografischen Kommaregeln zu wagen und sich in einem zweiten Schritt der Theorie der unbewussten Informationsverarbeitung zu widmen. In einem didaktischen Rahmen wie diesem bildet die Lehrperson naturgemäß den dritten zu erörternden Standpunkt. Sie ist es schließlich, die dabei hilft, mögliche innere Regeln der Schüler zu strukturieren, zu erweiterten und zu verfeinern, ohne dabei Verwirrung und Verunsicherung zu stiften. Da Lehrbücher häufig ein Fundament bilden, auf welchem ein Lehrer seine Unterrichtsideen entstehen lässt, ist es hilfreich, diese kritisch zu bewerten. In diesem Zusammenhang wird sich ein Für und Wider aufzeigen lassen, über das aber letztlich nur die entsprechende Lehrperson selbst entscheiden kann.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Komplexität der Kommasetzung im Allgemeinen aufzuzeigen und im Speziellen den didaktischen Blick für dieses Thema zu schärfen, um im Unterricht fundierte Entscheidungen treffen zu können.
2) Die sprachwissenschaftliche Seite des Kommas
Zur Gliederung eines Ganzsatzes existieren neben den Klammern und dem Doppelpunkt drei weitere grammatische Grenzzeichen. Es handelt sich dabei um das Semikolon, den Gedankenstrich und eben das Komma. Folgende Beispiele verdeutlichen die Unterschiede zwischen diesen Satzzeichen[1].
1) Im Hausflur war es still; ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel.
2) Im Hausflur war es still – ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel.
3) Im Hausflur war es still, ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel.
Das Semikolon ist zwar ein schwächeres Trennmerkmal als der Punkt, aber innerhalb eines Satzes das stärkste und deutlichste Gliederungsmittel. Der Gedankenstrich ist, im Gegensatz zum Semikolon, ein eindeutig intonatives Satzzeichen[2]. Er steht zur Bezeichnung einer längeren Pause, wenn es sich um Nachträge oder besonders hervorgehobene Einschübe handelt. Der Gedankenstrich steht außerdem für den schlussfolgernden Doppelpunkt. Das Komma schließlich gilt das häufigste, wenngleich auch schwierigste Zeichen innerhalb eines Satzes. Grundsätzlich wird alles, was den intonatives Fluss des Sprechens unterbricht in erster Linie durch Kommata abgetrennt[3], welche sowohl einfach als auch paarig gebraucht werden können (siehe folgende Beispiele[4] ).
4) Er trug einen schwarzen, breitkrempigen Hut.
5) Seine Kopfbedeckung, ein schwarzer und breitkrempiger Hut, lag auf dem Tisch.
Die einzelnen, im Regelwerk vorgegebenen Regeln zur Kommasetzung selbst wirken auf den ersten Blick auch nicht übermäßig kompliziert. Erst nach einer dezidierteren Analyse sind eventuelle Schwierigkeiten auszumachen. So ist auch die Regel zur Kommasetzung bei Reihungen deutlich und klar formuliert.
Gleichrangige (nebengeordnete) Teilsätze, Wortgruppen grenzt man mit Komma voneinander ab [5].
Für das Anwenden dieser Regel muss dem Schreiber allerdings klar sein, dass nur gereiht werden kann, wenn auch sog. Gleichrangigkeit vorliegt, es sich also um eine Gleichwertigkeit im Satzgliedstatus handelt[6]. Lernende kann es außerdem verwirren, wenn es in der Regel heißt, dass gleichrangige Wörter mit Komma voneinander abgetrennt werden sollen. Die folgenden zwei Beispiele illustrieren allerdings, dass dies nicht immer der Fall sein kann und muss.
6) Die neue blaue Bluse gefällt mir.
7) Die neue, blaue Bluse gefällt mir.
In Beispiel 6 ist kein Komma zu setzen, weil es in diesem Fall um eine die blaue Bluse geht, die neu ist. Ein Komma zu setzen ist hingegen in Beispiel 7. Hier gefällt eine Bluse, die sowohl neu als auch blau ist. In diesem Fall werden zwei Attribute gereiht, es handelt sich also –wie in der Regel gefordert- um einen gleichen Satzgliedstatus[7]. Den Lernenden muss des Weiteren bewusst sein, dass ein Komma bei einer Reihung von Hauptsätzen auch durch einen Punkt ersetzt werden könnte. Außerdem konkurriert ein reihendes Komma bisweilen mit einer anreihenden Konjunktion. Falls es sich nicht um eine adversative Konjunktion (aber, sondern, nicht nur …, sondern auch) kann entweder ein Komma oder eben eine Konjunktion stehen. In diesem Fall richtet sich die Entscheidung nach dem ästhetischen Empfinden des Schreibers. In besonderen Fällen können ein Komma und ein reihendes und nebeneinanderstehen.
8)Ich fotografiere die Berge, und meine Frau lag in der Sonne.
In diesem Fall wird ein Komma gesetzt, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden[8]. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Komma bei Reihungen verbindet und Gleichrangiges für den Leser erkennbar macht.
Tritt ein Komma bei Zusätzen und Nachträgen auf, so hat es einen abrennenden Charakter. Ein in diesem Zusammenhang paarig auftretendes Komma markiert einen unterbrochenen Satzfluss[9].
Zusätze oder Nachträge grenzt man mit Komma ab; sind sie eingeschoben, so schließt man sie mit paarigem Komma ein [10] .
Dies betrifft Parenthesen, Substantivgruppen als Nachträge (Appositionen), Ort-, Wohnungs-, Zeit und Literaturangaben ohne Präposition, Erläuterungen, angekündigte Wörter oder Wortgruppen, Infinitivgruppen und Partizip- oder Adjektivgruppen. Besonders an diesen Konstruktionen ist die Tatsache, dass der Satz an sich auch vollständig ist, selbst wenn der durch das paarige Komma markierte Einschub weggelassen wird. In diesem Zusammenhang stellen insbesondere folgende Beispiele durchaus eine Herausforderung dar.
9) Der junge Goethe war, wie gesagt, unbekümmert und klug.
10) Ich komme, wenn nötig, bei dir vorbei.
Dadurch, dass es sich im Beispiel 9 um einen formelhaften Nebensatz handelt, ist es das Komma nicht zwangsläufig zu setzen. Auch im Beispiel 10 ist das Komma fakultativ, Es liegt in beiden Fällen im Ermessen des Schreibenden, ob er das Zeichen setzt oder nicht[11]. Diese Vorgaben des Regelwerkes sind durchaus als diskussionswürdig zu bezeichnen. Bezogen auf Beispiel 9 kann bezweifelt werden, ob es sich tatsächlich um einen formelhaften Nebensatz handelt, da eben durch jenen Einschub eine Bedingung zum Ausdruck gebracht wird. Formuliert man dieses Beispiel aus, so hieße es: Ich komme, wenn es nötig ist, bei dir vorbei. In diesem Fall müsste der Schreiber das Komma setzen[12]. Das folgende Beispiel verdeutlicht einen anderen Fall, bei dem die Kommasetzung ebenso diskutiert werden kann.
11) Trotz aller guten Vorsätze hatte sie wieder zu rauchen angefangen
Da die entsprechende durch eine Präposition eingeleitet wird, steht gemeinhin kein Komma. Falls sich der Schreiber dennoch entschließt das Komma zu setzen, dann aus rein rhetorischen Gründen und um an dieser Stelle eine Lesepause zu markieren. Generell kann das paarige Komma bei Einschüben (und bisweilen auch bei Nachträgen) als ein herauslösendes verstanden werden und zeichnet sich vor allem durch seine rhetorischen Funktionen aus[13]. Allein durch diese Beispiele kann verdeutlicht werden, wie komplex und dicht strukturiert das Regelwerk bezüglich der Kommasetzung ist – insbesondere, wenn der Bereich der Varianz hinzugezogen werden muss. Für Lernende ist es daher schwierig, vorgestellte Regeln zu verstehen und zeitnah zu verinnerlichen und anzuwenden (siehe dazu Kapitele 3.1).
Auch ist es für Schreibende bisweilen nicht einfach, den Unterschied zwischen den bereits angeführten Einschüben und adverbialen Bestimmungen zu erkennen. Beide sind aus syntaktischer Sicht fakultativer Natur. Adverbiale Bestimmungen werden aber in einigen Fällen durch ein Komma hervorgehoben wie die folgenden Beispiele verdeutlichen[14].
[...]
[1] Die Beispiele sind dem Amtlichen Regelwerk entnommen: vgl. http://www.ids-mannheim.de/service/reform/ (14.03.2011)
[2] Eichler, W. et. al. (1996):296.
[3] Ebd. 294.
[4] Die Beispiele sind dem Amtlichen Regelwerk entnommen: vgl. http://www.ids-mannheim.de/service/reform/ (14.03..2011)
[5] Amtliches Regelwerk § 71.
[6] Ossner, J. (2010): 222.
[7] Ebd. S. 222.
[8] Ebd. S. 223.
[9] Lindauer, Th. et. al. (2008): 192.
[10] Amtliches Regelwerk §77.
[11] Vgl.: Amtliches Regelwerk § 76 und §78.
[12] Ossner, J. (2010): 224.
[13] Ebd. 225.
[14] Ossner, J. (2010): 225.
- Arbeit zitieren
- Carolin Töpfer (Autor:in), 2011, Das Komma: Eine Herausforderung im Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208812