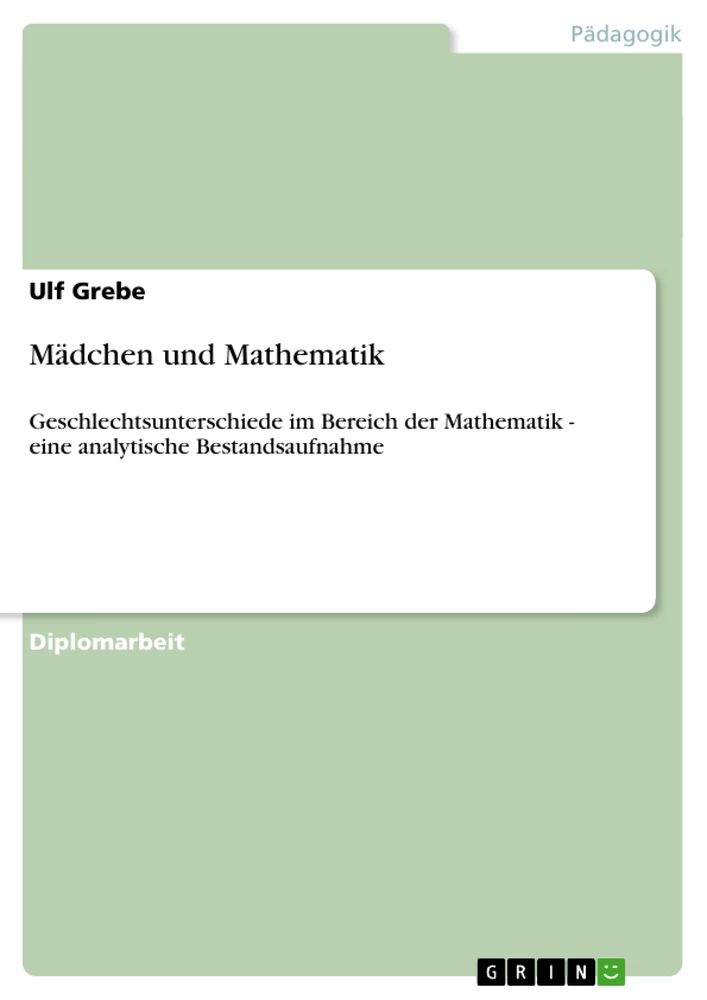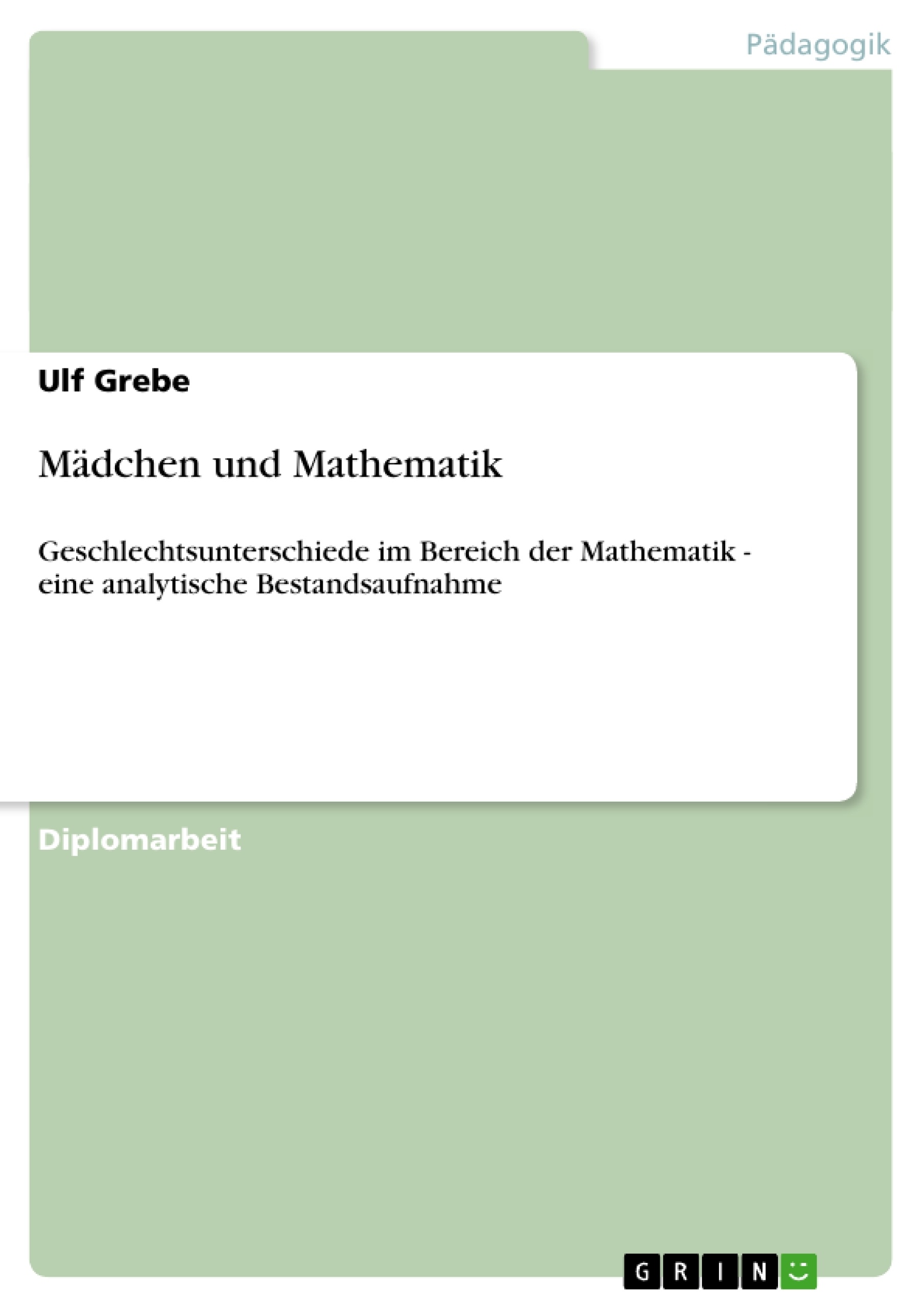Haben Mädchen mehr Mühe mit Mathematik?
Vieles scheint dafür zu sprechen: Mädchen erzielen in mathematischen Leistungstests durchschnittliche schwächere Ergebnisse als Jungen. Im Jugendalter belegen sie seltener mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. Als Erwachsene entscheiden sie sich noch seltener für ein entsprechendes Studium und werden besonders selten Mathematikprofessorinnen. Große Namen der Mathematikgeschichte sind fast ausnahmslos die von Männern.
Doch viele Studien nähren auch Zweifel. Demnach gibt es andere wichtige Faktoren als das (biologische) Geschlecht, die sich auf Interesse, Motivation und Leistung von Jungen und Mädchen unterschiedlich auswirken. Erscheint die Beschäftigung mit Mathematik aus weiblicher Sicht etwa weniger lohnend als aus männlicher Perspektive?
Von den Antworten hängt nicht weniger ab als die Qualität von Erziehung und Lehre, die den Auftrag haben, jedem Kind und Jugendlichen, gleich welchen Geschlechts, gerecht zu werden. Deshalb sichtet diese Arbeit nicht nur die Ergebnisse der Geschlechterforschung und wertet sie im Hinblick auf das Feld des Mathematischen aus, sondern will letzten Endes Erkenntnisse befördern, die Mädchen ähnlich gerne und erfolgreich Mathematik lernen lassen wie Jungen.
Inhalt
Danksagung
Vorwort
Einleitung
I. Geschlechtsunterschiede in Mathematik
I.1 Die Ungleichheit der Geschlechter in Bezug auf Mathematik
I.2 Die Problematik von Geschlechtsunterschieden in Mathematik
I.3 Geschlecht als Gegenstand der Forschung
I.3.1 „Sex“ und „Gender“
I.3.2 Anlage oder Umwelt?
I.3.3 Ideologie und Wissenschaft
I.3.4 „Sex Bias“
I.4 Die Erforschung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik
I.4.1 Geschlechtsunterschiede und Wissenschaftstheorie
I.4.2 Was sind Geschlechtsunterschiede in Mathematik?
I.4.3 Forschungsmethoden
I.4.4 Die Beschreibung von Forschungsbefunden
I.4.5 Die Interpretation von Forschungsergebnissen
I.5 Was wird in dieser Arbeit untersucht?
II. Geschlechtsunterschiede in der Mathematikleistung
II.1. Mathematisches Leistungsniveau
II.1.1 Hochbegabung
II.1.2 Lernschwierigkeiten und Rechenschwäche
II.1.3 Kritische Einwände und Diskussion
II.1.4 Zusammenfassung
II.2 Alters- und Entwicklungsabhängigkeit
II.3 Partielle Stärken und Schwächen
II.4 Leistungstests und Schulnoten
II.5 Internationaler Vergleich
II.6 Zusammenfassung und Diskussion
III. Geschlechtsunterschiede in kognitiven Voraussetzungen
III.1 Intelligenz
III.2 Verbale Fähigkeiten
III.3 Räumlich-visuelle Fähigkeiten
III.4 Quantitative Fähigkeiten
III.5 Sonstige kognitive Faktoren
III.6 Mathematik und Begabung
III.7 Zusammenfassung
IV. Geschlechtsunterschiede in Persönlichkeitsvariablen
IV.1 Allgemeine Persönlichkeitsunterschiede
IV.2 Einstellungen und Interesse
IV.3 Selbstvertrauen, Fähigkeitsselbstkonzept und Motivation
IV.3.1 Selbstvertrauen
IV.3.2 Fähigkeitsselbstkonzept
IV.3.3 Motivation
IV.3.4 Zusammenfassung
IV.4 Geschlechterstereotype und Geschlechtsrollenidentität
IV.4.1 Geschlechterstereotype
IV.4.2 Geschlechtsrollenidentität
IV.4.3 Befunde
IV.4.4 Zusammenfassung und Diskussion
IV.5 Zusammenfassung Persönlichkeitsunterschiede
V. Zusammenfassung und Diskussion
V.1 Übersicht über die angeführten Befunde
V.2 Zusammenfassung der gefundenen Geschlechtsunterschiede
V.3 Der Einfluss von kognitiven Voraussetzungen und Persönlichkeitsvariablen auf die Mathematikleistung
V.4 Bedeutung und Konsequenzen aus pädagogischer Sicht
V.5 Offene Fragen und Ausblick
Anhang
Quellenverzeichnis
Danksagung
Mein Dank gilt allen, die dieser Arbeit ein Stück des Weges bereitet haben – sei es durch warme Worte oder warme Mahlzeiten, durch Tipps oder Ideen, durch „dumme Fragen“ (die meistens klüger sind als es dem „Experten“ lieb ist), durch Literaturhinweise, Kopiergelegenheit, Unterschrift zur rechten Zeit am rechten Platz, Kritik und Hinterntritt und noch manchen anderen Beitrag: Cilia Belkius, Gerd Bringmann, Kolleginnen und Kollegen vom LZR, Freundinnen und Freunde. Erfreulich war auch die Erfahrung, wie selbstverständlich sich einige echte Expertinnen und Experten bereit fanden, mir bei meinen Anfangsfragen weiter zu helfen: Karl-Josef Klauer, Oliver Thiel, Siegbert Schmidt, Marianne Nolte, Bettina Hannover, Ursula Kessels, Simon Baron-Cohen, Eckhard Klieme. Ein besonders dicker Dank geht an Judith Hanl und an meine Eltern Klaus und Heide Grebe fürs Korrekturlesen und Hilfe bei anderen Abschlussarbeiten. Außerdem danke ich Herrn Professor Wolf-Rüdiger Minsel, dass er das Thema akzeptierte, für seine Unterstützung in Fragen der zeitlichen Gestaltung und – vorauseilender Dank – für seine Bereitschaft, es mit dieser besonders „fetten“ Diplomarbeit aufzunehmen.
Ulf Grebe, 26. Februar 2004
Vorwort
„Also, o Freund, gibt es gar kein Geschäft von allen, durch die der Staat besteht, welches dem Weib oder dem Manne als Mann angehörte, sondern die natürlichen Anlagen sind auf ähnliche Weise in beiden verteilt, und an allen Geschäften kann das Weib teilnehmen ihrer Natur nach, wie der Mann an allen; in allen aber ist das Weib schwächer als der Mann.“ (Platon 1965: 177)
Wer eine Diplomarbeit über Geschlechtsunterschiede schreiben will, braucht das Rad nicht neu zu erfinden. Im Gegenteil. Von Adam und Eva über Platon (s.o.) bis zum heutigen Tag reicht die Geschichte des Nachdenkens über Mann und Frau – über ihr Wesen, ihre Gemeinsamkeiten, ihre Verschiedenheit. Selbst wenn man sich nur einen Ausschnitt vornimmt - „Geschlechtsunterschiede im Bereich der Mathematik“ - ist ein Geschlechterthema immer noch ein großes Thema. Literatur gibt es zuhauf, und von allen Seiten drängen sich interessante, faszinierende oder sogar weltbewegende Fragen auf: Warum sind alle berühmten Mathematiker Männer? Was hat Mathematik mit Macht zu tun? Was mit Autismus? Warum denkt man an die „Mathe-Asse“ der Schulzeit oft als bleiche, Brille tragende, hoffnungslos unsportliche Jungen?
Man kann sich leicht ausrechnen, dass die Antworten auf solche Fragen nicht leicht zu haben sind. Ein Thema wie „Geschlechtsunterschiede in Mathematik“ zu bearbeiten, ist deshalb nicht einfach. Und auch nicht ungefährlich. Schnell verliert man sich im allzu Grundsätzlichen, in Fragen voller Bedeutung, auf die sich keine befriedigende Antwort finden lässt. Oder man sucht der gefühlten Komplexität Herr zu werden durch einen Aufbau, der beinahe noch komplexer ist und bald schon einer Doktorarbeit würdig wäre. Es kann sich auch ein Gefühl der Minderwertigkeit einschleichen angesichts einer nur 100 Titel umfassenden Literaturliste - oder des Größenwahns, weil man sich einem Weltgeheimnis auf der Spur wähnt. Es kann aber auch passieren, dass nicht sein kann, was nicht sein darf („Biologische Erklärungen sind Humbug, Frauen sind nur unterdrückt !“) und man(n) unterschätzt hat, wie schwer es ist, in Geschlechterangelegenheiten neutral zu bleiben...
Wenn alles gut geht, stellt sich gegen Ende des Schreibens dann doch noch eine Art altersweiser Gelassenheit ein („Warum sollte ich die ganze Arbeit machen, die Generationen zuvor liegen gelassen haben...“), und der Diplomkandidat bescheidet sich mit dem Sichten und Zusammenfassen kleinerer und größerer Studien, sich freuend über jeden noch so zarten Funken Erkenntnis, der überspringt, nachdem Geist und Gemüt zwischenzeitlich schon wie umnachtet danieder lagen.
Auch wenn es auf ersten Blick erstaunen mag: Eine solche Wende zum „Kleinen“, Bescheidenen wurde auch mit dieser Arbeit vollzogen. Kapitel wurden nicht geschrieben, obwohl fest eingeplant. Manche Frage wurde trotz Wichtigkeit übergangen, Theorien blieben unerwähnt, viele interessante Befunde ebenso. Dass dennoch beinahe ein „Wälzer“ dabei herauskam, ist dem Skrupel des Verfassers geschuldet, ein Thema durch Vereinfachung zu verzerren, das er erst nach monatelanger Beschäftigung wirklich überschauen konnte. Deshalb wurde, wenn „Kürze“ gegen „Vollständigkeit“ abgewogen werden musste, letzterer fast immer der Vorzug gegeben. Der Preis buchstäblicher „Vielseitigkeit“ und gelegentlicher Wiederholungen wurde dafür billigend in Kauf genommen.
Was hier jetzt vorliegt, ist der Versuch eines Vergleichs der mathematischen Möglichkeiten von Mädchen und Jungen bzw. Männern und Frauen, der sowohl dem Stand der Forschung als auch dem Wissensstand von Leserin und Leser gerecht wird. Wer die Arbeit kennt, dürfte sich in der komplexen und keineswegs ideologiefreien Debatte über Geschlechtsunterschiede zurecht finden. Er oder sie sollte vorschnelle Urteile über die Mehr- oder Minderbegabung von Jungen bzw. Mädchen besser erkennen (und hinterfragen) können. Allemal sollte ein Verständnis dafür geweckt worden sein, warum Geschlechtsunterschiede in Mathematik ein wichtiges Thema sind.
Was man dagegen in dieser Arbeit vergeblich suchen wird, sind Antworten auf die „großen Fragen“. Warum zum Beispiel Adam Riese und Albert Einstein keine Frauen waren: obwohl ich es mir heimlich erhofft hatte, weiß ich es immer noch nicht. Hätten eine Eva Riese oder Berta Einstein überhaupt Mathematikerinnen werden können? Interessante Frage. Ich übergebe an nachfolgende Forscherinnen und Forscher.
Einleitung
Haben Mädchen mehr Mühe mit Mathematik?
In einem lerntherapeutischen Institut zur Behandlung von Rechenschwäche in Köln sind die angemeldeten Kinder zu zwei Dritteln Mädchen. In einer Fördergruppe für mathematisch hochbegabte Grundschulkinder an der Kölner Universität sind vier Fünftel der gemeldeten Kinder Jungen. Zufall? Nein. Ähnliche Verhältnisse finden sich auch in anderen Städten. Mehr Mädchen als Jungen werden als rechenschwach erfasst. Weniger Mädchen als Jungen gelten als besonders begabt. Warum ist das so? Fällt Mädchen mathematisches Denken allgemein schwerer oder werden sie im Unterricht benachteiligt? Werden sie leichter für rechenschwach gehalten oder sind sie es tatsächlich öfter als Jungen? Gibt es möglicherweise grundlegende Unterschiede in der mathematischen Begabung von Jungen und Mädchen?
Einiges scheint dafür zu sprechen: Mädchen erzielen im Durchschnitt in mathematischen Leistungstests schwächere Ergebnisse als Jungen. Im Jugendalter wählen sie Mathe häufiger ab und belegen seltener mathematisch-naturwissenschaftliche Leistungskurse. Als Erwachsene entscheiden sie sich seltener als ihre Altersgenossen für ein mathematisch-naturwissenschaftliches Studium, promovieren noch seltener und werden äußerst selten Mathematikprofessorinnen. Große Namen der Mathematikgeschichte sind fast ausnahmslos die von Männern, und bis heute hat nie eine Frau die höchste Auszeichnung für Mathematiker, die Fields-Medaille, erhalten.
Doch auch Zweifel sind angebracht: Eindeutig zeigen sich Geschlechtsunterschiede erst ab dem Jugendalter; vorher liegen Mädchen in ihren Mathematikleistungen mit den Jungen meistens gleichauf, in manchen Bereichen sind sie besser. Überwiegend bekommen sie in der Grundschule die besseren Noten, auch in Mathematik. Meta-Studien aus den USA belegen, dass dort im Verlaufe von drei Jahrzehnten geschlechtsabhängige Leistungsunterschiede immer mehr abgenommen haben. Nach Erkenntnissen der Sozialpsychologie wird das Lern- und Leistungsverhalten von Jungen und Mädchen von stereotypen Rollenerwartungen beeinflusst, die teilweise eine Beschäftigung mit Mathematik aus weiblicher Sicht weit weniger lohnend erscheinen lassen als aus männlicher. Dies sind gute Gründe anzunehmen, dass es andere als nur anlagebedingte Gründe für Geschlechtsunterschiede in Mathematik gibt.
Das Bild ist also alles andere als eindeutig. Haben Mädchen mehr Schwierigkeiten mit Mathematik als Jungen? Sind ihre Leistungen durchschnittlich schlechter? Was spricht dafür, was dagegen? In welchen Bereichen werden die Unterschiede festgestellt? Wie verallgemeinerbar sind diese Befunde?
Von den Antworten hängt viel ab: Wenn Mädchen nicht grundsätzlich weniger begabt in Mathematik sind als Jungen, aber dennoch mehr Schwierigkeiten damit haben, dann bleiben sie folglich oft unter ihren Möglichkeiten. Dann sind ihre Schulabschlüsse wahrscheinlich nicht angemessen, ihre beruflichen Aussichten unnötig schlecht. Auf den Beitrag von Frauen in der und durch die Mathematik (Wie würde der aussehen? Was ist der Gesellschaft da bisher entgangen?) würde ohne Not verzichtet. Die Lehr-Lern-Bedingungen in Mathematik müssten hinterfragt werden, aber auch der gesellschaftliche Umgang mit diesem Fach gehörte auf den Prüfstand.
Wenn es aber zutrifft, dass der Angleichung von Mädchen und Jungen in bestimmten Bereichen des Lernens tatsächlich Grenzen gesetzt sind – sei es, weil ihre Begabungen nicht gleich verteilt sind, oder weil sie sich in ihrem Lernstil grundlegend voneinander unterschieden, dann spräche das für eine Stärkung der geschlechtsspezifischen Elemente von Erziehung.
Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, die Widersprüche aufzuklären. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
1. Gibt es signifikante geschlechtsabhängige Unterschiede in der mathematischen Leistungsfähigkeit, wie groß sind diese und in welchen Bereichen zeigen sie sich?
2. Gibt es signifikante Unterschiede in den kognitiven und sonstigen Voraussetzungen der Geschlechter, die einen unterschiedlichen Leistungsstand in Mathematik bedingen, wie groß sind sie und in welchen Bereichen zeigen sie sich?
3. Welchen Einfluss haben Geschlechtsunterschiede in kognitiven und sonstigen Voraussetzungen auf die Geschlechtsunterschiede in der Mathematikleistung?
4. Welche Bedeutung haben Geschlechtsunterschiede in Mathematik für die Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und wie sollte mit ihnen umgegangen werden?
Ziel der Arbeit ist es, eine Frage zu beantworten, die dem Verfasser in seiner lerntherapeutischen Arbeit mit rechenschwachen Kindern begegnete: Warum haben Mädchen soviel häufiger diese Probleme? Was macht den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Mathematik aus, der hier (wie in vielen anderen Bereichen) zu beobachten ist?
Zu Geschlechtsunterschieden im Allgemeinen sowie insbesondere zu Geschlechtsunterschieden in Mathematik gibt es eine große Fülle von Forschungsliteratur. Diese zu sichten und im Hinblick auf die genannten Fragen zu analysieren, verspricht grundsätzlichere Einsichten als eine eigene kleine empirische Untersuchung. Deshalb wurde der Weg einer Literaturarbeit eingeschlagen.
Die Arbeit hat fünf Hauptkapitel (I – V). Kapitel I führt in zentrale Fragen der Erforschung von Geschlechtsunterschieden allgemein sowie von „mathematischen“ Geschlechtsunterschieden ein. Anschließend wird die Befundlage zu Geschlechtsunterschieden in der Mathematikleistung erörtert (Kapitel II). Die nachfolgenden Kapitel stellen Erkenntnisse aus Bereichen dar, in denen die Bedingungen für Geschlechtsunterschiede in der Mathematikleistung vermutet und erforscht werden: Kognitionsforschung (Kap. III) und Persönlichkeitspsychologie (Kap. IV). Kapitel V schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und ihrer Diskussion im Hinblick auf pädagogische Ziele ab.
Als Hilfe beim „Überfliegen“ ist den meisten Unterkapiteln von Kapitel II bis IV eine kurze Inhaltsangabe vorangestellt. Am Ende besonders umfangreicher Unterkapitel sowie am Ende eines Hauptkapitels findet sich jeweils eine Zusammenfassung. Kapitel V ermöglicht einen raschen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit. Die Lektüre von Kapitel I wird zum Einstieg empfohlen, wenn geringe oder keine Vorkenntnisse vorhanden sind. Leserinnen und Leser, die eigenes Quellenstudium betreiben wollen, finden im Anhang eine kommentierte Literaturliste.
I. Geschlechtsunterschiede in Mathematik
Ausbildungs- und Berufsangebote im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich werden von jungen Frauen und jungen Männern unterschiedlich stark wahrgenommen. Dies kann als problematisch im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz in einer demokratischen Gesellschaft betrachtet werden. Unter anderem deshalb ist die Aufklärung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik ein dringendes Anliegen an die Wissenschaft.
Die Erforschung von Geschlechtsunterschieden wird durch Ideologieanfälligkeit, hohe Strittigkeit von Theorien und andere charakteristische Probleme erschwert. Auch die Bedeutung von Untersuchungsbefunden für den Alltag ist oft nicht leicht zu beurteilen. In diesem Kapitel werden theoretisch und methodisch zentrale Begriffe erläutert.
Geschlechtsunterschiede sind eines der umstrittensten Themen in der Psychologie der letzten Jahrzehnte. Nur wenige andere Themen erfahren ein ähnliches öffentliches Interesse und erregen so viel Widerspruch und Streit wie dieses (Halpern 1986: 1). Dies gilt auch für die Erforschung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik, einem Bereich, der auf ersten Blick uralte Geschlechterstereotype zu bestätigen scheint. Eine Aufgabe – und zugleich Hürde! – dieser Arbeit ist es deshalb, zwischen Alltagswissen und Empirie, zwischen Wissenschaftlichkeit und Ideologie sorgsam zu unterscheiden.
Dieses erste Hauptkapitel soll dafür die Voraussetzungen schaffen. Zum einen leitet es in das Thema dieser Arbeit ein, legt Untersuchungsziele fest und stellt den Aufbau der Arbeit vor. Zum anderen wird auch ein Überblick über das Forschungsgebiet gegeben, dem die später vorgelegten Befunde entstammen. Es werden sowohl zentrale Begriffe der Geschlechtsunterschiedsforschung als auch die damit verbundenen theoretischen und methodischen Probleme skizziert und erläutert.
I.1 Die Ungleichheit der Geschlechter in Bezug auf Mathematik
„Die uralte Wahrheit, dass Gefühl und Phantasie bei den Mädchen
eine ganz andere Stärke und Bedeutung haben, wird nicht dadurch widerlegt,
dass hier und da eine junge Frau mit ausgezeichnetem Erfolg Mathematik treibt.“
(Münch 1909: 174 – nach Srocke 1989: 69)
„They think you’re weird if you like maths.“
(Mathematikschülerin – nach Isaacson 1990: 20)
Junge Frauen, die gut in Mathematik waren, hat es vielleicht schon immer gegeben. Mit Sicherheit gab es sie zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, als Münch das obige Zitat verfasste und ein psychiatrischer Arzt namens Paul Möbius seine Schrift „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“ (Möbius 1901). Nur war solch „ausgezeichneter Erfolg“ von Frauen zu jener Zeit durchaus nicht selbstverständlich. Mathematik gehörte, noch weit mehr als andere Bereiche, zur männlichen Lebenswelt. Gerade erst war das Fach in den Lehrplan der höheren Mädchenschulen aufgenommen worden. Bis dahin hatten Kenntnisse in Mathematik (das einfache „Rechnen“ für den Haushalt ausgenommen) als für die Lebenstüchtigkeit einer Frau weder notwendig noch förderlich gegolten. Und immer noch ganz geläufig waren Zweifel, ob Frauen zu einem Verständnis mathematischer Probleme geistig überhaupt in der Lage seien (Srocke 1989: 12).
Seitdem hat sich einiges geändert. Nach guten Leistungen von Mädchen und Frauen in Mathematik muss nicht mehr angestrengt gesucht werden, an jeder Schule kann man sie finden. Männer und Frauen haben manche alten Rollenstereotype überwunden. Äußere Hindernisse der Gleichberechtigung sind weggefallen. Das Grundrecht auf Gleichstellung und Gleichbehandlung von Mann und Frau wurde in den Verfassungen moderner Demokratien verankert und ist in vielen Lebensbereichen zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Bildungssysteme sind verpflichtet, allen Menschen ohne Ansehen ihres Geschlechts den Erwerb von Wissen und die Entwicklung lernnotwendiger Kompetenzen zu ermöglichen (Keller 1998: 11). Es gibt so gut wie keine nach Geschlecht differenzierenden rechtlichen Beschränkungen für einen Bildungsweg mehr. Wenig scheint also dagegen zu sprechen, dass sich die Geschlechter in Bildung und Beruf weitgehend angeglichen haben.
Umso mehr müsste es verwundern, wie weit verbreitet noch immer Ansichten wie die oben geschilderten sind. Auch unter den Schülern (und Schülerinnen!) der Gegenwart gilt Mathematik als „eher männliches Fach“, das den Interessen und Fähigkeiten von Mädchen und Frauen nicht so entgegenkommt wie Sprachen, soziale oder künstlerische Fächer. Deshalb werden Schülerinnen mit einer Vorliebe für Mathematik auch immer noch als Ausnahme angesehen – erst recht, wenn sie durch gute Leistungen darin auffallen (Isaacson 1990; Schildkamp-Kündiger 1974: 29 f.).
Mehr noch: Die Bildungswege von Jungen und Mädchen bzw. von Frauen und Männern unterscheiden sich im Hinblick auf Mathematik zum Teil beträchtlich. Mädchen zeigen spätestens ab dem Jugendalter ein geringeres Interesse für Mathematik als Jungen, sie belegen seltener einen Leistungskurs und wählen Mathematik früher ab. Nach der Schule entscheiden sie sich weitaus häufiger als männliche Altersgenossen für Sprachen, soziale oder künstlerische Fächer und deutlich seltener für Mathematik, Physik und Chemie, Informatik und Ingenieurberufe (Beerman, Heller & Menacher 1992: 18; Richter 1996: 78). In Deutschland ziehen unverändert „traditionelle Frauenberufe“ wie Arzthelferin, Friseurin oder Lebensmittelfachverkäuferin die Berufsanfängerinnen an, während der Anteil weiblicher Auszubildender in „traditionellen Männerberufen“ (Installateurberufe, Kfz-Mechaniker etc.) im Schnitt unter 5 Prozent liegt. Bei den höher qualifizierten Ausbildungsberufen, z.B. im Bereich der neuen Informationstechnologien, liegt der Frauenanteil bei 11 Prozent, obwohl mehr Frauen als Männer das notwendige Ausbildungsniveau erreichen. Bei den Studienanfängern sind Frauen in der Fächergruppe Mathematik/ Naturwissenschaften mit 36 Prozent ebenfalls immer noch unterrepräsentiert, wogegen sie in anderen Fachbereichen wie Sprach- und Kulturwissenschaften, Pädagogik, Psychologie und Veterinärmedizin deutlich in der Mehrheit sind. Laut Statistischem Bundesamt hat sich an diesen Verhältnissen in den letzten fünf Jahren nichts Wesentliches geändert (alle Daten: Statistisches Bundesamt, Mai 2003).
Auch unter den Lehrkräften an Hochschulen sind Frauen mit Fachschwerpunkt Mathematik selten. Im Jahr 1988 lag der Anteil weiblicher Hochschulprofessuren in Mathematik mit 2 Prozent deutlich unter dem Fächerdurchschnitt und war eine der niedrigsten universitären Frauenquoten überhaupt (Beerman et. al. 1992: 26 f.).
Mädchen und Jungen bzw. Männer und Frauen wandeln also offensichtlich auf unterschiedlichen Pfaden, wenn es um Mathematik geht. Sie scheinen das Fach nicht gleichermaßen zu mögen. Vielleicht gehen sie aber auch nur von ungleichen Erfolgschancen in Schule und Beruf aus und treffen entsprechend pragmatische Entscheidungen. Möglicherweise haben sie auch nicht die gleichen Voraussetzungen, um in Mathematik erfolgreich zu sein.
Die Gründe hierfür sind alles andere als klar. Was Münch, Möbius und vielen ihrer Zeitgenossen noch als Selbstverständlichkeit erschien, dass Mädchen und Frauen kraft ihrer „Natur“ zu anderen Dingen bestimmt seien als durch mathematisches Können hervorzutreten, gilt längst nicht mehr als wahrscheinlichste Erklärung für die Ungleichheit der Interessen und Berufswege. Gleichwohl ist sie nie ganz aus der Diskussion verschwunden, denn sie hat offenkundige Vorzüge: Sie ist einfach, befindet sich im Einklang mit Erfahrungswerten und – nicht zuletzt - mit der Gewohnheit. In der Tat scheint es nur wenigen Menschen Sorgen zu bereiten, dass die Geschlechterverhältnisse in und um Mathematik so sind wie sie sind.
Einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung dagegen können Gewohnheit und Einfachheit als Argumente nicht standhalten, zumal sich die oben beschriebenen Geschlechtsunterschiede bei kritischer Betrachtung als problematisch und diskussionswürdig in mehrfacher Hinsicht erweisen.
I.2 Die Problematik von Geschlechtsunterschieden in Mathematik
Wenn Männer und Frauen nicht zu gleichen Anteilen Gebrauch von gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten machen, liegt der Verdacht einer gesellschaftlichen Benachteiligung nahe. Schwierigkeiten in Mathematik bzw. im Zugang zu mathematischem Wissen können für betroffene Menschen eine Einschränkung ihrer Lebenschancen bedeuten. Mathematik ist während der gesamten Schullaufbahn versetzungsrelevant. Leistungen in Mathematik werden als Indikator für allgemeine Leistungsfähigkeit und Intelligenz gewertet und stehen in einem engen Zusammenhang mit der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern (Schildkamp-Kündiger 1974). Kenntnisse in Mathematik spielen oft eine entscheidende Rolle in der Berufsqualifizierung. Und nicht zuletzt ist der Zugang zu einer erheblichen Zahl von Berufen gehobenen Status‘ und Einkommens abhängig von bestimmten fortgeschrittenen Kenntnissen in Mathematik (Sells 1980 – nach Halpern 1986: 57 f.). Gesellschaftlich betrachtet besteht also die Gefahr einer Ungleichverteilung von Bildungsgütern und, daraus resultierend, einer Ungleichverteilung von Einfluss und Status zum Nachteil von Mädchen und Frauen. Diese Nachteile drohen sich noch zu verschärfen, wenn im Zuge der technologischen Modernisierung zunehmend mathematische, naturwissenschaftliche und technische Anforderungen den Arbeitsmarkt prägen (Keller 1998: 14).
Zum Zweiten werfen die Unterschiede kein gutes Licht auf Erziehung und Ausbildung, insbesondere auf die Erziehung zur Mathematik. Schule hat nicht nur die Aufgabe, ihren Schülerinnen und Schülern zu Fähigkeiten, Wissen und Fertigkeiten zu verhelfen, sie soll auch Interesse am Lerngegenstand und positive Einstellungen befördern (Fend 1980 – nach Keller 1998: 17). Wenn dies regelmäßig in einem Fach oder bei einer Gruppe von Schülern nicht gelingt, wird Schule ihrem Auftrag in einem wichtigen Punkt nicht gerecht. Die unterschiedlichen Bildungskarrieren von Jungen und Mädchen und die Rolle, die das Fach Mathematik darin spielt, müssen also auch im Zusammenhang mit ihrem Interesse am Fach, dem fachbezogenen Selbstvertrauen, der Lernmotivation und anderen lernrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen gesehen und untersucht werden (Keller 1998: 17), denn die eingangs erwähnte formale Gleichheit der Ausbildungschancen reicht als Kriterium für Gleichheit nicht aus. Gleichheit der Ausbildung kann noch auf mindestens zwei weiteren Ebenen verwirklicht (oder verfehlt) werden – als Gleichheit im Sinne von Gleichbehandlung der Geschlechter und als Gleichheit im Sinne von gleichen Erträgen und Erfolgen der Geschlechter im Bildungsprozess (Fennema 1998).
Problematisch sind die Geschlechtsunterschiede in und um Mathematik außerdem auch allein dadurch, dass sie traditionelle Geschlechtsrollenstereotype abbilden. Damit widersprechen sie nicht nur einem modernen Verständnis von Geschlechtergleichheit, sie geraten auch in den Verdacht, selbst ein Produkt von Tradition und Sozialisation zu sein. Mit anderen Worten: Wer ab dem Säuglingsalter auf ein Leben als Mann oder Frau (mit seinen stillschweigenden Implikationen in Bezug auf Mathematik) vorbereitet wird, hat es später schwer, den entsprechenden Erwartungen nicht zu entsprechen.
Unterschiedliche Schul- und Berufskarrieren von Jungen und Mädchen könnten also nicht nur das Ergebnis unterschiedlich ertragreicher Schulbildung sein, sondern auch davon abhängen, wie Menschen über Mathematik denken, welche Erwartungen sie den Frauen und Männern oder Jungen und Mädchen entgegenbringen und wie gut (oder schlecht) sie sich in Mathematik erfolgreiche Frauen vorstellen können.
Geschlechtsunterschiede werden nicht deshalb zum Problem, weil die Geschlechter sich nicht unterscheiden dürften oder müssten. Ihre Problematik ergibt sich aus den Nachteilen, die Menschen daraus entstehen können, wenn ihnen Fähigkeiten, Interessen und Rollenerwartungen zugeschrieben werden, die sie an ihrer persönlichen Entfaltung oder an der Wahrnehmung ihrer Rechte hindern. Eine wichtige öffentliche Aufgabe demokratischer Gesellschaften besteht deshalb darin, solche Benachteiligungen und Behinderungen aufzuheben und unter Berücksichtigung individueller – wenn nötig auch geschlechtsspezifischer – Eigenarten für die bestmögliche Ausbildung von Mädchen wie Jungen zu sorgen (Keller 1998: 28). Um dies leisten zu können, bedarf es eines eingehenden Wissens über Art und Ursprung der Ungleichheit, über ihre Wirkungen und darüber, wie sie beeinflusst werden kann.
I.3 Geschlecht als Gegenstand der Forschung
Warum unterscheiden sich die Bildungswege von Männern und Frauen, wenn es um Mathematik geht? Warum gilt Mathematik als Fach für Männer? Warum sind hervorragende Leistungen von Frauen in Mathematik immer noch etwas Besonderes?
So leicht diese Fragen gestellt werden, so schwierig ist die Suche nach dauerhaft richtigen Antworten. Geschlechtsunterschiede sind allgemein ein intensiv erforschter, aber zugleich mit sehr kontroversen Befunden aufwartender Gegenstandsbereich, was sich auch auf die Erforschung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik auswirkt. Dies liegt zum einen am Gegenstand selbst, zum anderen an der Bedeutung, die dieser Gegenstand für die meisten Menschen hat. In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe der Geschlechterforschung und die mit ihnen verknüpften Probleme vorgestellt.
I.3.1 „Sex“ und „Gender“
Menschen werden entweder mit weiblichen oder mit männlichen physischen Geschlechtsmerkmalen geboren (von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen). Dadurch ist ihr biologisches Geschlecht von Anfang an festgelegt. Von dieser primären Zuordnung hängt ab, welchen sozialisatorischen Einflüssen ein Mensch während seines Lebens ausgesetzt ist. Mädchen und Jungen erleben jeweils andere Erwartungen und Reaktionen ihrer sozialen Umwelt auf ihr Dasein und ihr Verhalten. Sie werden darin erzogen, was es in sozialem Sinne bedeutet, „Junge“ oder „Mädchen“ zu sein bzw. „Mann“ oder „Frau“ zu werden und entwickeln dementsprechend unterschiedliche Persönlichkeiten. Die meisten dieser Einflüsse sind rein sozialer Natur, d.h. sie sind nicht in biologischem Sinne unvereinbar mit dem jeweils entgegengesetzten Geschlecht. Sie entsprechen lediglich den soziokulturell vorgesehen Kategorien für geschlechtsadäquates Verhalten und erfüllen entsprechende Funktionen, z.B. bei der Zuweisung von sozialen Rollen oder bei der Arbeitsteilung.
Im Geschlecht einer Person verschmelzen also biologisch determinierte Merkmale (biologisches Geschlecht, Engl. sex) und soziokulturelle Merkmale (soziokulturelles Geschlecht, Engl. gender) zu einer lebenslangen Einheit. Wie groß der Anteil biologischer Notwendigkeit an den Eigenarten der Geschlechter ist und welche Rolle daneben Erziehung und andere Umwelteinflüsse bei deren Entstehung spielen, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Weil es für Mädchen und Jungen praktisch von Geburt an keine wirklich übereinstimmenden Erfahrungswelten gibt und alle Experimente die untersuchten Menschen jeweils nur an einem mehr oder weniger frühen Punkt ihrer geschlechtlichen Entwicklungsgeschichte erfassen können, ist es nahezu unmöglich, die Einflüsse der biologischen und der soziokulturellen Sphäre klar von einander zu trennen (Bernard 1973: 3 – nach Gage & Berliner 1996: 184).
I.3.2 Anlage oder Umwelt?
Über die Frage, ob Männer und Frauen sich eher durch „Anlage“, also kraft ihrer biologischen Ausstattung, voneinander unterscheiden, oder ob sie erst durch die „Umwelt“, also Erziehung und Sozialisation, zu „Männern“ und „Frauen“ mit ihren typischen oder spezifischen Eigenschaften heranwachsen, wird unter Forschern leidenschaftlich diskutiert. Die Frage ergibt sich zwangsläufig aus der oben geschilderten Janusköpfigkeit von Geschlecht als soziokulturellem Konstrukt auf biologischer Grundlage. In der psychologischen Geschlechterforschung wird sie stellenweise zu einer Kontroverse zugespitzt, bei der Forschung scheinbar vor allem zu dem Zwecke betrieben wird, Belege für bzw. gegen eine der beiden Positionen anzuhäufen, um die Kontroverse zu Gunsten der eigenen Seite zu entscheiden (Halpern 1986: 3). Der Erfolg solcher Anstrengungen ist zweifelhaft, da zum einen die Gefahr besteht, die jeweils andere Komponente auszublenden und zum anderen diese Debatte, wie Halpern (a.a.O.) schreibt, bereits „seit über 2000 Jahren“ geführt wird – ohne entschieden zu werden. Heute neigen Wissenschaftler(innen) allerdings mehrheitlich zu der Ansicht, dass die Entstehung von Geschlechtsunterschieden am besten als Interaktion von Anlage- und Umweltfaktoren erklärt werden könne. Die entsprechende Frage an die Forschung sei nicht, ob, sondern wie viel Anlage und Umwelt jeweils zu den Unterschieden beitragen (ebd.).
Nach Einschätzung vieler Autoren (z.B. Halpern 1986; Keller 1998: 28 f.; Gage & Berliner 1996: 190) wird in jüngerer Zeit die Bedeutung soziokultureller Einflüsse deutlich höher eingeschätzt als die biologischer Einflüsse. Auch im Bereich der mathematischen Geschlechtsunterschiede überwiegt dieser Ansatz. Dennoch werden biologische Faktoren nach wie vor von zahlreichen Autorinnen und Autoren ins Feld geführt, um die Unterschiede zu erklären. Ein viel diskutiertes Beispiel ist die in manchen Untersuchungen festgestellte Korrelation von mathematischer Hochbegabung mit bestimmten biologischen Merkmalen wie Kurzsichtigkeit, Allergieanfälligkeit und Linkshändigkeit (z.B. Benbow 1988). Biologische Faktoren werden teilweise auch indirekt in die Diskussion eingeführt, zum Beispiel indem postuliert wird, die bessere räumliche Wahrnehmung bei Männern, die als ein möglicher Grund für Leistungsunterschiede in Mathematik gilt (siehe Kap. III.3), sei eine genetisch fest gelegte Evolutionsfolge (z.B. Geary 1996).
Gegenüber solchen Positionen wird in der Literatur häufig der Vorbehalt geäußert, sie würden zu deterministischen Aussagen über die Natur dieser Unterschiede führen. In der Tat wurden biologische Erklärungen für Geschlechtsunterschiede in der Vergangenheit immer wieder dazu benutzt, gesellschaftliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu rechtfertigen (vgl. Keller 1998: 27; Halpern 1986: 3-5). Wenn dadurch dem Ziel entgegengewirkt wird, bestmögliche Lernbedingungen für beide Geschlechter zu schaffen, können solche Erklärungen in der Diskussion tatsächlich eine problematische Rolle spielen. Andererseits dürfen Belege für biologische Geschlechtsunterschiede nicht allein wegen der Gefahr ihres Missbrauchs verschwiegen werden (vgl. Kap. I.3.3).
Da die Forschung zu Geschlechtsunterschieden in Mathematik mit zahlreichen Belegen für jede der gegensätzlichen Positionen aufwartet und zudem beide Positionen schwerwiegende ideologische Implikationen haben, ist die Anlage-Umwelt-Kontroverse in der Fachliteratur weiter gegenwärtig. Eine Lösung ist, wie gesagt, nicht zu erwarten. Aber eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen und ihren Argumenten ebenso wie mit ihren Implikationen ist unerlässlich, um sich der Wahrheit über Geschlechtsunterschiede in Mathematik weiter annähern zu können.
I.3.3 Ideologie und Wissenschaft
Wissenschaft und Ideologie liegen in der Erforschung von Geschlechtsunterschieden dicht beieinander. Es dürfte nur wenige Bereiche in den Humanwissenschaften geben, in denen Forschungsergebnisse mit solchen Vorbehalten rezipiert werden, Forschungsfragen derart mit sozialen und politischen Implikationen beladen sind und Objektivität von Mythos so schwer zu unterscheiden ist wie hier. Dies urteilte schon vor hundert Jahren Wooley (1910 – nach Richter 1996), und daran hat sich bis heute nach weit verbreiteter Meinung nicht viel geändert (vgl. Mealey 2000, Vorwort; Richter 1996: 22; Halpern 1986: 1).
Die Gründe hierfür sind leicht zu finden. Vor allem gibt es natürlich keine Menschen ohne Geschlecht. Geschlechterfragen sind durch alle Kulturen hindurch und für die allermeisten Menschen von wesentlicher Bedeutung. Zugleich sind mit der Unterscheidung von Männer- und Frauenrollen nach wie vor in allen Gesellschaften signifikante und teils erheblich Unterschiede in den Lebensumständen verknüpft. Männer haben einen größeren Anteil an politischem Einfluss und Macht, sie besetzen die wichtigsten Positionen in der Wissenschaft, sie verdienen mehr und haben in vielen Gesellschaften mehr Rechte als Frauen. Während dies vor hundert und mehr Jahren in Europa und Nordamerika noch als Ausdruck einer natürlichen Ordnung galt, hat die rasante Entwicklung industrialisierter Gesellschaften inzwischen viele der traditionellen Rollenvorstellungen überholt und zunehmend zu ihrer Infragestellung und Auflösung geführt. Dieser Prozess findet in allen Teilen der Welt mehr oder weniger intensiv statt und ist sozial wie politisch zumeist höchst umstritten.
In dieses Klima ist die Geschlechterforschung nolens volens eingebettet. Wissenschaft kann nicht verhindern, dass die Fragen, die sie untersucht, von hohem öffentlichen Interesse sind oder zumindest politische und gesellschaftliche Konsequenzen von hohem Streitwert implizieren, z.B. die Frage, ob Frauen physisch und psychisch tauglich für das Kriegshandwerk seien, ob sie sich für höchste politische Ämter eignen, ob Männer einer Rolle als Alleinerziehende gewachsen sind, oder warum Frauen in den Wissenschaften unterrepräsentiert sind (Halpern 1986: 2). Auch die Frage, ob Frauen und Männer gleichermaßen zur Mathematik befähigt sind, gehört zu diesen ideologisch beladenen Fragen, die, wie auch immer beantwortet, heftige Reaktionen auslösen können.
Angesichts solcher Verhältnisse liegt die Vermutung nahe, dass Wissenschaftler ihrer Verpflichtung auf Kardinaltugenden wie Interesselosigkeit und Objektivität nicht immer gerecht werden. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit Untersuchungen auch zu dem Zweck angestrengt, die unterschiedliche gesellschaftliche Stellung von Mann und Frau auf biologisch angelegte Geschlechtsunterschiede zurück zu führen und damit festzuschreiben. Rudiger & Bierhoff-Alfermann (1979) haben dies am historischen Wandel der Annahmen über die biologische Determiniertheit von Intelligenz gezeigt: Demnach wurde ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und einem bestimmten hirnphysiologischen Merkmal stets nur so lange aufrecht erhalten wie die Medizin davon ausging, dass dieses Merkmal die höhere Intelligenz von Männern belege. So wurden z.B. Größe und Gewicht des Hirns als Indikator für Intelligenz angesehen, als man feststellte, dass Männer hier höhere Werte erzielen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass relativ zum Körpergewicht Frauen das größere Hirn hätten, was dazu führte, dass dieses „Intelligenz-Merkmal“ von einem anderen, der Größe der Frontallappen (bei Männern größer), abgelöst wurde. Als die Medizin nun feststellte, dass nicht diese, sondern die Partiallappen für die Intelligenz besonders wichtig seien, wurde auch darin wieder ein Indiz für höhere männliche Intelligenz gesucht und gefunden. „Theorie (und Daten) machten alle notwendigen Mutationen mit, um die männliche Überlegenheit zu ‚beweisen‘“ (Rudiger & Bierhoff-Alfermann 1979: 215 – nach Richter 1986: 22).
Obwohl dieses Beispiel aus heutiger Sicht belächelt werden mag, zeigt es sehr gut, wie sehr gesellschaftliche und politische Interessen auf die Ergebnisse der Geschlechterforschung Einfluss nehmen können. Andererseits besteht in einem Klima ideologischer Auseinandersetzungen immer auch die Gefahr, dass Forschungsresultate, auch wenn sie objektiv und ideologiefrei zu Stande kamen, zur Durchsetzung partikulärer Interessen zweckentfremdet werden. Die Gefahr des Missbrauches von Forschungsresultaten wird deshalb im Zusammenhang mit der Geschlechterforschung durchaus diskutiert und hat (zumindest in den Vereinigten Staaten) schon zu Forderungen geführt, bestimmte Forschungsergebnisse zu zensieren (Halpern 1986: 10). Abgesehen von den möglichen Gefahren einer solchen Praxis erscheint es aber weitaus wichtiger, den Faktor Ideologie jederzeit als Mahnung zur Vorsicht im Umgang mit sogenannten und tatsächlichen Geschlechtsunterschieden in Erinnerung zu behalten.
I.3.4 „Sex Bias“
Verglichen mit den Gefahren, die der Forschung durch ideologische Voreingenommenheit gegenüber Geschlechterfragen drohen, sind sogenannte „Bias-Faktoren“ ein weitaus subtileres und schwerer zu entdeckendes Störmoment in der Forschung. Mit „Sex Bias“ (Engl. bias = Neigung, Vorurteil) bezeichnet man ergebnisverzerrende Einflüsse, die dem Umstand entspringen, dass jeder Mensch, also auch jeder Wissenschaftler, in Wahrnehmung und Verhalten durch die Erfahrungen begrenzt wird, die ihm sein eigenes Geschlecht auferlegt. Dadurch neigt sie oder er zur Voreingenommenheit, selbst wenn dies nicht beabsichtigt ist. Auf die Ergebnisse seiner oder ihrer Arbeit kann das einen erheblichen Einfluss haben.
Wenn man bei Untersuchungen zu Geschlechtsunterschieden im Bereich „Abhängigkeit und Konformität“ die Ergebnisse in Bezug zum Geschlecht der Forscherin oder des Forschers setzt, wie das Eagly & Carli (1981 – nach Richter 1986: 23) in einer Metaanalyse von 148 Studien taten, kann sich z.B. folgendes Bild zeigen: Während männliche Forscher eine höhere Konformität und Abhängigkeit bei Frauen nachwiesen, fanden Forscher innen keine Unterschiede. Das Gesamtergebnis aller Studien entsprach jedoch dem von den männlichen Untersuchungsleitern gefundenen Ergebnis, weil diese mit einem Anteil von 79 % am Zustandekommen der 148 Studien beteiligt waren. Die Autoren folgern, dass mit ähnlichen Verzerrungen überall dort zu rechnen sei, wo der Anteil von Männern in der Forschung den von Frauen überwiegt, was für weite Teile der Wissenschaften gilt: „Because men are overrepresented among researchers, then psychology has probably generated an unfairly negative view of women“ (a.a.O.: 19).
Richter (1986: 23 f.) führt folgende Punkte an, in denen Bias-Faktoren einen Einfluss auf Untersuchungsergebnisse nehmen können:
1. Forscher beiderlei Geschlechts beurteilen gleichgeschlechtliche Personen im Schnitt positiver. Ein höherer Anteil männlicher Forscher kann sich zu Ungunsten der weiblichen Seite auswirken.
2. Forscher beiderlei Geschlechts konkretisieren ihre jeweilige Fragestellung so, dass das eigene Geschlecht bevorzugt wird.
3. Wenn Versuchsleiter häufiger männlich sind (eine Information, die im Allgemeinen nicht erhoben wird), könnte dies ebenfalls einen Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse haben.
4. Ergebnisse können, in einem gewissen Rahmen, unterschiedlich dargestellt werden. Zum Beispiel könnten, je nach Interessenslage, nicht signifikante Ergebnisse betont oder vernachlässigt werden.
Außerdem muss möglicherweise berücksichtigt werden, dass Forscherinnen und Forscher von vorneherein unterschiedliche Untersuchungsziele verfolgen - und unterschiedliche Strategien anwenden müssen, um diese zu erreichen. Für Männer ist eine Situation, in der Forschungsergebnisse ihre stärkere Position in vielen Lebensbereichen zu erklären scheinen, vorteilhaft. Frauen hingegen müssen, um ihr Ziel einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zu erreichen, Geschlechtsunterschiede in Frage stellen. Insbesondere Erkenntnisse über anlagebedingte Unterschiede wirken ihren Interessen zumeist entgegen. Es liegt daher nahe, dass Forscher innen sich stärker auf Untersuchungen konzentrieren, die den Umwelt-Anteil am Zustandekommen geschlechtlicher Ungleichheit zu erforschen suchen, während Forscher männlichen Geschlechts entweder der Erforschung von Geschlechtsunterschieden grundsätzlich weniger zugeneigt sind oder sich in der Erforschung anlagebedingter Geschlechtsunterschiede engagieren.
Diese Vermutung scheint sich zu bestätigen, wenn man die Forschungsliteratur sichtet: Bei weitem die Mehrheit der Veröffentlichungen zum Thema Geschlechtsunterschiede stammt von Frauen. Noch deutlicher fällt dies bei der Literatur zu Geschlechtsunterschieden in Mathematik ins Auge. Die meistzitierten Autorennamen (z.B. Fennema, Hyde, Benbow) sind die von Frauen. Alle sieben Monographien, die in deutscher Sprache zum Thema „Mädchen bzw. Frauen und Mathematik“ erschienen sind (Keller 1998; Richter 1996; Beerman, Heller & Menacher 1992; Grabosch & Zwölfer 1992; Brehmer, Küllchen & Sommer 1989; Srocke 1986; Schildkamp-Kündiger 1974) wurden von Frauen verfasst; nur in einem Fall (Beerman et. al.) ist überhaupt ein Mann als Co-Autor beteiligt. Das Verhältnis von Autorinnen zu Autoren im Literaturverzeichnis dieser Arbeit beträgt ca. 3:1. Ob dieses Verhältnis für den Forschungsbereich tatsächlich repräsentativ ist, wäre eine eigene Untersuchung wert. In jedem Fall liegt der Frauenanteil unter den Forschern sowohl im Bereich allgemeiner Geschlechtsunterschiede wie bei den mathematischen Geschlechtsunterschieden deutlich höher als in anderen Bereichen der Psychologie und noch einmal höher als in den meisten anderen Wissenschaftsfeldern. Männer treten als Spezialisten auf diesem Gebiet nur selten in Erscheinung. Wenn sie es doch tun, vertreten sie bezeichnenderweise relativ häufig Positionen, die den anlagebedingten Anteil am Zustandekommen von Geschlechtsunterschieden betonen (z.B. Baron-Cohen, Geary, Klieme), während bei der Literaturrecherche für diese Arbeit nur eine einzige prominente weibliche Vertreterin für einen solchen Ansatz aufgefallen ist (Benbow). Die namhaften Befürworterinnen sozialisationstheoretischer Erklärungsansätze sind hingegen zahlreich (Fennema, Hyde, Eccles, Leder, Hannover, Kessels, Schildkamp-Kündiger und viele andere).
Der hohe Anteil von Frauen in der Geschlechterforschung hat diesem Forschungsbereich den Ruf eingetragen, ein Hort feministischer Wissenschaft zu sein. Dies könnte als Kritik an einer Einseitigkeit unter umgekehrten Vorzeichen verstanden werden. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, worin der spezifische Beitrag von Frauen auf diesem Gebiet (wie auch auf anderen) besteht. Halpern (1986: 9 f.) schreibt dazu:
„One of the goals of feminist scholarship is the recognition and elemination of the ‚androcentric bias in both content and method‘ in traditional research (Lott, 1985). Men and women who ascribe to the philosophy of feminist research are careful to consider the importance of context or situational variables as potent influences on the results they obtain from research.“
Feministische Forschung in diesem Sinne beinhaltet die Aufgabe, die Mechanismen zu identifizieren, mittels derer das Geschlecht von Menschen ihre Handlungen leitet und prägt. Angewandt auf die Wissenschaft selbst führt dies beinahe zwangsläufig zu einer kritischen Haltung gegenüber einem Wissenschaftsmodus, der Jahrhunderte lang exklusiv von den Angehörigen nur eines Geschlechts gestaltet wurde. Ebenso folgerichtig ist die verstärkte Hinwendung von Wissenschaftlerinnen zu Forschungsbereichen, die Geschlechtsverschiedenheit zu erklären versuchen. Dadurch haben sie bereits einige wichtige Veränderungen gegenüber einer vorwiegend männlich geprägten Wissenschaft bewirkt. Eine davon ist die Tatsache, dass die Relevanz von Bias-Faktoren für die Qualität wissenschaftlicher Forschung überhaupt erkannt wurde und in jüngerer Zeit immer stärker berücksichtigt wird. Eine andere ist die Aufwertung bestimmter nicht traditioneller Forschungsmethoden wie z.B. qualitative Interviews (Halpern 1986: 10). Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass inzwischen immer mehr männliche Wissenschaftler die Schwächen einer androzentrischen Wissenschaftsperspektive erkennen und sich bemühen, diese auszugleichen.
Die genannten Veränderungen sind selbst ein Beleg für die Wirksamkeit von geschlechtlichen Bias-Faktoren. Dass ein weiblich dominierter Forschungsbereich ebenso zur Einseitigkeit neigt wie ein männlich dominierter, ist natürlich ein begründeter Einwand. Allerdings darf man, wie Halpern (a.a.O.) schreibt, mit Recht hoffen, dass in diesem Forschungsbereich sich die Wissenschaftler beiderlei Geschlechts ihrer persönlichen Voreingenommenheit besonders bewusst sind. Langfristig lassen sich die Gefahren einer bias-bedingten Verfälschung von Forschungsergebnissen nur dadurch bannen, dass sich das Verhältnis von „weiblicher“ zu „männlicher“ Wissenschaft der Normalverteilung angleicht.
I.4 Die Erforschung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik
Eine gelehrte Frau wurde gefragt:
„Who is the better mathematician – man or woman?“
Ihre Antwort: „Which man? Which woman?“
(frei nach Halpern 1986)
Diese Anekdote passt gut zur Erforschung von Geschlechtsunterschieden - welche Art von Antworten man sich von ihr erhofft und welche Art von Fragen sie beantworten kann. Sie macht auf ein typisches Problem aufmerksam: Die Antworten passen scheinbar nicht zu den Fragen. Der imaginierte Fragende[1] aus obigem Beispiel dürfte jedenfalls mit der Antwort kaum zufrieden gewesen sein. Was er sich erhofft hatte, war vermutlich eine Antwort, die ihn der Mühen eines individuellen Vergleiches für immer enthoben hätte. Andererseits kann man auch besorgt sein, was er mit einer solchen Antwort angefangen hätte (vgl. Kap. I.3.3). Deshalb war es klug von der Befragten, den anderen darauf hinzuweisen, welche Art von Frage sie zu beantworten bereit und in der Lage sei.
Dieses Kapitel befasst sich damit, wie in der Forschung zu Geschlechtsunterschieden versucht wird, das Dilemma zwischen ambitionierten Fragen und bescheidenen Antworten zu lösen. Dabei geht es zunächst um wissenschaftstheoretische und definitorische, dann um empirisch-methodische Fragen und anschließend um die Frage der Deutung von Forschungsbefunden.
I.4.1 Geschlechtsunterschiede und Wissenschaftstheorie
Wissenschaft kann sich nicht damit zufrieden geben, Individuen miteinander zu vergleichen. Sie will herausfinden, inwiefern bestimmte Unterschiede für eine Gruppe von Merkmalsträgern zutreffen und ob sie möglicherweise für die Geschlechtergruppen ins-gesamt gelten: Sind z.B. Mädchen nur manchmal unterrepräsentiert in Hochbegabtengruppen, oder werden sie allgemein seltener als hochbegabt erkannt? Ist dies überall so, oder nur in manchen Städten bzw. Ländern?
Wissenschaft will außerdem die Ursachen dieser Unterschiede verstehen: Sind Mädchen deshalb seltener in Hochbegabtengruppen anzutreffen, weil sie weniger intelligent sind - oder weil die gesellschaftliche Wahrnehmung hinsichtlich Hochbegabung selektiv ist und Mädchen häufiger „übersieht“? Oder schaffen die gängigen Kriterien für Hochbegabung einseitige Auslesebedingungen zum Nachteil von Mädchen?
Ziel aller Forschung ist dabei stets, zu möglichst allgemein gültigen Aussagen über die Art und Beschaffenheit von Geschlechtsunterschieden und über ihre Ursachen zu kommen, z.B.: „Mädchen sind deshalb seltener in Hochbegabtengruppen anzutreffen, weil Begabung bei Mädchen seltener erkannt wird. Tatsächlich gibt es genauso viele hochbegabte Mädchen wie Jungen.“
Aussagen wie diese sind allerdings in der Geschlechterforschung aus zwei Gründen praktisch nicht haltbar. Zum einen gibt es im Bereich der Psychologie so gut wie keine unikausalen Zusammenhänge. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ein geringer Mädchenanteil in Hochbegabungsgruppen durch einen Faktor alleine erklärt wird. Zum anderen können aus wissenschaftstheoretischen Gründen Aussagen über die Wirklichkeit immer nur einen Wahrscheinlichkeitsgrad ausdrücken. Zum Beispiel kann eine Aussage wie „Mädchen sind grundsätzlich seltener hochbegabt“ empirisch nie bewiesen werden, da es unmöglich ist, alle Mädchen und Jungen miteinander zu vergleichen (Halpern 1986: 24). Und selbst, wenn man eine große repräsentative Gruppe von Jungen und Mädchen ohne weiteres auf Hochbegabung testen und ihre Ergebnisse miteinander vergleichen kann, erlaubt dieser empirische Befund doch immer nur eine Aussage darüber, welches Ergebnis ein Leistungsvergleich unter ganz bestimmten räumlich-zeitlichen Bedingungen mit ganz bestimmten Erhebungsmethoden vorgenommen an ganz bestimmten Personen erbracht hat. Auf diese Weise kann eine Hypothese über die Häufigkeit von Hochbegabung bei Jungen und Mädchen unterstützt oder nicht unterstützt werden. Einer Theorie, die den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Begabung zu erklären versucht, könnte so zusätzliche Plausibilität verliehen werden. Aber ein Untersuchungsbefund kann niemals zukünftige Befunde vorwegnehmen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine nächste Untersuchung unter ähnlichen Bedingungen zu ganz anderen Ergebnissen führen würde. Deshalb gibt es für die Vermutung, dass Jungen häufiger hochbegabt seien, ebenso wenig einen empirischen Beweis wie für alle anderen behaupteten Zusammenhänge zwischen Geschlecht und einer anderen Variable.
Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt im Sinne der Verallgemeinerbarkeit bestimmter Zusammenhänge erwächst in den empirischen Wissenschaften aus Hypothesen bzw. Theorien, für die durch wiederholte Überprüfung ein hohes Maß an empirischer Evidenz angesammelt wurde. Im Bereich der Schulleistungsforschung gilt dies zum Beispiel für den Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und der tatsächlichen Leistung in diesem Fach. Dieser Zusammenhang ist durch verschiedenste Untersuchungen von zahlreichen Wissenschaftlern in vielen Ländern wiederholt bestätigt worden, d.h. es wurde an unterschiedlichen Untersuchungsgruppen mit z.T. unterschiedlich operationalisierten Variablen gezeigt, dass Kinder mit einem niedrigen Selbstvertrauen weniger Nutzen aus ihren Fähigkeiten zogen als Kinder mit einem guten Selbstvertrauen. Das sind dann sehr gute empirische Gründe, einen allgemeinen Zusammenhang zu formulieren: Gutes fachliches Selbstvertrauen wirkt sich positiv auf die in diesem Fach gezeigte Leistung aus. Dies bedeutet nicht, dass dieser Zusammenhang nicht durch andere gestört oder aufgehoben werden könnte. Es bedeutet nicht, dass nicht manche Kinder mit schlechtem Selbstvertrauen dennoch hin und wieder eine gute oder sehr gute Leistung zeigen. Es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit einem hohen Selbstvertrauen bessere Leistungen zeigen als vergleichbare Kinder mit einem schlechten Selbstvertrauen, sehr hoch ist. Nebenbei gesagt sind Geschlechtsunterschiede im fachspezifischen Selbstvertrauen deshalb auch ein Anhaltspunkt, geschlechtsabhängige Leistungsunterschiede in Mathematik zu erklären (siehe Kap. IV.3).
I.4.2 Was sind Geschlechtsunterschiede in Mathematik?
Der Ausdruck „Geschlechtsunterschiede in Mathematik“ hat mehrere Bedeutungen - eine eher umgangssprachliche und einige eher wissenschaftliche. Zunächst sind damit einfach solche Unterschiede in Mathematik gemeint, die mit dem Geschlecht der fraglichen Personen in Verbindung gebracht werden. Wenn in einer Klassenarbeit in Mathematik der Notendurchschnitt der Mädchen über dem der gesamten Klasse liegt, so ist das eine andere Formulierung dafür, dass Mädchen als Geschlechtsgruppe in dieser Klassenarbeit besser abgeschnitten haben. Die unabhängige Variable Geschlecht markiert also einen Unterschied in der Benotung.
In einem wissenschaftlicheren Sinne ist dies freilich noch kein echter Geschlechtsunterschied. Denn genauso wenig wie bei einer unterschiedlichen Benotung der Dunkel- und der Hellhaarigen von einer kausalen Beziehung zwischen Haarfarbe und Mathematiknote ausgegangen würde, darf man für dieses Beispiel behaupten, dass die unterschiedlichen Noten etwas mit dem Geschlecht der Schülerinnen und Schüler zu tun haben.
In einem engeren Sinne ist der Begriff des Geschlechtsunterschiedes in Mathematik also an bestimmte Bedingungen geknüpft: Er muss sich unter bestimmten kontrollierten Bedingungen gezeigt haben und so ausgeprägt sein, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass es einen überzufälligen korrelativen Zusammenhang zwischen der Notengebung und dem Geschlecht der Schülerinnen und Schüler gibt. Selbst wenn dadurch keine kausale Beziehung zwischen den beiden Variablen nachgewiesen werden kann, spräche man dann von einem „signifikanten Zusammenhang zwischen der Variable Geschlecht und der Variable Mathematiknote“.
Die dritte Bedeutung des Begriffs bezieht sich auf die Verallgemeinerbarkeit von Leistungsunterschieden wie den im Beispiel genannten auf andere Personen und andere Situationen. Mit anderen Worten: Geschlechtsunterschiede in Mathematik sind auch als generelle Unterschiede zwischen Personen männlichen und weiblichen Geschlechts in der mathematischen Leistung bzw. Leistungsfähigkeit zu verstehen. Dieser Bedeutung gilt schwerpunktmäßig das wissenschaftliche Interesse. Eine zentrale Frage in der Forschung zu Geschlechtsunterschieden in Mathematik ist also, ob bei wiederholt feststellbaren Leistungsunterschieden von Jungen und Mädchen (oder Frauen und Männern) in Mathematik von unterschiedlicher mathematischer Leistungsfähigkeit der Geschlechter im Allgemeinen gesprochen werden kann. Der Beantwortung dieser Frage sind bereits unzählige Untersuchungen gewidmet worden. Sie steht von der wissenschaftlichen Bedeutung her auf einer Stufe mit Fragen wie „Haben Männer oder Frauen die besseren verbalen Fähigkeiten?“ oder „Gibt es Geschlechtsunterschiede im Bereich der Intelligenz?“.
Schließlich bezieht sich der Begriff „Geschlechtsunterschiede in Mathematik“ auch noch auf Geschlechtsunterschiede in den Voraussetzungen mathematischer Leistungsfähigkeit wie z.B. Intelligenz, Bildungsniveau, Einstellungen, Leistungsmotivation, Selbstvertrauen und vielen anderen. In vielen Bereichen, die mit dem Begreifen, Lernen und Anwenden von Mathematik in Verbindung stehen, lassen sich Geschlechtsunterschiede feststellen. Deshalb sind Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Geschlechtsunterschieden in der Mathematikleistung einerseits und Geschlechtsunterschieden in weiteren Bereichen andererseits erforschen, ebenfalls dem Forschungsbereich „Geschlechtsunterschiede in Mathematik“ zuzuordnen.
I.4.3 Forschungsmethoden
Der überwiegende Anteil von Forschungsbefunden zu Geschlechtsunterschieden allgemein ebenso wie zu Geschlechtsunterschieden in Mathematik stammt aus halbexperimentellen Untersuchungen, in denen eine oder mehrere Variablen (z.B. Mathematikleistung, Motivation, Selbstkonzept) mit der unabhängigen Variable Geschlecht der Untersuchungspersonen korreliert wurden (Halpern 1986: 18 ff.). „Halbexperimentell“ bedeutet, dass durch Kontrolle der Versuchsbedingungen versucht wird, den Einfluss anderer als der untersuchten Variablen möglichst gering zu halten. Gütekriterien hierfür sind die Auswahl der Stichproben (Stichprobengröße, Repräsentativität, d.h. Normalverteilung möglicher interferierender Variablen wie Intelligenz, sozioökonomischer Status etc., und Stärke der gefundenen Korrelationen bzw. Effekte). Echte Experimente, in denen Störeinflüsse nahezu vollständig ausgeschlossen werden können, kommen dagegen in der Geschlechterforschung so gut wie nicht vor (a.a.O.: 21 f.).
Erkenntnisfortschritt wird in erster Linie durch die wiederholte Bestätigung eines Befundes unter variierten Bedingungen und, wenn möglich, in Verbindung mit einer plausiblen, ebenfalls gut bestätigten Theorie erzielt (a.a.O.: 24). Dies liegt zum einen an der Natur von Geschlecht als untrennbare Einheit aus biologischen, psychologischen und soziokulturellen Komponenten, die es äußerst schwer macht, einfache und lineare Zusammenhänge zu identifizieren. Zum anderen liegt es an der Tatsache, dass die Nichtexistenz von Geschlechtsunterschieden nicht bewiesen werden kann. Es kann also nur durch wiederholtes Ausbleiben eines Unterschieds die Vermutung bestärkt werden, dass sich die Geschlechter im untersuchten Aspekt nicht unterscheiden. Andererseits kann ein vereinzelter Befund niemals die Gewissheit begründen, dass ein Unterschied vorliegt (ebd.; Rudiger & Bierhoff-Alfermann 1979 – nach Richter 1998: 25).
Weitere Erhebungsmethoden zur Erforschung von Geschlechtsunterschieden in Mathematik sind Umfragen, Interviews oder Observation (Halpern 1986: 17 ff.). Zur Masse der empirischen Befunde tragen sie nur relativ wenig bei, da die mit ihnen erhobenen Daten zur Verallgemeinerung meist wenig geeignet sind. Dennoch kann jede dieser Methoden einen Beitrag zum Verständnis von Geschlechtsunterschieden leisten. Zum Beispiel kann durch Befragung oder Beobachtung ein Anfangsverdacht oder eine Fragestellung für zukünftige Forschung begründet werden (Halpern 1986: 18). Unterschiede im kognitiven Stil bzw. im Problemlöseverhalten von Jungen und Mädchen würden z.B. in herkömmlichen Leistungstest gar nicht auffallen (während sie durchaus einen Effekt auf die Leistung haben können). Mittels Beobachtung hingegen würde zum Beispiel möglicherweise erkannt, dass sich Mädchen eher von allen Seiten an eine Aufgabe heran tasten, während Jungen dagegen unvermittelt nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ voranschreiten (vgl. Kap. III.5).
Weitere wichtige Forschungsmethoden sind Faktorenanalyse und Metaanalyse. Die Faktorenanalyse ist ein traditionelles Forschungsinstrument, das etwa der Intelligenzforschung zu wichtigen Erkenntnissen verholfen hat. Sie ermöglicht, aus einer Vielzahl kognitiver Fähigkeiten bestimmte „Cluster“ oder Dimensionen von Einzelfähigkeiten zu isolieren, die sogenannten „Faktoren“. Diese stehen dann z.B. für mehrere voneinander unabhängige Intelligenzbereiche wie z.B. verbale, räumlich-visuelle und quantitative Fähigkeiten.
Die Metaanalyse ist ebenfalls ein sehr wichtiges Instrument in der Forschung zu Geschlechtsunterschieden, gerade in Anbetracht der in diesem Bereich üblichen überwältigenden Mengen an Einzelbefunden. Eine Metaanalyse kann hier für den notwendigen Überblick sorgen. Sie fasst möglichst viele relevante Befunde zu einem Forschungsthema zusammen und synthetisiert daraus einen gemeinsamen statistischen Wert. So ist es möglich, aus Hunderten von Studien ein begründetes Maß für den jeweiligen Geschlechtsunterschied zu gewinnen. Eine der frühesten (und bekanntesten) Untersuchungen dieser Art ist die Studie von Maccoby & Jacklin (1974), in der die Autorinnen so gut wie alle amerikanischen Forschungsberichte und –artikel der damaligen Zeit zu Geschlechtsunterschieden auswerteten.
Messmethoden spielen in allen Untersuchungen zu Geschlechtsunterschieden eine zentrale Rolle. Beim Messen wird ein Untersuchungsmerkmal, z.B. das Interesse einer Person an Mathematik, auf eine bestimmte Art quantifiziert. Bei der Interessensmessung geschieht das anhand mehrstufiger Ordinalskalen; bei anderen Variablen, z.B. Bearbeitungsgeschwindigkeit, wird mit metrischen Skalen gearbeitet. Für die Variable „Mathematikleistung“ sind, der analog zum Alter zunehmenden Komplexität mathematischer Leistungen angemessen, vielfältigste Tests als Messinstrumente gebräuchlich. Sie drücken den Leistungsstand eines Probanden durch eine oder mehrere Maßzahlen aus, häufig als Punktwert. Manche Variablen, z.B. Geschlecht, werden dagegen dichotom erhoben, d.h. sie können nur zwei Ausprägungen annehmen, z.B. 0 = männlich, 1 = weiblich.
Die Art der Operationalisierung einer Variable, also ihrer „Messbarmachung“ hat erheblichen Einfluss auf die Art der Ergebnisse. Und nicht selten sind mit ihr ernstzunehmende theoretische und methodische Probleme verknüpft. Zum Beispiel gibt es triftige Gründe anzunehmen, dass „Geschlecht“ besser als diskretes bipolares Maß mit den extremen Ausprägungen „sehr männlich“ und „sehr weiblich“ operationalisiert wird. Andere Forscher erfassen „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ dagegen als zwei separate Dimensionen, auf denen theoretisch jedes Individuum jeden beliebigen Wert einnehmen kann, was zu einer Variable mit mindestens 4 Ausprägungen führt (siehe Kap. IV.4).
I.4.4 Die Beschreibung von Forschungsbefunden
Die einfachste Form der Beschreibung von Geschlechtsunterschieden besteht in einem Mittelwertvergleich der weiblichen mit den männlichen Messergebnissen einer Untersuchung. Ein höherer durchschnittlicher Messwert der männlichen Untersuchungsteilnehmer in einem Test zur mathematischen Leistung könnte etwa als Indiz dafür gewertet werden, dass die Jungen in dieser Untersuchung die besseren Fähigkeiten in Mathematik haben. Dies trifft für den Durchschnitt der Jungen im Vergleich zum Durchschnitt der Mädchen zwar zu, sagt jedoch nichts darüber aus, wie die Leistungen der beiden Gruppen verteilt sind.
In Abbildung 1 sind sechs hypothetische Verteilungskurven der Testergebnisse von Jungen und Mädchen in einem Mathematiktest dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 (entnommen Halpern 1986)
Grafik A und B zeigen Verteilungen, in denen beide Gruppen, Jungen und Mädchen, den jeweils gleichen Mittelwert von 50 Punkten haben. In Verteilung A ist auch die Streubreite der Leistungen identisch, während in Verteilung B Jungen die größere Leistungsvariabilität haben. Die Verteilungen C, D und E zeigen jeweils gleich variable Leistungen von Jungen und Mädchen, jedoch mit zunehmenden mittleren Leistungsvorteilen der Jungen. In Verteilung E ist selbst der schwächste Junge noch stärker als das beste Mädchen. Verteilung F schließlich zeigt eine wenig variable, aber durchschnittlich hohe Leistungsverteilung bei den Mädchen, während die Jungen um den mittleren Punktwert herum normalverteilt sind, mit relativ großer Streubreite.
Das Beispiel zeigt, dass Mittelwertvergleiche als Maß für Geschlechtsunterschiede nicht ausreichen. Zusätzliche Maßzahlen sind erforderlich, die Verteilungsunterschiede der Geschlechtergruppen erkennen lassen, z.B. indem die Überschneidung der Messwerte in Prozent angegeben wird, oder indem mitgeteilt wird, wie viel Prozent der männlichen und wie viel Prozent der weiblichen Untersuchungspersonen unter bzw. über einem bestimmten Messniveau lagen.
Ein häufig gebrauchtes Maß ist daher die Effektstärke d. Sie gibt die Mittelwertdifferenz in Einheiten der Standardabweichung an, d.h. sie kombiniert Informationen über Mittelwert- und Verteilungsunterschiede. Außerdem lässt sich am Vorzeichen des „d“-Wertes die Wirkrichtung des Unterschiedes ablesen. Üblicherweise bedeutet ein positives d einen Geschlechtsunterschied zugunsten der männlichen Testpersonen, weiblicher Vorsprung führt zu einem negativem d-Wert. Die Effektstärke ist auch das in Metaanalysen zu Geschlechtsunterschieden am häufigsten verwendete Maß.
In Forscherkreisen wird darüber diskutiert, ab welchem Wert der Effektstärke Geschlechtsunterschiede groß genug sind, um als „wichtig“ zu gelten. Eine von Cohen (1962, 1965) vorgeschlagene Konvention, wonach Effektstärken von bis zu einer Viertel-Standardabweichung (d = 0.25) als „klein“, bis zu einem d = 0.50 als „mittel“ und über d = 0.80 als „groß“ zu bezeichnen seien, wurde von manchen Autorinnen und Autoren übernommen. Halpern (1986: 60) weist jedoch darauf hin, dass die Größe des Effektstärkemaßes nicht ohne weiteres auf die Wichtigkeit des gemessenen Geschlechtsunterschiedes schließen lässt. Ein kleiner Effekt kann immer noch zu großen Unterschieden an den extremen Enden der Verteilungskurven führen, z.B. in der Häufigkeit, in der Jungen und Mädchen Spitzenleistungen in einem mathematischen Schulleistungstest erzielen (a.a.O.: 62 ).
I.4.5 Die Interpretation von Forschungsergebnissen
Forschungsergebnisse zu Geschlechtsunterschieden bedürfen in den meisten Fällen der Interpretation. Da z.B. statistische Signifikanz für sich genommen keinen Maßstab für praktische Relevanz oder Wichtigkeit darstellt, müssen Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse auf die Lebenswirklichkeit rückbeziehen. Was bedeutet es, wenn sich in einer Schweizer Untersuchung (Keller 1998) zu den mathematischen Schulleistungen in den Klassen 6 bis 8 die Jungen mit einer Effektstärke von d = 0.14 bis d = 0.19 bessere Leistungen erreichten als die Mädchen? Dies ist, nach obiger Konvention, ein kleiner Unterschied. Doch Geschlechtsunterschiede bewegen sich oft in dieser Größenordnung. Effektstärken von d = 0.5 oder mehr sind äußerst selten. Sind diese verhältnismäßig kleinen Unterschiede deshalb unbedeutend?
Zum Umgang mit Forschungsergebnissen sind drei Hinweise geboten: Zum ersten sollten Forscherinnen und Forscher selbst verdeutlichen, was nach ihrer Ansicht die Ergebnisse ihrer Forschung für die Praxis, also z.B. den Schulalltag von Jungen und Mädchen bedeuten. An der Plausibilität dieser Erläuterungen bemisst sich zum Teil auch der Wert der Forschungsergebnisse.
Zum zweiten ist zu beachten, dass Befunde, in denen Geschlechtsunterschiede nachgewiesen wurden, häufiger berichtet werden als Befunde, in denen das nicht der Fall ist (Richter 1996: 25). Deshalb muss von einer Tendenz zur Überbewertung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter, gleich in welchem Bereich, ausgegangen werden. Dies mag von der Tatsache ablenken, dass es Verteilungen wie die in Abb. 1 dargestellten Verteilungen D bis F im Bereich der Geschlechtsunterschiede praktisch nicht gibt. Tatsächlich überlagern sich in den meisten Merkmalen, in denen Geschlechtsunterschiede gefunden werden, die Verteilungen zum überwiegenden Teil, auch wenn die Mittelwerte voneinander abweichen (Gage & Berliner 1996: 184).
Zum Dritten ist von einer allgemeinen Tendenz auszugehen, Geschlechtsunterschiede als stärker zu interpretieren, als sie gemessen wurden (Bischof 1980: 41 – nach Richter 1996: 26). Dieser Effekt ist in Abbildung 2.1/ 2.2 veranschaulicht (entnommen Richter 1996).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I.5 Was wird in dieser Arbeit untersucht?
Eine der vornehmsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, Gerüchte als Gerüchte und Aberglauben als Aberglauben zu enttarnen, oder – aktueller ausgedrückt: Stereotype als Stereotype.
Deshalb ist es das erste Anliegen dieser Arbeit, verlässliches, empirisch begründetes Wissen über Geschlechtsunterschiede in Mathematik bereit zu stellen. Es geht um die Beantwortung der Frage: Gibt es Unterschiede in den Leistungen von Jungen und Mädchen bzw. Männern und Frauen, die vom Geschlecht abhängig sind? Wenn ja: In welchen Bereichen finden sich diese Unterschiede und wie ausgeprägt sind sie?
Das erste Untersuchungskapitel (Kap. II) ist daher der Sichtung von Geschlechtsunterschieden in der Mathematikleistung gewidmet, und es wird versucht, ein möglichst scharfes Profil der geschlechtsabhängigen Leistungsverteilung zu zeichnen. Hängen mögliche Unterschiede vom Schwierigkeitsgrad ab oder vom Alter? Schlagen sie sich in Schulnoten ebenso nieder wie in speziellen Tests? Sind Mädchen tatsächlich häufiger rechenschwach und seltener hochbegabt? Und nicht zuletzt: Zeigen sich Geschlechtsunterschiede in Mathematik auch in anderen Ländern?
Bei Untersuchungen dieser Art, zumal in einem vermeintlichen „Leistungsfach“ wie Mathematik, droht eine Gefahr allenthalben: der allzu menschliche Impuls, nun endlich wissen zu wollen,, welches Geschlecht denn nun das begabtere, klügere, mathematischere, bessere sei. Doch ist es aus Gründen der Wissenschaftlichkeit dringend geboten, dieser Versuchung zu widerstehen. Denn die Ergebnisse eines mathematischen Leistungsvergleiches bedeuten, für sich genommen, sehr wenig.
Jeder Leistungsvergleich, gleich in welchem Bereich, gründet seine Aussagekraft auf zwei Voraussetzungen: Erstens muss er unvoreingenommen, d.h. von einer unparteiischen, aufgeschlossenen Warte aus, durchgeführt werden. Zweitens muss er beiden Parteien des Vergleiches gleiche Wettbewerbsbedingungen einräumen. Zum Beispiel hat ein Marathonläufer, der mit 5 Kilometern Vorsprung losläuft, zwar gute Chancen, als erster ins Ziel zu kommen, aber deshalb ist er noch nicht der bessere Läufer. Solange die Bedingungen also nicht für alle gleich sind, müssen Unterschiede im Ergebnis nicht verwundern. Andererseits liegt es im Interesse eines jeden wirklichen Vergleiches herauszuarbeiten, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter gleichen Voraussetzungen aus ihren Fähigkeiten machen.
Übertragen auf diese Arbeit bedeutet dies, dass in einem zweiten Schritt die Voraussetzungen der Geschlechter für das Begreifen und Lernen von Mathematik und für die Mathematikleistung verglichen werden. Haben Frauen und Männer oder Mädchen und Jungen gleiche Startbedingungen? Sind sie gleich gut trainiert? Werden sie gleichermaßen von ihren Anhängern unterstützt? Haben sie genug Proviant? Sind sie gleich talentiert?
Die Kapitel III und IV versuchen diese Fragen für den Bereich der kognitiven Fähigkeiten und der Persönlichkeitsvariablen zu beantworten. Die Relevanz beider Bereiche für die Mathematikleistung dürfte unmittelbar einleuchten. Im Kapitel III geht es etwa um die Frage der Intelligenz und der Intelligenzstruktur. Dort wird auch untersucht, ob es Hinweise für eine unterschiedliche Begabungsausstattung der Geschlechter gibt.
In Kapitel IV werden die Geschlechter hinsichtlich ihres Interesses, ihrer Einstellungen, ihres Selbstvertrauens und ihrer Motivation verglichen. Außerdem wird der Frage nachgegangen, mit was für Rollenvorstellungen hinsichtlich Mathematik die beiden Geschlechter durch Erziehung und Schule versehen werden. Gilt Mathematik für Mädchen als genauso gemäß wie für Jungen?
Nach diesen drei Kapiteln bleibt kein Platz für weitere Befunde, selbst wenn der Informationsbedarf noch immer nicht gedeckt sein sollte. Deshalb wurden in dieser Arbeit die Untersuchungsbereiche „biologische Merkmale“ oder „Umwelteinflüsse“ ausgespart. Auch auf die Darstellung von Theorien wird verzichtet. Dies mag zunächst als Mangel erscheinen, wird aber zugunsten eines ausführlicheren und dadurch hoffentlich deutlich informativeren Vergleichs in Kauf genommen.
Die Arbeit legt einen Schwerpunkt auf Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen. Dies hat zwei Gründe. Zum einen ist das Angebot an Fachliteratur für diese Altersgruppe sehr viel größer als für Erwachsene. Geschlechtsunterschiede in Mathematik sind, sofern überhaupt als Problem begriffen, in erster Linie ein Problem der Pädagogik und der pädagogischen Psychologie. Außerdem werden sie bevorzugt in der Phase ihrer Entstehung erforscht. Zum anderen waren Kinder und Jugendliche aus Sicht des Verfassers einfach interessanter, nicht zuletzt durch eigene berufliche Beschäftigung mit dieser Altersgruppe. Welche der diskutierten Befunde sich auch auf Erwachsene erstrecken oder verallgemeinern lassen, kann dem Text zudem meistens entnommen werden.
II. Geschlechtsunterschiede in der Mathematikleistung
Viele Forschungsbefunde deuten auf eine höhere Leistungsfähigkeit von Jungen in Mathematik hin. Die Unterschiede gelten jedoch nicht uneingeschränkt; sie müssen einerseits nach mathematischen Teilbereichen, Schwierigkeitsgrad, Alter u.ä. differenziert werden, zum anderen sind manche Befunde auch umstritten. In diesem Kapitel werden Belege für Geschlechtsunterschiede in der Mathematikleistung zusammengetragen, analysiert und diskutiert.
Seit mehreren Jahrzehnten werden immer wieder Untersuchungen berichtet, wonach Mädchen in Mathematik schlechtere Leistungen zeigen als Jungen. Durch überregionale und internationale Studien zur schulischen Leistungsfähigkeit, z.B. die „Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie“ (TIMSS/ III), die Studie PISA 2000, oder den „Scholastic Aptitude Test“ (SAT), eine in den Vereinigten Staaten jährlich an High Schools durchgeführte Testreihe, werden solche Befunde öffentlich bekannt. Aber auch in zahlreichen spezifischeren Untersuchungen sowie in Metaanalysen wurden weltweit Geschlechtsunterschiede zugunsten männlicher Testpersonen nachgewiesen, so dass manche Forscher den männlichen Leistungsvorsprung in Mathematik zu „den am deutlichsten ausgeprägten und am besten dokumentierten Befunden über Geschlechtsunterschiede im Bereich der Psychologie“ zählen (Klieme 1986: 133).
Handelt es sich bei den Leistungsunterschieden um ein universales Phänomen – sind Mädchen und Frauen grundsätzlich weniger leistungsfähig in Mathematik? Diesem Eindruck wurden und werden immer wieder gut begründete Einwände entgegen gehalten. So kam eine viel beachtete amerikanische Metaanalyse (Hyde et. al. 1990) zu dem Schluss, dass die Leistungsunterschiede im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre immer geringer geworden und in manchen Bereichen bereits ganz verschwunden seien. Erklärungsbedürftig ist auch die Erkenntnis, dass Geschlechtsunterschiede im Bereich der Grundschulmathematik keine signifikante Rolle spielen, sondern sich erst im Laufe der weiteren Schullaufbahn ausbilden. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass auch die oben erwähnten Studien zwar eine durchschnittliche Überlegenheit von männlichen Probanden auswiesen, diese aber in einzelnen Teilbereichen der Mathematik nur gering oder gar nicht vorhanden sei. Und nicht zuletzt scheinen die in mathematischen Tests erhobenen Leistungen von Mädchen ihren häufig gleichwertigen oder besseren Schulnoten im Fach Mathematik zu widersprechen.
[...]
[1] aus paritätischen Gründen sei hier männliches Geschlecht unterstellt
Häufig gestellte Fragen
Haben Mädchen tatsächlich mehr Mühe mit Mathematik?
Die Forschung zeigt, dass Geschlechtsunterschiede oft erst ab dem Jugendalter deutlich werden und stark von Umweltfaktoren und Motivation abhängen.
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“ in der Forschung?
„Sex“ bezieht sich auf das biologische Geschlecht, während „Gender“ die sozialen und kulturellen Aspekte der Geschlechterrolle beschreibt.
Welchen Einfluss haben Geschlechterstereotype?
Stereotype beeinflussen das Selbstvertrauen und das Fähigkeitsselbstkonzept von Mädchen, was dazu führen kann, dass sie Mathematik als weniger „weiblich“ oder lohnend ansehen.
Gibt es kognitive Unterschiede in den mathematischen Fähigkeiten?
Die Arbeit untersucht Faktoren wie räumlich-visuelle und quantitative Fähigkeiten und prüft, ob diese biologisch oder durch Übung bedingt sind.
Warum gibt es so wenige Mathematikprofessorinnen?
Dies liegt laut Studie weniger an mangelnder Begabung als vielmehr an Bildungsbiografien, fehlenden Vorbildern und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Ulf Grebe (Author), 2004, Mädchen und Mathematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209372