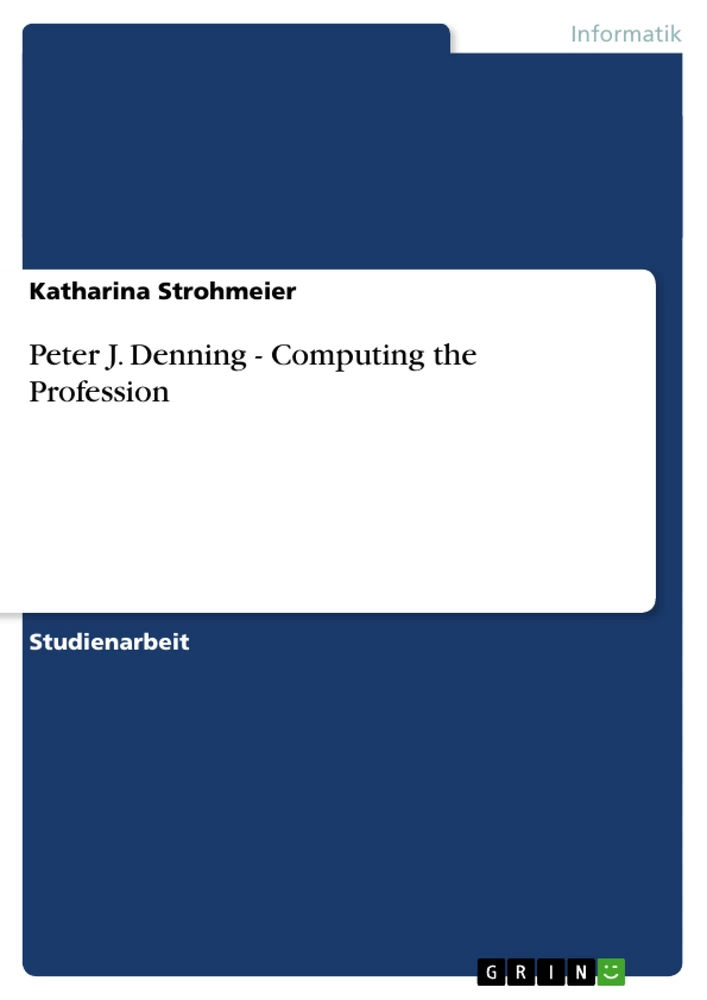Es erscheint fast wie eine rhetorische Frage, wenn man Studierende der Informatik darauf
anspricht, ob sie während ihres Studiums je das Gefühl hatten, dass sie das, was sie an der
Universität lernen, nie im Berufsleben gebrauchen würden. Allgemein verbreitet ist der Eindruck,
an den Universitäten würde am Bedarf vorbei gearbeitet und ausgebildet. Informatiker
scheinen eher ihren eigenen Interessen nachzugehen als nach denen potenzieller Kunden zu
fragen. Traditionell befassen sie sich eher mit theoretischen Entwürfen und Modellen als mit
praktischen Anwendungen.
Umgekehrt beklagen sowohl Anwender als auch Arbeitgeber in der Industrie die mangelhafte
Unterstützung, die ihnen im Umgang mit Computern von Seiten der Universitäten entgege ngebracht
wird. Studenten prangern an, dass sie an den Instituten für Informatik keine praxisnahe
Ausbildung erhalten und dass sie umgekehrt die Dinge, die sie lernen, später im Berufsleben
nur bedingt anwenden können. Die akademische Informatik, so scheint es, hat sich weit
entfernt vom tatsächlichen Bedarf.
Die akademische Arbeitsweise entbehrt jedoch nicht einer gewissen Logik. Ihrem Anspruch
und ihren Wurzeln nach ist die Informatik eine wissenschaftliche Disziplin. Ihre Wurzeln liegen
in Mathematik, Maschinenbau und Ingenieur wesen sowie den Naturwissenschaften. Als
in den 40er Jahren Menschen dieser Fachrichtungen zusammen kamen, um die ersten elektronischen
Rechner zu bauen, gingen viele davon aus, dass die neu entstandene Disziplin „Computer
Science“ nur eine Modeerscheinung sei, die irgendwann in einer der drei Ursprungsdisziplinen
aufgehen würde1.
Dies ist jedoch nicht geschehen. Und damit stellt sich die Frage, ob die Forschung in Zukunft
stärker mit dem Anwendungsbereich kooperieren und sich an ihm ausrichten sollte, um dem
steigenden Bedarf an problemorientierten Lösungen begegnen zu können. Zudem muss die
akademische Ausbildung einer eingehenden Prüfung auf Zweckmäßigkeit unterzogen werden.
Dieser Aufgabe hat sich im Jahr 2000 der amerikanische Informatiker Peter J. Denning gewidmet.
In seinem Aufsatz „Computing the Profession“ spürt er dem historisch gewachsenen
Berufsverständnis der akademischen Informatik nach und entwirft ein Modell für die Refo rmierung
der Forschung und Ausbildung in diesem Bereich. [...]
1 Vgl. Denning, Peter J., Computing the Profession, in: Greening, Tony (Hrsg.), Computer Science Education in
the 21st Century, New York 2000, S. 27-46, hier: S. 29.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Der Bedarf
- Die historische Entwicklung
- Die experimentelle Informatik
- Computational Science
- Software Engineering
- Der Ist-Zustand und seine Probleme
- Theoretisches Modell eines Berufsstandes von Computerfachleuten
- Ein allgemeines Modell mit Beispielen
- Die Medizin
- Das Gesetz
- Bibliotheken
- Übertragung des Modells auf die Informatik
- Dauerhafte Interessen
- Übergreifende Institutionen
- Verhaltensstandards
- Kompetenzzertifizierung
- Ein allgemeines Modell mit Beispielen
- Kompetenzen und Kriterien, die Berufsanfängern künftig vermittelt werden sollten
- Praktiken
- Applikationen
- Innovation
- Grenzbereiche
- Ein renoviertes akademisches Modell
- Zusammenfassung: Die Informatik richtet sich neu aus
- Zwiespälte lösen sich auf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz „Computing the Profession“ von Peter J. Denning befasst sich mit der Frage, wie sich das Berufsverständnis von Informatikern verändern muss, um einen effizienteren und problemorientierteren Ansatz in der Arbeitsweise zu ermöglichen und gleichzeitig eine leitende Funktion innerhalb des Berufsstandes der Computerfachleute zu sichern. Denning analysiert die historische Entwicklung der Informatik und beleuchtet den Bedarf an praxisnaher Forschung und Ausbildung.
- Das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Informatik
- Die Bedeutung einer praxisorientierten Ausbildung für Informatiker
- Die Notwendigkeit eines professionellen Berufsverständnisses für Informatiker
- Die Rolle von Berufsorganisationen und Kompetenzzertifizierung in der Informatik
- Die Relevanz des Bedarfs der Wirtschaft für die Ausrichtung der Informatikausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Aufsatzes beleuchtet die Ausgangslage der Informatik, indem es den Bedarf von Seiten der Wirtschaft und der Studierenden an praxisnaher Forschung und Ausbildung darstellt. Denning argumentiert, dass die akademische Informatik sich von den Bedürfnissen der Wirtschaft entfernt hat und dass die Studenten sich oft nicht in der Lage fühlen, das Gelernte im Berufsleben anzuwenden. Er untersucht auch den Einfluss der rasanten technologischen Entwicklung auf die Informatik.
Im zweiten Kapitel entwickelt Denning ein theoretisches Modell eines Berufsstandes, das er anschließend auf die Informatik überträgt. Dieses Modell umfasst Aspekte wie dauerhafte Interessen, übergreifende Institutionen, Verhaltensstandards und Kompetenzzertifizierung. Denning argumentiert, dass eine stärkere Professionalisierung der Informatik notwendig ist, um dem steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden.
Das dritte Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Kompetenzen und Kriterien, die Berufsanfängern künftig vermittelt werden sollten. Denning betont die Bedeutung von praktischen Fähigkeiten, Anwendungsorientierung, Innovationsfähigkeit und der Auseinandersetzung mit Grenzbereichen der Informatik. Er schlägt ein renoviertes akademisches Modell vor, das diese Aspekte stärker berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Aufsatzes sind die Professionalisierung der Informatik, die Bedeutung praxisnaher Forschung und Ausbildung, die Herausforderungen der rasanten technologischen Entwicklung, das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis sowie die Rolle von Berufsorganisationen und Kompetenzzertifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Peter J. Denning an der akademischen Informatik?
Denning kritisiert, dass sich die universitäre Ausbildung zu weit vom tatsächlichen Bedarf der Wirtschaft entfernt hat und oft zu theoretisch bleibt.
Was ist das Ziel seines Aufsatzes "Computing the Profession"?
Er entwirft ein Modell zur Reformierung von Forschung und Ausbildung, um die Informatik stärker als professionellen Berufsstand zu etablieren.
Welche Elemente machen laut Denning einen "Berufsstand" aus?
Dazu gehören dauerhafte Interessen, übergreifende Institutionen, ethische Verhaltensstandards und eine formale Kompetenzzertifizierung.
Wie kann die Kluft zwischen Theorie und Praxis geschlossen werden?
Durch eine stärkere Ausrichtung auf Applikationen, Innovationen und die Vermittlung praktischer Kompetenzen bereits im Studium.
Welche historischen Wurzeln hat die Informatik?
Die Disziplin entstand in den 40er Jahren aus der Zusammenarbeit von Mathematikern, Maschinenbauern und Naturwissenschaftlern.
- Citar trabajo
- Katharina Strohmeier (Autor), 2003, Peter J. Denning - Computing the Profession, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20993